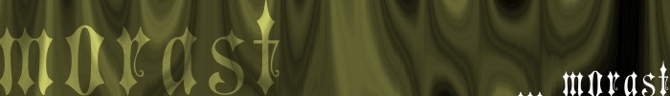Gern hätte ich auf dem fahrradisierten Heimweg einen halblangen, amüsanten Text über Nahrungsmittelveräußerungseinrichtungen ersonnen, in dem eben jenes Wort mindestens einmal präsent gewesen wäre, doch leider vergaß ich es unterwegs drei Mal und verbrachte mehr Zeit mit dem Erinnerungsversuch [und dem Radfahren] als mit dem Ausdenken des erwünschten Textes, dem es an ähnlich verkomplizierenden Worten sicherlich nicht gemangelt hätte.
Das Gestelz
"Gestelzte Sprache" nennt man das wohl - auch wenn ich unschlüssig darüber bin, wer "man" ist, da die wenigsten der mir bekannten Menschen das Partizip "gestelzt" zu ihrem aktiven Wortschatz zählen. Noch weniger werden allerdings die aktive Variante des Partizips, stelzend, beziehungsweise die dazugehörige Verbform, stelzen, nutzen - ich gehöre dazu. Natürlich kennt man die Stelzen, jene zwei Langstäbe mit Fußablagefläche, die Kindern und Clowns als umständliches Fortbewegungsmittel dienen, doch das zugehörige Verb scheint mir weniger gebräuchlich. Auch stellt sich die Frage, ob ein einzelner dieser Stäbe tatsächlich eine "Stelze" sei.
Gestelzte Sprache, ich behalte den Begriff einfach bei, gehört tatsächlich zu den von mir geliebten Dingen, insbesondere wenn ich selbst in das Vergnügen komme, sie zu nutzen. Unlängst wurde ich gebeten, für jemanden einen Satz zu formulieren, der jedoch sogleich abgelehnt wurde - weil er viel zu sehr nach meinem verwinkelten Schreib- und Redestil klang.
Dabei empfinde ich meinen Stil gar nicht als gestelzt - wasauchimmer dieses Wort genau heißen mag. Ich erfreue mich nur der Benutzung ansonsten weniger häufig verwendeter Worte. Anstelle von "golden" sage ich "gülden", anstelle von "neulich" "unlängst". Letzteres hat allerdings einen anderen Grund als den einer Synonymsuche. Denn jedesmal, wenn ich von einem Ereignis aus meinem Leben berichten wollte und mit "Neulich..." begann, ließ es sich G nicht nehmen, den Ärzteklassiker "
Fafafa" komplett durchzurappen, ohne daß es eine Möglichkeit gab, ihn daran zu hindern. Dementsprechend war mir nicht wenig daran gelegen, diesen Trigger durch ein Ähnliches aussagendes Wort zu ersetzen.
Viel lieber als "Nahrungsmittelveräußerungseinrichtung" hätte ich übrigens "Nahrungsmittelveräußerungs
anstalt" gesagt, doch lastete diesem Wort etwas Klinisches an, das mit den gemeinten Kaufhallen und Supermärkten kaum in Einklang zu bringen war. "Nahrungsmittelveräußerungsanstalt" ist zudem auch noch länger, wirkt dementsprechend umständlicher und somit gestelzter.
Allerdings beweist allein der eben genannte Fakt des "Nahrungsmittelveräußerungsanstalt"-Bevorzugens, daß es bei der von mir benutzten Sprache nicht vorrangig darum geht, normale Worter durch solche maximaler Länge zu ersetzen. Denn sicherlich ersönne ich innerhalb weniger Augenblicke ein anderes Kaufhallensynonym mit wesentlich größerem Buchstabenreichtum, wenn ich nur danach trachtete. Doch ich trachte nicht, denn obgleich der deutschen Sprache der Luxus innewohnt, eine Unzahl an Substantiven problemfrei aneinanderreihen zu können, vergehen doch Leselust und Hörvergnügen, sobald das Wort Dimensionen erreicht, die der menschliche Geist nicht mehr zu fassen imstande ist.
Ähnlich verhält es sich mit Schachtelsätzen, denen ich natürlich auch nicht selten fröne. Unlängst wurde mir beim Verlesen eines von mir verfaßten Satzungetüms bewußt, daß ich selbst den Durchblick verloren hatte, welcher Teil mit welchem zusammenhing. Dennoch bewundere ich Menschen wie Kleist und Kafka, die dem Schachtelsatz eine Kunstfertigkeit schenkten, die in der heutigen Literatur kaum noch geachtet wird.
Tatsächlich bevorzugt man nun bukowskische Sätze, deren Länge unter keinen Umständen eine komplette Zeile füllen sollte. Das behagt mir nicht, und ich verwehre mich dem allseits geforderten Kurzfassen. Selbstverständlich ist es dem Verständnis wissenschaftlicher Komplexwerke nicht zuträglich, sich zusätzlich zum Inhalt auch noch mit der Satzstruktur auseinandersetzen zu müssen. Dennoch sollte die schöngeistige Literatur sich nicht mit Steifheit auf brillierende Inhalte festlegen, sondern sprachliche Schnörkel weiterhin als hin und wieder begehrenswert erachten.
Ich begehre. Ich erfreue mich des Spiels mit Worten, der Erfindung neuer, der Verknüpfung ganzer Sentenzen zu Konstrukten, die mich in ihrer Umständlichkeit, in ihrem Gestelz, wohlig erschauern lassen.
Ich entsteige meinem Fahrrad und lächle. Soeben kamen mir die Lebensmittelveräußerungseinrichtungen wieder in den Sinn und mit ihnen die Frage, ob es in ihren Non-Food-Abteilungen jemals Stelzen zu kaufen geben wird.
Ich hätte nämlich gern eine.
morast - 19. Sep, 21:45 - Rubrik:
Wortwelten
Die blendende Laune, die in mir wohnt, ist nahezu schon krankhaft. Ich habe Angst vor mir.
Unlängst entdeckte ich mich auf einer Reihe in geselliger Rune geschossener Fotos - und auf allen lachte oder grinste ich. Der Anblick erschreckte mich, konnte ich mich doch gar nicht daran erinnern, mich derart gut amüsiert zu haben.
Ich begann, mich zu beobachten.
Obgleich ich durchaus hin und wieder dazu neige, mich in Gedanken zu suhlen und trübseliger Inexistenz hinzugeben, obgleich ich mich zuweilen empöre und alles Menschsein mit Verachtung zu bestücken bereit bin, obgleich ich wieder und wieder an der Intelligenz anderer, an mir selbst, zweifle, obgleich ich einer ständigen Angst vor dem Zukünftigen fröne und oft kleinste Schritte mir überirdische Mühen bereiten, obgleich ich mich manchmal in einer Spirale des emotionalen Unwohlseins ertrinken sehe, ohne einen Auswege zu finden oder gar suchen zu wollen, obgleich ich oft genug alles Äußere oder auch Innere abzuschalten bereit bin, obgleich ich über eine ausreichend große Zahl an Lebensmomenten gibt, die - ihrem Inhalt nach koloriert - nur dunkelste Grautöne ergeben würden, obgleich all dessen - geht es mir gut.
Auffallend oft freue ich mich, lächle nach außen oder in mich hinein, ganz leise, als könnte ich den Grund des Lächelns durch grobe Mundwinkelbewegungen zerbrechen. Ein jahrelang bester Freund meinte einst, daß er mich nur gutgelaunt kennen würde - eine Aussage, die ich zu diesem Zeitpunkt nicht begriff. Doch heute verstehe ich, denn ich liebe es, Welt und Leben wohlgesonnen gegenüberzustehen, Kleinstdinge aufzunehmen und mich an ihrem Klang, ihrem Aussehen, zu erfreuen.
Irgendwann, inmitten meiner Selbstbeobachtung, reifte in mir die Erkenntnis, daß ich selbst Grund meiner Freude bin. Es ist nicht nötig, daß ich während eines Konzertes die Gesten anderer nachhame, um Glück zu empfinden, wenn ich doch den blanken Moment schon als wonnebringend erkannte. Es ist nicht nötig, auf einer Feierlichtkeit, bei einem Treffen, mit jedem Anwesenden zu dialogisieren oder mich durch weise oder amüsante Gesprächsinhalte nach vorne zu stoßen, wenn ich sitzend und schweigend festelle, daß es ich mich genau jetzt wohlfühle. Es ist nicht nötig, daß stundenlang angeblich erheiternde Sendungen irgendwelcher Medien verfolge, um mein Gemüt zu erhellen, wenn die Erkenntnis, daß sich der Flußname "Elbe" durch "LB" abkürzen läßt, mich doch tagelang zu besonnen weiß.
Es ist leicht, mir Frohsinn zu bringen, stellte ich fest. Schon während meienr Schulzeiten, war ich oft der einzige, der über die Scherze des Klassenkaspers lachte - weil meine Heiterkeitshemmschwelle äußerst niedrig angesiedelt ist. Heute bedarf es nur netter Menschen [von denen glücklicherweise nicht wenige auf Erden wandeln], guter Musik [mit der ich mich oft genug umgebe], einer deliziösen Mahlzeit [Oft genug ist eine billige Fertigmahlzeit lecker genug, um mich zu erfreuen.], interessanter Worte [in Buchform aber auch einzeln], eines Erfolges [Schon eine nette Zeichnung, einen angenehmen Text, vollbracht zu haben, birgt das Gefühl, etwas geleistet zu haben.] oder anderer winziger oder weniger winziger Kleinigkeiten, um mich zu verzücken.
Nicht selten visualisiere ich einen Gute-Laune-Balken vor meinem inneren Auge, dessen Pegel an unschönen Abenden stetig fällt. Ich bemühe mich stets, die Lokalität zu verlassen, bevor der Pegel den Nullwert berührt oder unterschreitet. Zu meinem letzten Geburtstag beispielsweise rang ich mich dazu durch, den Abend in einer von mir noch nie als gut empfundenen Diskothek ausklingen zu lassen. Ich visualisierte den rasch sinkenden Gute-Laune-Pegel und meisterte es, rechtzeitig vor dem Nullpunkt entflohen zu sein. Bis heute habe ich den Abend als angenehm in Erinnerung, obwohl ich mich deutlich einer Unzahl an Fluchtgründen entsinne.
Bemerkenswert an dem Gute-Laune-Balken ist, daß er, wenn ich irgendwo eintreffe, stets gefüllt zu sein scheint, daß ich also die gute Laune ständig mit mir herumtrage, auf daß sie abgebaut oder - die bessere Alternative: gesteigert werden möge.
Ich bin kein strahlender Sonnenschein. Ich laufe nicht mit einem glitzernden Lächeln durch die Gegend und beglücke andere mit meinem lebensfrohen Gemüt. Ich liebe eher das Schmunzeln, das unmerkbare Heben meines rechten Mundwinkels.
Entscheidend ist, was sich in meinem Kopf abspielt, welche Satzfetzen dort aufeinandertreffen, welche Bilder in meinem Schädel umherwirbeln.
Ich bin mir unschlüssig darüber, ob es leicht ist, mich zu verstimmen. Ich trage genug Ruhe in mir, um gegen spontane Anfeindungen gewappnet zu sein, genug ironisches Grinsen, um Dummes, Erzürnendes, als lächerlich abtun zu können, genug Optimismus, um mich stetig glauben zu lassen, alles werde sich zum Guten wenden.
Andererseits kann ein unbedacht geäußerter Satz ausreichen, mich zu fällen, Stundenlang sitze ich dann mit mir selbst irgendwo und sinne darüber nach, was gemeint sein könnte, ob das Gesagte stimmt, wie ich es, mich, ändern könnte, ob ich zur Veränderung bereit bin, ob ich dazu imstande wäre - oder ob ich gerade nur irgendwo herumsitze und Gedanken über Dinge nachhänge, die eigentlich unbedeutsam, nichtig, sind.
Wenn Dinge nicht den Verlauf nehmen, den ich mir für sie erdachte, verstimme ich zuweilen. Ich bemühe mich schon, nichts erwarten zu wollen, weil ich weiß, daß meine Fantasie blüht, sprießt und gedeiht, weil ich weiß, daß ich albernen Vorstellungen aufsitze, mich an ihnen ergötzen werde, wenn ich beginne, Dinge zu erwarten, das Kommende vorauszuzeichnen. Es fällt leicht zu hoffen, doch scher, im Anbetracht vergeblicher Hoffnungen nicht zu verzweifeln.
Worüber ich leicht in Rage gerate, ist offensichtliche Sinnlosigkeit, Logik, die ich nicht mit meiner zu schlagen imstande bin, Starrheit der Ansichten, fehlende Fairnis in Argumentation udn tat. Nicht selten sind es Maschinen und Programme, die so meinen Zorn auf sich ziehen. Doch ebenso rasch, wie er emporsteigt, fällt er wieder zurück und läßt mich zurück, mich über meine Unbeherrschtheit wundernd.
Nicht selten schweige ich in Diskussionen, wenn ich glaube, daß der Gesprächspartner meinen Punkt zu verstehen nicht ebreit ist oder erahne, daß jeder Disput überflüssig ist, weil kein Ergebnis lieferbar sein wird. Ich lausche den Argumenten des anderen und denke mir meinen Widerspruch. Später werde ich das Gesagte resümieren und meine Ansicht variieren - oder beibehalten. Es liegt mir jedoch nicht viel daran, bei Gesprächen mich in Unlaunen zu stürzen, einzig, weil Meinungen aufeinandertreffen. Notfalls ziehe ich mich zurück und fröne der Betrachtung meines Gute-Laune-Pegels.
Das Zurückziehen ist ohnehin ein beliebtes Treiben meiner selbst. In trüben Momenten suche ich nicht selten das Schweigen, verfolge die Umgebung mit nur mäßigem Interesse, verweile irgendwo in mir und harre der Dinge, die wiederum meiner harren. Oder ich erfreue mich der Erinnerung irgendwelcher Tagesbegebenheiten, irgendwelcher Gedanken, die ich hatte, und beginne wieder nach innen zu schmunzeln.
Wenn ich schweige, bedeutet das weder Abwesenheit noch Trübsal. Oft genug schweige ich, um aufzusaugen, um zu erfahren, zu hören. Prall bepackt ist die Welt mit Dingen, von denen ich zu wenig oder gar nichts weiß. Ich bin neugierig, freue mich über neues Wissen, bewahre es nicht selten wie kostbare Perlen in meinen Gedanken auf, hole es bei Gelegenheit hervor und erfreue mich seines Glanzes.
Und dann gibt es noch die Menschen. Menschen vermögen immer wieder, mich zu verzücken, mich lachen zu machen, mich in Erstaunen zu versetzen. Nicht alle, doch glücklicherweise kenne ich genug, deren bezaubernde Eigenschaften ich suche und genieße. Ich liebe Kreativität, liebe es, wenn Menschen sich spontanen Geistesblitzen hingeben können, wenn sie Ideen in ihre Umwelt schießen, angenehm wie frischer Zahnputzatem. Oder wenn sie sich in die Unerreichbarkeit ihrer Kunst zurückziehen, darbeiten, wozu sie imstande sind, Neid in mir entfachen, der mich glücklich macht. Ich begreife, nicht zu Gleichem instande zu sein, doch muß es auch nicht, weil ich hier und jetzt die Schönheit der Kunst aufsammeln und mich an ihr laben kann.
Es gibt keine normalen Menschen, weiß ich seit langem. Doch Menschen, die verrückter sind als andere, die faszinierenden Unsinnigkeiten frönen können, begeistern mich. Ich liebe es herumzualbern, mich geborgen zu fühlen in einer Wolke fast absurder Ungewöhnlichkeiten, die allesamt auf ihrem Art liebenswürdig sind, liebe es, selber inspiriert zu werden und das Unmögliche zu ersinnen.
Menschen wissen Geschichten zu erzählen, und nicht selten verbirgt sich darin Spannenderes als in den vielen Büchern, in die ich bereits versank. Und selbst wenn niemanden kenne, nur sehe, beobachte, erachte ich Menschen als faszinierend. Sie bilden Spiegel, Spiegel meiner selbst, aber auch Spiegel der mich umgebenden Wirklichkeit.
ich liebe es, Menschen um mich herum zu wissen, benötige zuweilen gar für das Alleinsein das Vorhandensein anderer. Wer wollte nicht in frohe Stimmung geraten, wenn in einem Café das städtische Leben zelebriert wird, wenn sich in unmittelbarer Nähe bekannte und Unbekannte treffen und begrüßen, wenn sie über Nichtigkeiten und Wichtigkeiten reden, innehalten bei einem Getränk, hinauseilen zum nächsten wichtigen Termin, während man selbst in Ruhe verbleibt und auf den wachsenden Berg interessanter Wortaneinanderreihungen blickt, der vor der eigenen Nase gedeiht.
Ich liebe es, den Fahrradfahrtwind in meinem Gesicht zu spüren, liebe es zu eilen, den Schweiß der unnötigen Anstrenungung in meinen Kleidern zu spüren, liebe es auch zu ruhen, mich gemächtlichen Schrittes dem nächsten Ziel zuzuwenden. Die Welt ist voller kleinigkeiten, die mich lächeln lassen können.
Irgendwann streift mich das Lächeln einer schönen Frau, gesellt sich zu meiner ohnehin wogenden Freude, läßt mich ängstlich nach unten blicken, als könnte ich schon abgehoben zu sein, irgendwo über allen Dingen schweben. Ich stehe noch, doch spüre die Fröhlichkeit in mir, wie sie mich drängt, mich fast platzen läßt, mir Hopserläufe und ein dümmliches Grinsen aufdrängt. Es hilft nicht, daß die Passierenden zurücklächeln, als gelte meine Freude ihnen [Warum auch nicht?]; es hilft nicht, daß ich mich zwinge zu sitzen und darüber zu sinnieren, warum es mir gutgeht; es hilft nicht zu begreifen, daß die Welt voll Dinge ist, über die zu freuen sich lohnt; es hilft nicht zu erkennen, daß ich gerne glücklich bin...
morast - 19. Sep, 15:40 - Rubrik:
Wortwelten