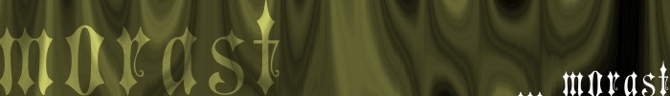Viele Worte
Ich verliere gerne viele Worte.
Wenn ich von einem Ereignis berichte, das mir widerfuhr, wenn ich Dinge erwähne, von denen ich hörte, wenn sich die Thematik in jene Bereiche begibt, die sich mit denen meines Interesses decken, schwafle ich. Nicht nur mündlich, auch schriftlich. Ich bin überhaupt nicht imstande, mich kurz zu fassen, und auch wenn ich es hin und wieder versuche, muss ich doch feststellen, dass es mir nicht gelingt. Selbst die einfachste Information wird in meinen Gedanken mit Verschnörkelungen versehen, die ich nicht selten für wichtig erachte.
Wenn ich zu erzählen beginne, entdecke ich oft, dass eine Vorgeschichte existiert, die nicht minder interessant ist und die dazu beiträgt, den eigentlichen Inhalt besser zu erfassen. Doch leider verfügt die Vorgeschichte ebenso über eine Vergangenheit, und häufig müssen auch hilfreiche Erläuterungen zwischengeschoben werden. Rasch entwickelt sich ein eigenlich harmloser Fakt zu einer kleinen Geschichte, zu einem Wirrwarr von Informationen, das ich sorgsam zu einem Paket verschnüre. Ich erzähle gerne und mag es daher, den Fluss der Geschichte zu steuern, gezielt auf Neben- und Hauptpfaden zum Kern hinzulenken, zur Auflösung, die ich – natürlich – bis zum Schluss hinausgezögere. Selbst wenn es zum besseren Verständnis notwendig wäre, den Kern schon vorher preiszugeben, weigere ich mich, lasse ein paar Andeutungen fallen und strapaziere die Geduld von Zuhörern und Lesern.
Komm zum Punkt!, lese ich auf den Gesichtern, doch das erweist sich als unmöglich. Stets exisitieren unzählige Nebeninformationen, die ich für relevant halte, von denen ich glaube, dass sie keinesfalls weggelassen werden können, so viele Wörter, die mir noch auf der Zunge liegen, darauf wartend intoniert zu werden. Rascher zum Punkt zu kommen, bedeutet für mich nur, schneller zu reden.
L meinte mal zu mir, dass sie hoffe, mich niemals dolmetschen zu müssen. Denn nichts ist anstrengender für einen Übersetzenden, als erst nach dem Ende des Gesagten zu erfassen, was dessen Inhalt gewesen war – und dann erst mit dem Dolmetschen beginnen zu können.
Ich mag die deutsche Sprache, liebe es, mit Wörtern zu spielen, neue zu erfinden. Etwas zu erzählen bedeutet für mich, nicht nur eine Information zu verkünden, sondern zugleich die Möglichkeiten meines Wortschatzes auszuschöpfen und zu erweitern, kleine Kunstwerke zu bauen, an denen ich mich heimlich erfreue.
Außerdem liebe ich Schwulst. Seit Jahren bereits finde ich Gefallen daran, meine Sprache mit veralteten Ausdrücken und umständlichen Wendungen zu zieren, Sätze zu verlängern und immer neue Synonyme für bereits verwendete Wörter zu entdecken. Ich mag Anaphern und Epiphern, Alliterationen und Wiederholungen, Aufzählungen und Einschübe – selbst wenn das Textverständnis darunter leidet.
Wie kann es da verwundern, dass es mir nicht gelingt, mich kurz zu fassen, dass ich mich am klanglichen Konstrukt des Satzes erfreue, während Leser oder Zuhörer nur auf die Information warten, die am Ende meiner Ausführungen folgen wird? Wie kann es da verwundern, dass, selbst wenn ich mich bemühe, nur wenige Worte zu verwenden, am Ende doch wieder ein Text entsteht, dessen sich Länge weit jenseits des eigentlich Gedachten befindet?
Heute las ich eine Frage, die ich mir selbst zu beantworten versuchte: Wie ordnest du deine Bücher? Die gelesene Antwort war – erstaunlicherweise – "Nach Farben.". Die in meinem Kopf entstehende Antwort jedoch nahm schnell romanartige Formen an. Ich schüttelte schmunzelnd den Kopf und begann, sie aufzuschreiben.
Wenn ich von einem Ereignis berichte, das mir widerfuhr, wenn ich Dinge erwähne, von denen ich hörte, wenn sich die Thematik in jene Bereiche begibt, die sich mit denen meines Interesses decken, schwafle ich. Nicht nur mündlich, auch schriftlich. Ich bin überhaupt nicht imstande, mich kurz zu fassen, und auch wenn ich es hin und wieder versuche, muss ich doch feststellen, dass es mir nicht gelingt. Selbst die einfachste Information wird in meinen Gedanken mit Verschnörkelungen versehen, die ich nicht selten für wichtig erachte.
Wenn ich zu erzählen beginne, entdecke ich oft, dass eine Vorgeschichte existiert, die nicht minder interessant ist und die dazu beiträgt, den eigentlichen Inhalt besser zu erfassen. Doch leider verfügt die Vorgeschichte ebenso über eine Vergangenheit, und häufig müssen auch hilfreiche Erläuterungen zwischengeschoben werden. Rasch entwickelt sich ein eigenlich harmloser Fakt zu einer kleinen Geschichte, zu einem Wirrwarr von Informationen, das ich sorgsam zu einem Paket verschnüre. Ich erzähle gerne und mag es daher, den Fluss der Geschichte zu steuern, gezielt auf Neben- und Hauptpfaden zum Kern hinzulenken, zur Auflösung, die ich – natürlich – bis zum Schluss hinausgezögere. Selbst wenn es zum besseren Verständnis notwendig wäre, den Kern schon vorher preiszugeben, weigere ich mich, lasse ein paar Andeutungen fallen und strapaziere die Geduld von Zuhörern und Lesern.
Komm zum Punkt!, lese ich auf den Gesichtern, doch das erweist sich als unmöglich. Stets exisitieren unzählige Nebeninformationen, die ich für relevant halte, von denen ich glaube, dass sie keinesfalls weggelassen werden können, so viele Wörter, die mir noch auf der Zunge liegen, darauf wartend intoniert zu werden. Rascher zum Punkt zu kommen, bedeutet für mich nur, schneller zu reden.
L meinte mal zu mir, dass sie hoffe, mich niemals dolmetschen zu müssen. Denn nichts ist anstrengender für einen Übersetzenden, als erst nach dem Ende des Gesagten zu erfassen, was dessen Inhalt gewesen war – und dann erst mit dem Dolmetschen beginnen zu können.
Ich mag die deutsche Sprache, liebe es, mit Wörtern zu spielen, neue zu erfinden. Etwas zu erzählen bedeutet für mich, nicht nur eine Information zu verkünden, sondern zugleich die Möglichkeiten meines Wortschatzes auszuschöpfen und zu erweitern, kleine Kunstwerke zu bauen, an denen ich mich heimlich erfreue.
Außerdem liebe ich Schwulst. Seit Jahren bereits finde ich Gefallen daran, meine Sprache mit veralteten Ausdrücken und umständlichen Wendungen zu zieren, Sätze zu verlängern und immer neue Synonyme für bereits verwendete Wörter zu entdecken. Ich mag Anaphern und Epiphern, Alliterationen und Wiederholungen, Aufzählungen und Einschübe – selbst wenn das Textverständnis darunter leidet.
Wie kann es da verwundern, dass es mir nicht gelingt, mich kurz zu fassen, dass ich mich am klanglichen Konstrukt des Satzes erfreue, während Leser oder Zuhörer nur auf die Information warten, die am Ende meiner Ausführungen folgen wird? Wie kann es da verwundern, dass, selbst wenn ich mich bemühe, nur wenige Worte zu verwenden, am Ende doch wieder ein Text entsteht, dessen sich Länge weit jenseits des eigentlich Gedachten befindet?
Heute las ich eine Frage, die ich mir selbst zu beantworten versuchte: Wie ordnest du deine Bücher? Die gelesene Antwort war – erstaunlicherweise – "Nach Farben.". Die in meinem Kopf entstehende Antwort jedoch nahm schnell romanartige Formen an. Ich schüttelte schmunzelnd den Kopf und begann, sie aufzuschreiben.
morast - 28. Jun, 13:12
0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks