Mit uns.
Und plötzlich spricht ein bekannter Mund Worte, die seltsam und normal zugleich anmuten und mich fragen lassen, wie wirklich die Gedankenwelt ist, die ich täglich um mich baue.
"Sie hat ja jetzt einen Freund. Ich dachte immer, daß das mit euch was werden würde."
Mit uns.
Es gab Zeiten, da vermutete ich ähnlich, da sehnte ich mich danach, da interpretierte ich jede zufällige Berührung, jedes gesprochene Wort, jedes gefundene Lächeln in diese Richtung, in Richtung einer Hoffnung, deren Erfüllung, mir verwehrt wurde. Ich war nicht betrübt, nicht enttäuscht, deswegen, erwartete nahezu nichts anderes. Die Nähe, die ich erträumte, war illusorisch.
Ich interpretierte sie, die Nähe, als allgemeines Bedürfnis nach aktiv und passiv gelebter Liebe, hineinprojeziert in sie, die ein geeignetes Gefäß zu sein schien, akzeptierte ihre Ferne als Teil der Wirklichkeit, derer ich nicht Herr zu werden vermochte. Wenn ich des Nachts in die Behaglichkeit des Schlafes sank, sandte ich zuweilen einen angenehmen Gedanken in ihre Richtung, fast so, als könnte sie ihn ergreifen, in sich aufnehmen und verstehen, fast so, als wäre die Hoffnung berechtigt.
Doch das war sie nie. Ich bin, war und bleibe ein Wesen, das fremd zu sein scheint in dem Element, das ihn umgibt, das sich andere Plätze schafft, Gedanken, die über die Wirklichkeit hinausragen und mir aus weiter Ferne ein Lächeln herbeizaubern. Mein Dasein ist eine Flucht vor mir selbst und dem Heute, und jeder Schritt, den ich im Hier und Jetzt wage, erscheint mir falsch zu sein, ungute Richtungen einzuschlagen.
Sie dagegen hatte die Geradlinigkeit für sich gepachtet, wußte, was sie wollte, wußte, wie dies zu erreichen war, wußte sich nicht mit dem Bekommenen zufrieden zu geben, sondern stets Höheres, Größeres anzustreben, neuerliche Erfolge, die sie aufbauten, weiterbrachten und die Optimalbasis für potentielle Zukünfte schufen.
Wir paßten nicht zusammen. Zu oft redete ich an ihr vorbei. Sie mochte den Klang meiner Stimme, doch schien es mir, als wäre es egal, was deren Inhalt war, was zu berichten, zu bemängeln, zu bewundern ich wußte. Ich hätte ihr Geschichten erzählen können, und sie wäre mit seligem Lippenlächeln ins Land süßer Träume entschlummert. Doch das tat ich nicht.
Und auch sie redete, redete von Dingen, die ich zu oft für fragwürdig hielt, die ich mit kritischen Blicken beäugte wie ein fremdes Tier, dessen Fremdheit ausreichte, mich davon abhielt, es kennenlernen zu wollen. Ich besitze Fantasie, finde immer Gründe, etwas abzulehnen, wenn ich meine Unsicherheit verbergen, irgendeine Meinung äußern will, die ich an einem anderen Tag gekonnt zu widerlegen weiß.
Nicht alles, was sie erzählte, war in meinen Augen falsch oder ohne Belang. Zuweilen glühte ich auf, eiferte mit, fand die Worte, die aus ihrem Munde perlten und vereinigte mich mit ihnen. Ihre Augen leuchteten, und ein Weg schien gefunden zu sein.
Hin und wieder schloß ich meine Lider, um sie besser betrachten, sehen, zu können, um ihren schlanken Leib entlangzustreifen, sie heimlich in Gedanken zu berühren, ihre Haut zu liebkosen, als wäre sie leicht zerbrechlich, ihren warmen Duft einzuatmen, der mich an meine Sehnsucht erinnerte, an Worte, die ich nie sagen, Gesten, die ich nie wagen würde.
Unsere Nähe beängstigte mich. Fanden wir sie, so wollte ich sie nicht verlieren, doch verlor sie wenige Augenblicke darauf. Zuweilen verzehrte ich mich nach ihr, doch kam kein entsprechendes Wort über meine Lippen. Warum sollte ich sprechen, war doch das Mögliche fern, endlos fern. Sie würde nicht verstehen, ein freundliches Wort der Zurückweisung finden und mich meiner Träume berauben. Das wollte ich nicht, schwieg ein trauriges Lächeln in mich hinein.
Ich hatte Angst vor ihrer Nähe, Angst davor, in ihren Augen nur igendwer, einer von vielen zu sein, denen sie die gleiche Nähe zu schenken bereit war. Für mich bedeutete sie etwas; doch was bedeutete sie ihr? Ich wußte es nicht, konnte es nie in Erfahrung bringen, wollte nicht, aus Furcht, den zarten Glanz meiner Sehnsucht für ein zerspittertes Fragment geborstener Gedanken aufgeben zu müssen.
Was konnte schon passieren? Zuviel, das zu ertragen ich nicht bereit war.
Und ich wartete, wartete auf ein Zeichen, irgendetwas, das Gewißheit verkündete, mich einen Schritt aus meinem Versteck hervorwagen ließ. Doch ihre Nähe war flüchtig, kurz nur, wie ein warmer Sommerwind, der vorüberzieht, einen wohligen Geschmack auf der Haut hinerläßt, die Idee von etwas Größeren, das nie geschehen wird. Ihre Worte waren klar und stark, ließen die ersehnte Spur, das ersehnte Zeichen vermissen.
Ich fragte nicht, ließ irgendwann auch meine Träume sterben.
"Ich dachte immer, daß das mit euch was werden würde."
Wenn andere, Außenstehende, derart dachten, warum wurde es nichts? Lag es an mir? An ihr? An uns? Waren wir einander aus dem Weg gegangen, aus Angst, uns ineinader zu verlieren? War das Schweigen nur ein Warten auf das gegenseitige Zeichen gewesen? Ich weiß es nicht.
"Sie hat ja jetzt einen Freund. "
Ich beruhige mich. Es lohnt nicht, weitere Gedanken über verronnene Möglichkeiten auszugießen, lohnt nicht, das Gewesene zu hinterfragen, auf der Suche nach einer Spur, die genausogut meinem Geist entsprungen sein kann.
Es wäre nichts geworden, versuche ich mir einzureden, doch höre mir nicht zu. Warum auch? Sie ist fern und wird es bleiben. Ich dagegen verweile hier, als wäre ich tief verwurzelt in vergifteter Erde.
"Sie hat ja jetzt einen Freund. Ich dachte immer, daß das mit euch was werden würde."
Mit uns.
Es gab Zeiten, da vermutete ich ähnlich, da sehnte ich mich danach, da interpretierte ich jede zufällige Berührung, jedes gesprochene Wort, jedes gefundene Lächeln in diese Richtung, in Richtung einer Hoffnung, deren Erfüllung, mir verwehrt wurde. Ich war nicht betrübt, nicht enttäuscht, deswegen, erwartete nahezu nichts anderes. Die Nähe, die ich erträumte, war illusorisch.
Ich interpretierte sie, die Nähe, als allgemeines Bedürfnis nach aktiv und passiv gelebter Liebe, hineinprojeziert in sie, die ein geeignetes Gefäß zu sein schien, akzeptierte ihre Ferne als Teil der Wirklichkeit, derer ich nicht Herr zu werden vermochte. Wenn ich des Nachts in die Behaglichkeit des Schlafes sank, sandte ich zuweilen einen angenehmen Gedanken in ihre Richtung, fast so, als könnte sie ihn ergreifen, in sich aufnehmen und verstehen, fast so, als wäre die Hoffnung berechtigt.
Doch das war sie nie. Ich bin, war und bleibe ein Wesen, das fremd zu sein scheint in dem Element, das ihn umgibt, das sich andere Plätze schafft, Gedanken, die über die Wirklichkeit hinausragen und mir aus weiter Ferne ein Lächeln herbeizaubern. Mein Dasein ist eine Flucht vor mir selbst und dem Heute, und jeder Schritt, den ich im Hier und Jetzt wage, erscheint mir falsch zu sein, ungute Richtungen einzuschlagen.
Sie dagegen hatte die Geradlinigkeit für sich gepachtet, wußte, was sie wollte, wußte, wie dies zu erreichen war, wußte sich nicht mit dem Bekommenen zufrieden zu geben, sondern stets Höheres, Größeres anzustreben, neuerliche Erfolge, die sie aufbauten, weiterbrachten und die Optimalbasis für potentielle Zukünfte schufen.
Wir paßten nicht zusammen. Zu oft redete ich an ihr vorbei. Sie mochte den Klang meiner Stimme, doch schien es mir, als wäre es egal, was deren Inhalt war, was zu berichten, zu bemängeln, zu bewundern ich wußte. Ich hätte ihr Geschichten erzählen können, und sie wäre mit seligem Lippenlächeln ins Land süßer Träume entschlummert. Doch das tat ich nicht.
Und auch sie redete, redete von Dingen, die ich zu oft für fragwürdig hielt, die ich mit kritischen Blicken beäugte wie ein fremdes Tier, dessen Fremdheit ausreichte, mich davon abhielt, es kennenlernen zu wollen. Ich besitze Fantasie, finde immer Gründe, etwas abzulehnen, wenn ich meine Unsicherheit verbergen, irgendeine Meinung äußern will, die ich an einem anderen Tag gekonnt zu widerlegen weiß.
Nicht alles, was sie erzählte, war in meinen Augen falsch oder ohne Belang. Zuweilen glühte ich auf, eiferte mit, fand die Worte, die aus ihrem Munde perlten und vereinigte mich mit ihnen. Ihre Augen leuchteten, und ein Weg schien gefunden zu sein.
Hin und wieder schloß ich meine Lider, um sie besser betrachten, sehen, zu können, um ihren schlanken Leib entlangzustreifen, sie heimlich in Gedanken zu berühren, ihre Haut zu liebkosen, als wäre sie leicht zerbrechlich, ihren warmen Duft einzuatmen, der mich an meine Sehnsucht erinnerte, an Worte, die ich nie sagen, Gesten, die ich nie wagen würde.
Unsere Nähe beängstigte mich. Fanden wir sie, so wollte ich sie nicht verlieren, doch verlor sie wenige Augenblicke darauf. Zuweilen verzehrte ich mich nach ihr, doch kam kein entsprechendes Wort über meine Lippen. Warum sollte ich sprechen, war doch das Mögliche fern, endlos fern. Sie würde nicht verstehen, ein freundliches Wort der Zurückweisung finden und mich meiner Träume berauben. Das wollte ich nicht, schwieg ein trauriges Lächeln in mich hinein.
Ich hatte Angst vor ihrer Nähe, Angst davor, in ihren Augen nur igendwer, einer von vielen zu sein, denen sie die gleiche Nähe zu schenken bereit war. Für mich bedeutete sie etwas; doch was bedeutete sie ihr? Ich wußte es nicht, konnte es nie in Erfahrung bringen, wollte nicht, aus Furcht, den zarten Glanz meiner Sehnsucht für ein zerspittertes Fragment geborstener Gedanken aufgeben zu müssen.
Was konnte schon passieren? Zuviel, das zu ertragen ich nicht bereit war.
Und ich wartete, wartete auf ein Zeichen, irgendetwas, das Gewißheit verkündete, mich einen Schritt aus meinem Versteck hervorwagen ließ. Doch ihre Nähe war flüchtig, kurz nur, wie ein warmer Sommerwind, der vorüberzieht, einen wohligen Geschmack auf der Haut hinerläßt, die Idee von etwas Größeren, das nie geschehen wird. Ihre Worte waren klar und stark, ließen die ersehnte Spur, das ersehnte Zeichen vermissen.
Ich fragte nicht, ließ irgendwann auch meine Träume sterben.
"Ich dachte immer, daß das mit euch was werden würde."
Wenn andere, Außenstehende, derart dachten, warum wurde es nichts? Lag es an mir? An ihr? An uns? Waren wir einander aus dem Weg gegangen, aus Angst, uns ineinader zu verlieren? War das Schweigen nur ein Warten auf das gegenseitige Zeichen gewesen? Ich weiß es nicht.
"Sie hat ja jetzt einen Freund. "
Ich beruhige mich. Es lohnt nicht, weitere Gedanken über verronnene Möglichkeiten auszugießen, lohnt nicht, das Gewesene zu hinterfragen, auf der Suche nach einer Spur, die genausogut meinem Geist entsprungen sein kann.
Es wäre nichts geworden, versuche ich mir einzureden, doch höre mir nicht zu. Warum auch? Sie ist fern und wird es bleiben. Ich dagegen verweile hier, als wäre ich tief verwurzelt in vergifteter Erde.
morast - 28. Okt, 01:31 - Rubrik: Geistgedanken
0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks
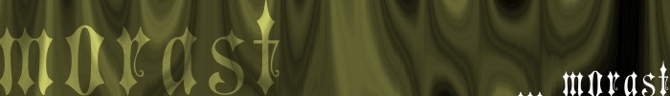



Trackback URL:
https://morast.twoday.net/stories/1098624/modTrackback