Ein letzter Blick
Als ich auf der fernen Insel Kreta verweilte und mich ein Anruf meines Bruders erreichte, erfuhr ich, daß unser Vater verstorben war. Mir blieben zwei Optionen: Ich konnte den Urlaub abbrechen und heimkehren, um das Antlitz meines Vaters ein letztes Mal betrachten zu können. Oder ich konnte bleiben, auf den letzten Blick verzichten und versuchen, meine Trauer über den Tod mit griechischer Sonne zu dämpfen.
Mein Vater sollte eingeäschert werden, und aus irgendeinem Grund war es dem Bestattungsunternehmen oder dem Krankenhaus nicht gestattet, seinen Leichnam [Es ist unglaublich, wie unpassend dieses Wort in Kombination mit dem Wort "Vater" klingt.] länger als eine Woche aufzubewahren. Mir blieb, als mein Bruder anrief, eine Frist von wenigen Tagen, um heimzukehren und zu schauen. Schließlich hatte mein Bruder eine Weile gezögert, ob ich überhaupt im Urlaub mit dieser schrecklichen Nachricht bedacht werden sollte.
Ich überlegte lange, erkundigte mich gar, wie einfach oder kompliziert es sein würde, alsbald nach Hause zu reisen, doch kam zu keiner Lösung. Mein Bruder und meine Mutter rieten mir von der Heimreise ab, weil der Anblick meines Vaters nach seinem Tod nicht erbaulich war, hatte doch intensive Krankheit zuvor die letzte Kraft geraubt und nicht viel von dem übrig gelassen, was mein vater gewesen war.
Mir wurde abgeraten, doch gleichzeitig befürchtete ich, später in Vorwürfen zu ertrinken, warum mir ein paar zusätzliche Strandtage wichtiger gewesen waren als ein letzter Gruß, ein letzter Blick.
Ich entschied mich zu bleiben. Es war keine Entscheidung im eigentlichen Sinne, denn selbst nach einem Gespräch mit meinem Freund, nach mehreren Telefonaten und vielen Tränen wußte ich nicht, was zu tun, was "richtig" war. Also wählte ich das Einfachste: ich beließ alles so, wie es war.
Es fiel mir nicht leicht, so zu handeln, kam ich mir doch wie ein Verräter an meinem Vater vor. Doch eigentlich handelte ich auch nicht. Hin- und hergerissen zwischen zweierlei Unliebsamen wählte ich die Stagnation. Wäre ich in eine Situation geraten, in der Nicht-Handeln eine vorzeitige Heimfahrt ausgelöst hätte, so hätte ich mich dieser Variante nicht erwehrt, sondern mit gleicher Unsicherheit die andere Möglichkeit akzeptiert.
Bis heute bin ich frei von Selbstvorwürfen. Die letzten Tage auf Kreta waren überschattet gewesen, doch bereiteten sie mich auch vor, auf das, was mich in Deutschland erwarten würde, brachten sie mir doch den Verlust, dessen Unbegreiflichkeit, mit schonender Langsamkeit nahe. Im Urlaub ist man schließlich stets von den anderen abgeschnitten, verzichtet weitestgehend auf Kontakt. Daß der Kontakt zu meinem vater ab sofort dauerhaft fehlen würde, begann ich zu ahnen. Doch es traf mich nicht so, als hätte ich zu Hause verweilt und den Tod aus nächster Nähe erleben müssen.
Mein Vater, das begriff ich schon auf Kreta, war nicht das Wesen, auf das mir ein letzter Blick gewährt worden war, nicht der von Krnakheit gezeichnete Leichnam, der irgendwo gekühlt auf Einäscherung wartete. Mein Vater war zu einem Bild in meinem Kopf geworden, das mit der sterblichen Hülle längst nichts mehr gemein hatte. Der letzte Blick war nicht vonnöten gewesen.
Ein letzter Gruß, ein letztes Wort, hätte ich gerne an ihn gerichtet. Doch war es bereits, als mein Bruder mich anrief, zu spät dafür. Denn nicht der Tote war es, dem diese Worte hätten gelten sollen, sondern der Lebende, mich Hörende, mich verstehende.
Erst heute begriff ich, daß die beiden mir damals zur Verfügung stehenden Optionen falsch waren, daß ich lieber die dritte, leider inexistente Variante gewählt hätte: Mit meinem Vater vor dessen Tod noch einmal reden, ihm meine Liebe, ein Lächeln mitgeben zu können.
Vielleicht ist das ein Wunsch, den jeder verspürt, der einen Nahestehenden verliert: Das Ungesagte sagen, bevor es zu spät ist.
Was mir bleibt, ist die Hoffnung, daß er ohnehin wußte, was ich ihm hätte sagen wollen, daß meine niemals gesprochenen Worte eigentlich überflüssig waren...
[Im Hintergrund: Muse - "Absolution"]
Mein Vater sollte eingeäschert werden, und aus irgendeinem Grund war es dem Bestattungsunternehmen oder dem Krankenhaus nicht gestattet, seinen Leichnam [Es ist unglaublich, wie unpassend dieses Wort in Kombination mit dem Wort "Vater" klingt.] länger als eine Woche aufzubewahren. Mir blieb, als mein Bruder anrief, eine Frist von wenigen Tagen, um heimzukehren und zu schauen. Schließlich hatte mein Bruder eine Weile gezögert, ob ich überhaupt im Urlaub mit dieser schrecklichen Nachricht bedacht werden sollte.
Ich überlegte lange, erkundigte mich gar, wie einfach oder kompliziert es sein würde, alsbald nach Hause zu reisen, doch kam zu keiner Lösung. Mein Bruder und meine Mutter rieten mir von der Heimreise ab, weil der Anblick meines Vaters nach seinem Tod nicht erbaulich war, hatte doch intensive Krankheit zuvor die letzte Kraft geraubt und nicht viel von dem übrig gelassen, was mein vater gewesen war.
Mir wurde abgeraten, doch gleichzeitig befürchtete ich, später in Vorwürfen zu ertrinken, warum mir ein paar zusätzliche Strandtage wichtiger gewesen waren als ein letzter Gruß, ein letzter Blick.
Ich entschied mich zu bleiben. Es war keine Entscheidung im eigentlichen Sinne, denn selbst nach einem Gespräch mit meinem Freund, nach mehreren Telefonaten und vielen Tränen wußte ich nicht, was zu tun, was "richtig" war. Also wählte ich das Einfachste: ich beließ alles so, wie es war.
Es fiel mir nicht leicht, so zu handeln, kam ich mir doch wie ein Verräter an meinem Vater vor. Doch eigentlich handelte ich auch nicht. Hin- und hergerissen zwischen zweierlei Unliebsamen wählte ich die Stagnation. Wäre ich in eine Situation geraten, in der Nicht-Handeln eine vorzeitige Heimfahrt ausgelöst hätte, so hätte ich mich dieser Variante nicht erwehrt, sondern mit gleicher Unsicherheit die andere Möglichkeit akzeptiert.
Bis heute bin ich frei von Selbstvorwürfen. Die letzten Tage auf Kreta waren überschattet gewesen, doch bereiteten sie mich auch vor, auf das, was mich in Deutschland erwarten würde, brachten sie mir doch den Verlust, dessen Unbegreiflichkeit, mit schonender Langsamkeit nahe. Im Urlaub ist man schließlich stets von den anderen abgeschnitten, verzichtet weitestgehend auf Kontakt. Daß der Kontakt zu meinem vater ab sofort dauerhaft fehlen würde, begann ich zu ahnen. Doch es traf mich nicht so, als hätte ich zu Hause verweilt und den Tod aus nächster Nähe erleben müssen.
Mein Vater, das begriff ich schon auf Kreta, war nicht das Wesen, auf das mir ein letzter Blick gewährt worden war, nicht der von Krnakheit gezeichnete Leichnam, der irgendwo gekühlt auf Einäscherung wartete. Mein Vater war zu einem Bild in meinem Kopf geworden, das mit der sterblichen Hülle längst nichts mehr gemein hatte. Der letzte Blick war nicht vonnöten gewesen.
Ein letzter Gruß, ein letztes Wort, hätte ich gerne an ihn gerichtet. Doch war es bereits, als mein Bruder mich anrief, zu spät dafür. Denn nicht der Tote war es, dem diese Worte hätten gelten sollen, sondern der Lebende, mich Hörende, mich verstehende.
Erst heute begriff ich, daß die beiden mir damals zur Verfügung stehenden Optionen falsch waren, daß ich lieber die dritte, leider inexistente Variante gewählt hätte: Mit meinem Vater vor dessen Tod noch einmal reden, ihm meine Liebe, ein Lächeln mitgeben zu können.
Vielleicht ist das ein Wunsch, den jeder verspürt, der einen Nahestehenden verliert: Das Ungesagte sagen, bevor es zu spät ist.
Was mir bleibt, ist die Hoffnung, daß er ohnehin wußte, was ich ihm hätte sagen wollen, daß meine niemals gesprochenen Worte eigentlich überflüssig waren...
[Im Hintergrund: Muse - "Absolution"]
morast - 15. Mai, 11:46 - Rubrik: Wortwelten
0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks
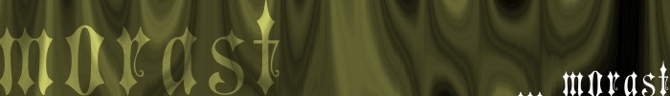



Trackback URL:
https://morast.twoday.net/stories/2006410/modTrackback