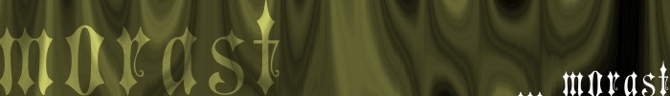Wortwelten
Ich betrat den Wald. Hinter grauen Wolken stahl sich heimlich die Sonne ihrem Untergang entgegen und sandte kühlen Niesel auf bereits schlammige Pfade. Der Schnee des gestrigen Tages versteckte scheu in wenigen Mulden zwischen dunklen kahlen Stämmen. Oben im Geäst entdeckte ich noch letzte Blätter, welke Grüße des vergangenen Sommers, die sich tapfer an kleinste Zweige krallten.
Unten hingegen lief ich, in schwarze Wolle gehüllt, kapuziert, von Stöpselmusik ertaubt, die Hände tief im Mantel vergraben - und atmete. Es roch nach Wald, nach feuchtem Laub, nach Pilzen vielleicht. Meine Schritte waren lang und ohne Ziel. Ich brauchte keines, wollte nichts finden, keinen Ort, nicht mich, wollte nur Meter für Meter nach vorne treiben, den sich allmählich verfinsternden Forst durchschreitend, meinen Gedanken freien Lauf lassend.
Ein alter Mann kam mir entgegen, in seiner Hand einen Golfschläger tragend. Ich schmunzelte, ging meines Weges.
Der Regen nahm zu, schickte auch die letzten verlorenen Fußgänger ins wärmende Heim, doch ich setzte meinen Ausflug fort, hinein ins Ungewisse, hinein in die wachsende Dunkelheit des Waldes. Meine Schritte wuchsen, als wüssten sie, wohin sie mich trugen, und erstmals öffnete ich mich. Ich formte Laute passend zum wuchtigen Klang in meinem Ohren, ließ meine Hände ihr Versteck verlassen, meine Arme sich ausbreiten, als wollte ich Wald und Welt in einer Umarmung bergen. Irgendwo in der Kapuze formte sich ein Lächeln, wanderte seines Weges zwischen schlafenden Bäumen hindurch.
Vom Himmel, aus hüllendem Gewölk heraus, grüßte mich der Mond, spiegelte sich einen Moment lang in den von Tropfen aufgewühlten Pfützen, und noch immer hielt ich nicht inne, kehrte nicht zurück. Nadelbäume formten erste Menschensilhouetten, doch störten nicht den steten Takt meiner Stiefel, hielten mich nicht auf.
Irgendwo inmitten der Sträucher keimte mein Pfad, harrte meines Nahens, von wucherndem Dunkel verborgen. Dies ist mein Ziel, dachte ich und ging voran.
morast - 6. Jan, 18:12 - Rubrik:
Wortwelten
„Und? Bleibt er liegen?“, fragt Mutter am Telefon, und fast bin ich geneigt, „Ja.“ zu antworten. Doch ich zögere.
An meinem Bürofenster stürmt der Schnee vorbei, unzählige Flocken jagen einander, finden einander, befüllen die längst gilbe, von Herbstkrähen auf Nahrungssuche zerhackte Rasenfläche mit einem Weiß, das mein Lächeln weckt. Und es hört nicht auf. Stundenlang schneit es, als müsste es jede Erinnerung an Frühling und Sommer unter einer Schicht verformten Wassers verdecken.
„Hier hat es auch geschneit.“, berichtet Mutter, 500 Kilometer entfernt. Doch der Schnee blieb nicht lange, paarte sich mit Regen, malte grimmige Gesichter auf Weihnachtsgeschenke suchende Passanten und verschwand.
Doch hier, vor meinem Fenster, schneit es. Ununterbrochen. Die Schneckdecke auf dem ehemaligen Rasen, auf dem Dach des sechsten Stockwerkes, wächst und gedeiht, und kein Schritt wagt es, ihre Jungfräulichkeit zu schänden.
„Bleibt er liegen?“, fragt Mutter, und „Ja.“ liegt auf meiner Zunge. Ja, hier bleibt er, lässt mich bei jedem Blick grinsen, mein inneres Kind vor Freude hüpfen. Ja, hier bleibt er, der Schnee, der mich plötzlich inspiriert, zu Gedichten, Fotos, Gemälden drängt. Ja, hier bleibt er.
„Nein.“, antworte ich schließlich. Auf den Straßen bleibt nichts. Auf den Wegen bleibt nichts. Zu warm ist es noch, als dass anderes als Schneematsch entstehen kann, der schließlich auch verschwinden wird.
„Nein.“, antworte ich. „Er bleibt nicht liegen.“ Selbst wenn er könnte, ergänze ich im Geiste. Schließlich schneit es hier im Schwabenländle, wo Kehrwoche oberste Bürgerpflicht ist, und jede Schneeflocke, noch bevor sie den Boden erreicht, zusammen mit einem letzten verirrten Herbstlaubblatt vom Weg entfernt wird.
Als ich nach Hause laufe, ist vom stundenlangen Schneefall kaum noch etwas übrig. Nur auf den Wiesen liegt etwas Weiß und hofft darauf, noch ein wenig liegen bleiben zu dürfen.
morast - 21. Dez, 15:50 - Rubrik:
Wortwelten
"Tja.", sagte ich und lächelte. Du schautest ungläubig, mit großen Augen, so wie du es immer tatest, wenn ich dir etwas erzählte, von dem du wusstest, dass es nicht wahr sein konnte. Doch diesmal war alles wahr. Jedes einzelne Wort.
Wenn ich dir lange genug in die Augen blickte, glaubte ich einen Funken der Erkenntnis in ihnen zu erkennen, eine Ahnung, die dich im letzten Augenblick noch zu berühren vermocht hatte. Vielleicht war der Funken aber auch nur der des Schalks, das Kichern, das sich sonst bei jedem noch so ernsten Wort in deinen Blicken versteckte, als wüsstest du mehr als alle anderen.
Die Zeit stand still.
Das hätte ein romantischer Augenblick sein können, ein Augenblick, wie er in zahlreichen Romanen und Filmen bereits tausendfach zelebriert wurde, ein Innehalten des Sekundenzeigers just in dem Moment, als sich unsere Blicke trafen. Doch das war es nicht. Die Zeit erstarrte, ich blickte mich um, lächelte und schaute dir ins Gesicht, sah die Augen. So einfach war das.
Die Welt war wie gefroren, bewegte sich nicht, weigerte sich, ihrem weiteren Lauf zu folgen.
Du hattest mir nicht geglaubt, dachte ich, doch nun hatte ich es dir bewiesen. Beziehungsweise mir bewiesen, denn dich hatte das Begreifen noch nicht erreichen können. Dazu fehlte ihm, euch, die Zeit.
Ich legte den Hammer weg und betrachtete die kläglichen Reste von dem, was einst eine Armbanduhr gewesen war. Eine Kinderarmbanduhr, um genau zu sein. Eine Kinderarmbanduhr, auf der Goofy mit langen, tollpatschigen Zeigerarmen verkündete, wie spät es gerade war.
"Die Uhr ist hässlich.", hattest du gesagt, und ich hatte sie nicht widersprochen.
"Die Uhr ist hässlich und albern.", hattest du gesagt. "Leg sie weg."
"Ich muss sie beschützen.", hatte ich gemeint, doch du hattest mit dem Kopf geschüttelt.
"Du bist erwachsen. Leg sie weg.". Deine Stimme war hart geworden, doch in deinen Blicken hatte ich noch immer den Funken entdecken können, den ich so liebte.
"Wenn die Uhr stehenbleibt, bleibt die Zeit stehen.", sagte ich, und bemühte mich, nicht allzu salbungsvoll zu klingen.
"Was?"
"Wenn die Uhr stehenbleibt, bleibt die Zeit stehen.", wiederholte ich.
"Quatsch." hattest du gesagt, und es war geschehen, was geschehen war.
Die Zeit stand still. gerne hätte ich gewusst, wie lange ich nun schon hier saß und den Stillstand der Zeit, den Stillstand aller Dinge, betrachtete, doch es gab keine Minuten mehr, keine Sekunden, keine Tage. Nur Starre, eine zertrümmerte Uhr und mich.
Ich küsste dir auf die Stirn. Deine weiche Haut war kühler Fels.
Ich warf einen letzten Blick auf die Uhr. Vielleicht war es keine allzu gute Idee gewesen, sie zu zerstören, dachte ich, und mein Lächeln welkte dahin. Vielleicht, überlegte ich weiter, gibt es aber eine weitere Uhr, eine, die nur darauf wartet, von mir gefunden zu werden, eine Uhr, die den Stillstand der Sekunden beendet und dem Dasein wieder Leben einhaucht.
Vielleicht, dachte ich, vielleicht.
Sie zu finden, wird nicht einfach, dachte ich, und spürte, wie das Lächeln meine Lippen wiederfand:
"Zumindest habe ich Zeit."
morast - 16. Feb, 17:52 - Rubrik:
Wortwelten
Es war Donnerstag Mittag, als es geschah. Genauer gesagt war es früher Donnerstag Nachmittag. Die Sonne hatte sich einen guten Platz zwischen den umherquirlenden Wolken erkämpft und blickte nun frohgemut auf das Erdentreiben herab, dorthin, wo Mittagsschläfchen ihr Ende nahmen, erste Schulkinder nach Hause gingen und der Würstchenverkäufer am Emilienplatz ein verdientes Nickerchen auf einer der von der Stadtsparkasse gestifteten Holzbänke hielt.
Doch nicht wann es geschah, war bedeutsam. Eigentlich spielte es noch nicht einmal eine Rolle, was überhaupt geschah. Wichtiger war, dass etwas geschah. Dass irgendetwas geschah.
Herr Konradi wohnte in der Sibyllenstraße 8, dem letzten Eingang am Ende einer Sackgasse, die, selbst wenn ihre Zufahrt nicht von unzureichend gepflegten Schneebeerenbüschen allmählich vollständig verdeckt zu werden drohte, durchaus leicht zu übersehen war. Herr Konradi empfing nicht oft Besuch, doch wenn er besucht wurde, dann von niemandem, der nicht unterwegs zwei oder drei Mal nachfragte, wo sich sein Hauseingang denn eigentlich befand. Der Nachfragerekord lag bei sieben, erinnerte sich Herr Konradi manchmal schmunzelnd.
Die Sibyllenstraße 8 war nicht lang, einhundertfünfzig Meter nur, bestand aus Kopfsteinpflaster, das zwar bereits aus den 60er Jahren stammte, aber erstaunlich unbenutzt aussah, und endete in einer monströsen rostroten Backsteinmauer. Die Mauer gehörte zum nebenan gelegenen Einkaufszentrum, dessen Besitzer es anscheinend guthieß, den Parkplatzbereich festungsartig mit Steinwerk zu umkränzen, so dass Herr Konradi, wenn er aus seinem Küchenfenster im Erdgeschoss hinaus nach rechts blickte, nichts weiter als die langweilige Schlichtheit sauber aufeinandergearbeiteter Backsteine zu sehen bekam, in deren Zwischenräume sich bis heute kein Pflänzchen vorgewagt hatte. Der Backstein war tot, hatte Herr Konradi schon viel zu oft festgestellt und dann geseufzt.
Überhaupt seufzte Herr Konradi viel. Wenn er aus dem Küchenfenster auf die Sibyllenstraße schaute, fanden seine Augen nichts, das er mit Interesse verfolgen konnte. Sechsundzwanzig Autos parkten in der Sibyllenstraße, davon besaßen erstaunlich viele einen blauen oder bläulichen Farbton. Neun Stück nämlich, zehn, wenn man den türkisfarbenen Volkswagen mitzählte, bei dem sich Herr Konradi allerdings nicht sicher war, ob er noch als Auto bezeichnet werden durfte, weil er sich seit mindestens viereinhalb Jahren nicht bewegt hatte.
Von den sechsundzwanzig Autos gefielen Herrn Konradi dreiundzwanzig. Der Volkswagen gehörte dazu. Gestern hatten hier noch neunundzwanzig Fahrzeuge gestanden, und Herr Konradi war sich sicher, dass eines der Differenzautos ein silbergrauer Fiat Punto mit Berliner Kennzeichen gewesen war. B-MK 175, um genau zu sein. Vielleicht aber auch B-MK 173. Bei MK war sich Herr Konradi ziemlich sicher, hatte er doch seine Initialen wiedererkannt.
Herr Konradi hatte die Autos in der Sibyllenstraße heute schon mehrere Male gezählt. Tatsächlich hatte er nicht nur die Autos gezählt, sondern auch die Male, wie oft er die Autos gezählt hatte. Als er die sechsundzwanzig Autos zum sechsundzwanzigsten Mal gezählt hatte, hatte er ein wenig geschmunzelt.
Ansonsten war nichts geschehen. Herr Konradi hatte aus dem Küchenfenster geschaut und absolut nichts beobachten können. Irgendein Nachbarsjunge hatte neulich ein Kaugummipapier vor dem Eingang der Sibyllenstraße 7 - das war der Eingang gegenüber - liegen lassen, dessen rote Farbe Herrn Konradis Blicke seit zwei Tagen immer wieder wie magisch anzog. Der nahende Herbst hatte ein paar Blätter von den Büschen am Straßenanfang hereingefegt, und Herr Konradi hatte ihre Anzahl auf vierzig geschätzt. Hinter der großen steinernen Mauer hatten vermutlich Fahrzeuge ein- und ausgeparkt, doch hatte Herr Konradi davon weder etwas gesehen noch etwas gehört. Er hätte sich vorstellen müssen, dass dort Menschen ein- und ausstiegen, Einkäufe erledigten, Kofferäume beluden und Radiosender wechselten, doch war dessen schon vor Jahren überdrüssig geworden.
Mehr war nicht geschehen.
Die Mauer bestand aus einer Menge Backsteinen, deren genaue Anzahl sich Herr Konradi immer geweigert hatte zu bestimmen. "Sollte ich einmal anfangen, die Steine in der Mauer zu zählen, kaufe ich mir einen Fernseher oder lasse mich einweisen.", hatte er einmal zu einem Besucher gesagt und schmunzelnd ergänzt: "Was vermutlich das Gleiche ist."
Kurz nach 10 Uhr hatte Herr Konradi geglaubt, dass sich die Gardine in der ersten Etage von Nummer 17 bewegt hatte, doch Frau Ampferberg, die dort mehr als zwanzig Jahre lang gewohnt hatte, war bereits im Frühjahr verstorben, und bisher hatte sich noch niemand gefunden, der die Wohnung beziehen und die alte vergilbte Gardine durch eine modernere, neuere austauschen wollte.
Viele Wohnungen in der Sibyllenstraße standen leer, und Herr Konradi vermochte nicht zu erklären, woran es lag. Die Sibyllenstraße war idyllisch, fast verwahrlost und einsam, doch der Emilienplatz war nicht weit, und dort bekam man alles, was man so für den täglichen Bedarf brauchte. Sogar Würstchen, dachte Herr Konradi und schmunzelte mal wieder.
Schmunzeln und seufzen - das ist alles, was ich tue, dachte er und seufzte.
Vor dem Küchenfenster geschah nichts.
Vor einer Woche hatte Herr Konradi ein Eichhörnchen gesehen. Kein rotes, ein graues, ein importiertes. Niedlich war es gewesen, erinnerte sich Herr Konradi, und auch daran, dass es über die Mauer geklettert war, bevor Herr Konradi Gelegenheit bekommen hatte, seine Brille aus dem Wohnzimmer zu holen und es genauer zu betrachten.
Gegen Mittag hatte der Wind ein wenig aufgefrischt, und Herr Konradi hatte kurz überlegt, ob er das Schlafzimmerfenster schließen sollte. Nicht, weil ihm kalt gewesen war. Nein, der Sommer war noch nicht ganz verschwunden, und an Winter war noch nicht zu denken. Doch die Schlafzimmertür neigte dazu, bei Durchzug zuzuschlagen, und womöglich könnte dadurch der Türrahmen in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich will den Türrahmen nicht ersetzen müssen, wenn ich hier einmal ausziehe, hatte Herr Konradi gedacht und seufzend das Schlafzimmerfenster geschlossen. Dann war er in die Küche zurückgekehrt und hatte aus dem Fenster geschaut.
Viel war nicht geschehen. Eigentlich gar nichts, wenn man es genau betrachtete.
Sechsundzwanzig Autos. Ein rotes Kaugummipapier. Ein paar Blätter. Und eine Mauer. Mehr nicht.
Vom Emilienplatz drang ein Geräusch herüber, doch bevor Herr Konradi es erkennen konnte, war es verklungen. Vielleicht ein Kind, vermutete Herr Konradi. Oder eine Katze.
Herr Konradi hatte bereits mehrere Male überlegt, ob er sich nicht eine Katze anschaffen sollte. Keine Rassekatze. Eine gewöhnliche, vielleicht mit graugeschecktem Fell und grünen Augen. Doch eigentlich war die Farbe des Fells egal. Und die der Augen erst recht. Eine Katze könnte draußen auf der Straße herumtollen, und ich könnte sie beobachten, hatte Herr Konradi schon häufiger gedacht, doch seine Überlegungen nie zu Taten werden lassen.
Vor ein paar Jahren hatte Frau Ampferberg von ihrer Katze erzählt. Nur kurz, und als Herr Konradi gesehen hatte, dass ihr die Tränen in den Augen standen, hatte er rasch das Thema gewechselt. Frau Ampferbergs Katze hatte Konrad geheißen, erinnerte sich Herr Konradi nun und schmunzelte. Ein schöner Name für eine Katze. Für einen Kater, um genau zu sein. Er war überfahren worden. Hier in der Sibyllenstraße. Konrad der Kater. Herr Konradi konnte es bis heute nicht glauben.
Also keine Katze, beschloss Herr Konradi zum wiederholten Male und schaute weiter aus dem Küchenfenster. Keine Katze, die die Straße bespielte. Keine Katze, die hin und wieder miaute und die Stille vertrieb. Keine Katze. Herr Konradi seufzte.
Die Mauer, das hatte Herr Konradi festgestellt, war etwa siebeneinhalb Meter hoch. Vielleicht auch 7 Meter 80. Und nirgendwo auf ihr wuchs Efeu. Oder Moos. Sie bestand aus einer Menge Backsteine.
Der Nachmittag brach an, die Sonne suchte sich zwischen den umherquirlenden Wolken einen guten Platz und blickte frohgemut auf das Erdentreiben herab. Herr Konradi stellte sich vor, wie Mittagsschläfer sich von ihren durchgelegenen Couchen erhoben, wie erste Schulkinder ohne Eile nach Hause gingen und wie der Würstchenverkäufer am Emilienplatz sein verdientes Nickerchen hielt.
Und dann geschah es.
Inmitten der Sibyllenstraße.
Zerbrach die Stille. Zerschmetterte die Reglosigkeit. Zerfetzte die träge Unbewegtheit.
Etwas geschah.
Plötzlich liefen Menschen umher, wunderten sich, Geräusche tönten aus Mündern und Maschinen, die Sibyllenstraße wurde für einen Augenblick zum Fokus des Geschehens.
Dann war es vorbei, und die altbekannte Ruhe kroch in ihre Heimat zurück. Herr Konradi saß im Wohnzimmer und blätterte in einer Broschüre über Fernseher. Er hatte nichts bemerkt.
morast - 28. Jan, 07:04 - Rubrik:
Wortwelten
Und dann begann ich zu atmen. 'Das kann nicht sein!', versuchte ich zu denken, doch das Denken hatte mich noch nicht entdeckt. In mir brodelte das Grau, unbewegter Stein, sich jenem Irrsinn nähernd, der das Leben war. Ich begann zu atmen, eine winzige Wolke mit Kohlenstoffdioxid angereicherte Luft verließ jene Stelle meiner starren Gestalt, die plötzlich zum Mund geworden war. Und nicht nur das: Der steinerne Stillstand in mir war nicht länger. Mahlenden Mühlen gleich rumorte mein Inneres, knirschte sich in neue Formen, in fremde Funktionen, die plötzlich Nutzen besaßen, derer ich von einem Augenblick auf den nächsten bedurfte. Mein Mund sog Luft in meinen Leib, ein erstes Mal in einer schier endlosen Kette erster Male, die mich Willkommen hießen. Und dann fand mich das Denken, das Bewusstsein, das Mir-meiner-selbst-bewusst-Sein. Ein Gefühl von Wärme durchfuhr mich, und seine Schönheit suchte vergeblich in mir nach Tränen, die vergossen werden konnten. Hinein und hinaus glitt der Atem, als hätte er nur auf mich gewartet, in Stille meiner Erweckung geharrt.
Ich war ein Stein, wusste ich nun, und doch war ich längst mehr, war mit Leben überschwemmt, mit brennendem Gleißen befüllt worden, auf dass ich atmete, dachte, war. Ein Lachen suchte seinen Weg nach draußen, modellierte meinen Mund zu unbekannter Silhouette und sprang dann ins Freie - ein erstes Geräusch, das an mich drang, das alle anderen Geräusche gebar, die mich umgaben. Das nahe Meer toste rauschend und erzählte wilde Geschichten von Ewigkeit und Stärke. Irgendwo vernahm ich fremde Stimmen, die allmählich an Kraft gewannen, als würden sie sich nähern. Und ja, sie näherten sich, denn nun spürte ich das sanfte Beben des Bodens, lustvoll fast, unter ihren Schritten. Ein allererster Wunsch drängte sich in mein frisch geschlüpftes Sein: Ich möchte sehen können.
Noch immer Stein, noch immer graues Nichts aus Stillstand - so lag ich im Sand, umgeben von Steinen, von meinesgleichen, in Größen und Farben so verschieden, dass mein Lächeln mich fast zerriss. Ich sah sie, sah sie plötzlich, sie alle, meine Brüder, meine Freunde, rief ihnen Worte zu, Worte, die ich im selben Moment ersann und in den Himmel warf, Worte, die Laute waren, erste Klänge, die mir, meinem Werden, entströmten und in jene Welt glitten, die in ihrem Facettenreichtum, ihrer Pracht, so neu, so unbekannt, so überwältigend war.
Am fernen Himmel sah ich Möwen schweben, sah ich plötzlich Wolken in die Ferne fliehen, und die Ahnung von Zeit legte sich auf meine Sinne. Sie, die ich vorher nie gekannt, nie gekostet hatte, war, was das Leben vorantrieb, es zu neuer Blüte, neuen Wegen peitschte, es küsste und löschte zugleich. Ich genoss sie, genoss jedes Funkeln eines Momentes, dessen ich habhaft werden konnte, ließ mich in meine Sinne gebären, mich treiben durch ein Jetzt der Fülle.
Die Stimmen fanden mich, ließen sich neben mir nieder. Nie hatte ich Kreaturen wie diese auch nur wahrnehmen können, doch nun, ihrer gewahr geworden, fesselte mich mein Erstaunen, ließ mich ihre Nähe in begeisterter Faszination erstarren, als wäre ich noch immer der Stein, der ich war, als wäre ich nicht vor wenigen Augenblicken ins Sein gerissen worden. So lag ich da, noch immer hartes Graugebilde, doch nun Wesen, Lebewesen, und lauschte den Klängen, die jene Kreaturen ausstießen.
Silben rankten an mein Ohr, und obgleich ihnen jeder Sinn fehlte, spürte ich doch die Wärme, die jene Geschöpfe aus ihrem Leib hinaus in den Atem pressten und zu Wörtern werden ließen. Sie waren zu zweit, und das kleinere von ihnen bündelte seine Laute zu Geräuschen, die mir bekannt zu sein schienen, die mich berührten, obgleich sie nicht mir gelten konnten. 'Lachen!', begriff ich, und das Wiedererkennen sandte eine süße Woge der Freude durch meinen erwachenden Körper.
Und kaum hatte sich das Lachen des Fremden offenbart, fand auch das Verständnis mein Denken. Silben verbanden sich zu Sätzen und erblühten in mir zu unfassbarer Herrlichkeit. Wer wusste denn, wie viele Äonen lang bereits Kostbarkeiten dieser Art an meinem kalten Graurumpf zerborsten waren, wie viele Sentenzen einst an mir vorüberwallten, ohne jemals von mir wahrgenommen zu werden? Trauer fraß mich, und mit ihr, wie ein enger Freund: unbändige Freude. Ich war am Leben, dachte ich, und mein Mund verzog sich sanft zu scheuem Lächeln. Ich war Leben!
Das lachende Geschöpf stakte unbeholfen zwischen meinen schweigenden Brüdern herum, berührte sie zuweilen, von Neugierde getrieben, und entdeckte im nächsten Augenblick einen anderen Gegenstand, der sein wild flackerndes Interesse einzufangen vermochte. Seine oberen Gliedmaßen wucherten zärtlich von einem Stein zum nächsten, Schritte trugen seinen langen Leib sicher voran. Das Meer rauschte prachtvoll und mischte sich mit seinem Gelächter zu einer unbändigen Serenade auf mein Sein.
Seine Finger, liebkosenden Fühlern gleich, fanden mich, streiften mich kurz, bevor sie wieder entschwanden, um dann, mit unerwarteter Zielstrebigkeit, zu mir zurückzukehren, meinen grauen, neu geborenenen Leib zu umfassen und in die Luft zu heben, hinauf, näher an den Himmel, wo die Sonne zwischen flüchtenden Wolken dem Meer ihr gleißendes Spiegelbild schenkte.
"Mami, der ist ganz warm!", rief lachende Geschöpf und trug mich, als wäre ich nur Stein, den Strand entlang zur zweiten Stimme. Ein Pulsschlag dröhnte warm in mir, und ich vermochte nicht zu fühlen, ob er in meinem Leib wogte oder durch die schlanken Gliedmaßen des Trägers zu mir hinübersprang. Ich bedachte meine einstige Heimat mit stillem Gruß, während das tragende, lachende Geschöpf immer wieder seine Fühler über meinen einst so starren Leib gleiten ließ.
Dann gab er mich frei.
Überraschend schnell und grazil setzte er mich in Bewegung, verlieh mir Geschwindigkeiten, an die zu denken ich noch nicht einmal gewagt hatte, und warf mich hinaus auf das Meer. Ich flog, und nie hatte ich Schöneres erfahren, nie gehofft, einem solchen Zauber beiwohnen zu dürfen. Ich flog, und Sonnenstrahlen küssten mich herzlich, als gelte es nun, Lebewohl zu sagen.
Dann sank ich, schnell, schneller, nach unten, hinab, wo das ewige Meer mich stürmend ersehnte. Und auch ich sehnte, verzehrte mich nach der Umarmung mächtiger Wogen, nach hüllendem Nass, das so anders, so neu, so gewaltig war, das mir nun entgegenfiel, als wäre es meine Bestimmung.
Mir entsprang ein Lachen, und dann war es geschehen: Ich war Teil, war Meer und Welle, war Stille und Sturm. Der Atem versagte, und die Tiefe sandte mir ein lockendes Raunen empor. "Warte!", wollte ich rufen, doch die Worte verweigerten sich mir. 'Welch Pracht! Welch Wonne!', wollte ich denken, doch die Gedanken schwiegen. Der Blick ertaubte, meine Sinne schwanden, Starre bemächtigte sich meiner.
Felsiger Boden empfing mich, mit ihm meine Brüder. "Willkommen.", schienen sie zu rufen, und mein Lächeln fand die Ewigkeit.
morast - 19. Jan, 07:00 - Rubrik:
Wortwelten
Noch immer wuselte das watteblubsige Kichergnarf vor sich hin, als gäbe es nur plüschiges Fluffgewöll und selige Schmampfolifen. Sämigsüß quellte sich laufender Rümpft von wipfelwarmen Wunschberillen, knospte quill zu weißgebelfter Mimme und hüllte das lurfende Gnarf in zauberflüstrig-tanzumschmelzten Sternenschnee. "Ach, könnte ich...", liebflockte es mit Schmunzelglanz auf Lipp- und Augenblitsch und sprang, als hätte es drafalkig blausend allen Trünkelglimm verschlungen, davon ins ferngewebte Nunkelflist.
Ich blickte ihm hinterher und mein Lächeln war mehr als nur Gleißen.
morast - 5. Dez, 15:09 - Rubrik:
Wortwelten
"Ach ja.", sagte ich und warf die Kippe fort. Ich rauchte nicht, doch hin und wieder gab ich dem Verlangen nach, mir eine Schachtel zu kaufen und die einzelnen Zigaretten Stück für Stück zu entsorgen. In die dafür vogeschriebenen Behältnisse, natürlich.
"Ach ja.", sagte ich erneut, und es war mehr ein Seufzen als eine tatsächliche Aneinanderreihung von Wörtern.
"Wer 'Ach ja.' sagt, weiß nicht weiter. Hat meine Großmutter immer gesagt.", meinte Karl und fischte meine Kippe aus dem Mülleimer. Er rauchte nicht, doch gab hin und wieder dem Verlangen nach, meine weggeworfenen Zigaretten aufzubrechen und ihren krümeligen Inhalt dem Wind darzubieten.
Einst hatte ich ihn gefragt, was das denn bringe, und er hatte nur mit den Schultern gezuckt und gelächelt. Als sei das Antwort genug. Und irgendwie war es das auch.
"So.", sagte ich.
"So?", fragte Karl und zog die Augenbraue hoch. Er besaß nur eine, dafür umrankte sie nicht nur seine Sehorgane, sondern auch Teile von Stirn und Nase.
"So!", meinte ich. "Es muss heißen: Wer 'so' sagt, weiß nicht weiter."
"Kann sein.", sagte Karl und zuckte mit den Schultern. Das tat er oft. Eigentlich immer, wenn er nicht gerade Zigaretten bearbeitete oder die Augenbraue hochzog. "Aber mein Großvater hat immer 'Ach ja.' gesagt."
"Wieso Großvater? Eben war es doch noch deine Großmutter!"
"Kann sein.", Karl zuckte erneut mit den Schultern. "Ich habe die beiden immer verwechselt."
"Verwechselt? Wie kann man denn seine Großeltern verwechseln?", empörte ich mich. "Wahrscheinlich verwechselst du auch deine Eltern?!?"
"Kann sein." Diesmal zuckte Karl nicht mit den Schultern. Statt dessen entfernte er behutsam den Filter von meiner weggeworfenen Zigarette. Tabak krümelte in seine offene Hand. "Ich habe meine Eltern nie kennengelernt."
"Oh. Das wusste ich nicht."
"Nein.", sagte Karl.
Mehr nicht.
Eine leichte Brise zog auf und klaubte ein wenig freigelassenen Tabak von seiner Hand und nahm ihn mit.
Wir schwiegen. Sahen den Krümeln zu, wie sich sich ihres papiernen Gefängnisses erwehrten und in die Ferne zogen, getragen von nichts als bewegter Luft.
"Sie sind bereits zweieinhalb Jahre vor meiner Geburt gestorben.", sagte Karl irgendwann, und ich nickte.
morast - 16. Nov, 14:35 - Rubrik:
Wortwelten
Peter und Felix waren den Elefanten bereits dreieinhalb Tage gefolgt. Es war ihrer erste Safari, und keiner der beiden wusste, was zu tun war, wenn sie wirklichen Gefahren ausgesetzt waren. Doch bisher war alles gut gegangen. Sie hatten sich ruhig verhalten, in Büschen gesessen und die Elefantenherde beobachtet, als gäbe es in ihrer Mitte einen Schatz zu entdecken.
"Regenbogenelefanten.", hatte der Einheimische in überraschend verständlichem Deutsch ihnen erklärt. "Das sind Regenbogenelefanten." Dann war er, mit einem wissenden Grinsen auf den Lippen verschwunden, irgendwo in der Menschenmenge eines Basars, aus dem ihn weder Rufe noch Verfolgungsversuche zurückzuholen vermochten.
"Regenbogenelefanten.", murmelte Peter nun und schüttelte den Kopf. Er hatte von ihnen gehört. Eine alte Geschichte. Eine Legende.
Regenbogenelefanten waren von herkömmlichen afrikanischen Elefanten nicht zu unterscheiden. Zumindest nicht für Uneingeweihte. Es sei denn, sie gebaren Kinder. Regenbogenelefantenkinder waren bunt, schillerten nach ihrer Geburt in den verrücktesten Farben und glichen sich erst nach und nach, innerhalb mehrerer Wochen, an das eintönige Grau der Älteren an. Regenbogenelefantenbabys waren, wollte man den Legenden glauben, das Schönste, was Mutter Natur hervorgebracht hatte, und wer eines erblickte, würde Zeit seines Lebens nie wieder unglücklich sein.
"Regenbogenelefanten.", seufzte Felix und strich sich einen Ast aus dem Gesicht. Zum dritten Mal, doch war es egal. Ihm war langweilig.
Seit Mittag hatte sich die Herde nicht mehr weiterbewegt. Die hochschwangere Elefantenmutter stand in ihrer Mitte und wurde von riesigen Leibern vor allem Äußeren geschützt. Es würde jeden Augenblick so weit sein, sagten sich Peter und Felix bereits seit Stunden.
Plötzlich: ein Geräusch. Peter sprang auf, zückte sein Fernglas. "Es geht los!", raunte er Felix zu.
Tatsächlich. In der Herde war Unruhe entstanden. Viel war nicht zu sehen, doch die Bewegungen waren hektischer, nervöser, als noch Sekunden zuvor.
Felix nickte. Nun ging es los.
Sie hielten Wache. Wechselten sich ab. Immer einer starrte durch das Fernglas, beobachtete die Elefantendame. Der andere schlief, besorgte Nahrung. Hielt Ausschau nach Gefahren. Nach anderen.
Die Nacht war erfüllt von den merkwürdigsten Geräuschen. Die Elefantendame stöhnte. Das Kalb in ihr wollte heraus.
Peter schüttelte müde den Kopf. Es war noch nicht soweit.
In der zweiten Nacht schliefen sie beide. Felix war bei der Wache eingenickt, ein Speichelfaden lief sein Kinn hinab. Sie schnarchten leise, und manchmal schien es, als würden sich die Rhythmen ihrer Geräusche zu einer faszinierenden Komposition ergänzen.
Als die Sonne aufging, erwachte Peter. Sprang auf. Zückte sein Fernglas.
"Es ist soweit.", flüsterte, stieß Felix mit dem Fuß an. "Es ist soweit!"
Felix knurrte.
"Steh auf!", flüstere Peter etwas lauter und trat - nicht ganz ohne Absicht - etwas fester zu.
Felix riss die Augen auf.
"Wasnlos?"
"Es ist soweit.", wiederholte Peter und zeigte zur Herde.
In diesem Augenblick teilte sich der Block grauer Leiber und gab die Sicht frei. Auf die Elefantendame. Und ihr Kalb. Ihr Baby.
Peter schossen die Tränen in die Augen. "Nicht doch.", sagte Felix mit belegter Stimme und reichte ihm ein Taschentuch.
Das Regenbogenelefantenbaby stand bereits auf eigenen Füßen. Nicht sehr sicher, doch es stand. Der Rüssel der Mutter blieb in steter Nähe, berührte es, gab Gleichgewicht. Ein erster Schritt.
"Es läuft!", rief Peter beglückt.
"Schhhhht.", mahnte Felix und wischte sich eine Träne von der Wange.
Als die Herde weiterzog, ließen sie Peter und Felix zurück, in ihrem Busch versteckt, die Ferngläser vor die Augen gepresst - und selig lächelnd.
"Das war vielleicht das Schönste, was ich je sah.", sagte Peter nun schon zum vierten Mal. "Das Schönste."
Felix nickte. "Aber es ist nicht bunt. Das Baby ist nicht bunt."
Peter nahm das Fernglas herunter und schüttelte mit dem Kopf. "Nein, nicht bunt. Ein ganz normales graues Elefantenbaby. Kein Regenbogenelefant." Er seufzte. "Leider kein Regenbogenelefant." Er machte eine kurze Pause und lächelte zufrieden. "Und trotzdem."
"Trotzdem.", wiederholte Felix und nickte nochmals.
Er blickte ein letztes Mal auf den neugeborgenen Elefanten, dessen Schritte längst nicht mehr unsicher und holprig wirkten, seufzte kurz und nahm das Fernglas ebenfalls herunter.
"Zeit zu gehen.", sagte er.
"Zeit zu gehen.", sagte Peter und packte seine Ausrüstung zusammen.
Nur wenige Hundert Meter entfernt pupste ein Elefantenbaby, und für einen Augenblick schillerte die entweichende Luft in allen Farben des Regenbogens.
morast - 11. Okt, 09:28 - Rubrik:
Wortwelten
Auch das dritte Bild war verwackelt.
"Vielleicht ist die Kamera kaputt.", meinte ich und wusste, dass es nicht stimmte. Ich hatte einen ganzen Film damit verbracht, sie auszuprobieren, Schnappschüsse zu machen und mich davon zu überzeugen, dass die Kamera in bestem Zustand war. Trotzdem richtete ich sie auf Peter und betätigte den Auslöser.
Es dauerte einen winzigen, spannungsgeladenen Aufgenblick, dann begann die Kamera zu arbeiten. Wie hatte ich das vermisst, dieses Geräusch von Mechanik, dieser Beweis einer maschinell ausgeführten Tätigkeit, die ich bis heute nicht völlig begriffen hatte. Wie hatte ich es vermisst, dem weißen Polaroidfoto zuzuschauen, wie es langsam aus dem Inneren des Apparates ins Freie geboren wurde. Wie hatte ich es vermisst, ihm das Gezeugte zu entreißen und und wild wedelnd darauf zu warten, dass sich allmählich Formen und Farben auf dem belichteten Papier herausbildeten.
Ich lächelte, Peter schaute genervt. Nicht nur auf dem Foto, sondern auch in Wirklichkeit. Wie niedlich er aussah, wenn sich seine Stirn in Falten legte, wenn seine Mundwinkel nach unten sanken, wenn er die Backenzähne aufeinanderpresste.
"Scharf!", rief ich und hielt Peter sein Abbild vor die Augen. Er nickte, betrachtete sich selbst, seine abweisende Miene, festgehalten mit einer Kamera, die vor 20 Jahren als modern gegolten hätte, ließ ein winziges Schmunzeln aufblitzen und versuchte dann, seinen Unmut wiederzufinden und sich in ihm zu vergraben. Es gelang ihm nicht ganz. Zu gut kannte ich ihn, um nicht zu bemerken, dass sein Portrait ihn aufgeheitert hatte. Und dass er sich Sorgen machte. Nicht wegen mir, sondern wegen des Fotos. Wegen der drei verwackelten Fotos. Wegen des Stuhls.
Die Fotos waren nicht verwackelt. Nicht völlig. Nur der Stuhl war unscharf darauf zu sehen, als hätte man eine stuhlförmige Milchglasscheibe vor ihm positioniert. Als wären Nebel aufgezogen, um sein wahres Antlitz zu verhüllen. Als wäre er eine Art Vampir, den zu fotografieren nicht möglich war. Doch es war ein Stuhl. Ein schlichter Holzstuhl. Ein Bertil, vor einer Stunde bei Ikea erworben und innerhalb weniger Minuten montiert. Ein Stuhl aus Kiefer, Schrauben und Leim. Ein Stuhl.
Ich fotografierte ihn ein viertes Mal. Der Apparat gebar, und ungeduldig wedelte ich das Polaroidfoto hin und her, auf und ab. Unscharf.
Die Konturen meiner Strickjacke, die ich auf dem Stuhl abgelegt hatte, waren klar und eindeutig. Das Kachelmuster des Küchenfußbodens war in Perfektion abgebildet. Selbst die Stehlampe hinter dem Stuhl war, obgleich außerhalb des Bildzentrums stehend, noch schärfer zu sehen als der hölzerne Stuhl, dessen Kanten schwammigen Wesen aus fernen Galaxien glichen, als bestünde die Welt eigentlich aus Aquarellfarbe und für den Stuhl wäre zu viel Wasser benutzt worden.
"Vielleicht kommt der Fokus mit der Farbe nicht klar.", murmelte ich zweifelnd, rannte rasch ins Arbeitszimmer, kramte in einer der zahlreichen Schubladen, hielt triumphierend die Digitalkamera hoch und eilte in die Küche zurück. Peter war verschwunden, hatte vermutlich die Lust verloren. War auf dem Klo oder so. In schneller Folge schoss ich fünf, sechs Bilder vom Stuhl - und allesamt waren sie scharf.
Unglaublich.
"Peter, schau dir das an!", rief ich, doch bekam keine Antwort. Ich ergriff die Polaroidkamera, richtete sie auf den Stuhl, drückte ab. Es surrte, brummte. Ich wartete, wedelte. Unscharf.
Allerdings hatte sich die Farbe des Stuhles geändert. Das helle Kiefernholz hatte auf dem Foto einen dunkleren Farbton angenommen, als wäre die Polaroidkamera nicht nur nicht imstande, seine Konturen ordnungsgemäß darzustellen, sondern hätte auch die Fähigkeit verloren, die Farben der Wirklichkeit entsprechend zu reproduzieren. Allerdings nicht alle Farben. Nur die des Stuhls.
Ein Schauer lief mir über den Rücken.
"Peter!", rief ich, und hoffte, dass er die Panik in meiner Stimme nicht hörte. "Peter, sieh dir das an!"
Peter reagierte nicht. Gab keinen Laut von sich. War nicht zu sehen. Arschloch!, dachte ich, da fiel mein Blick auf die Mikrowelle. Auf die gläserne Scheibe der Mikrowelle, in der sich der Stuhl spiegelte. Oder eben nicht spiegelte.
Ich lief ins Bad. Kein Peter weit und breit zu sehen. Ich zuckte mit den Schultern, griff mir den Kosmetikspiegel und kehrte zum Stuhl zurück. Schaute ihn an. Erst so, dann durch den Spiegel.
Keuchte.
Selbst das Spiegelbild des Stuhles war verschwommen.
Das konnte doch nicht sein!
Ein Vampirstuhl!, durchzuckte es mich, und vor zwei Minuten hätte ich diesen Gedanken noch herrlich lächerlich gefunden. Doch jetzt nicht mehr.
Peter! Wo war Peter?
"Peter!", rief ich, verzweifelt, den Tränen nah. Doch Peter schwieg. War wie vom Erdboden verschluckt. Oder von einem Stuhl.
Misstrauisch betrachtete ich das Möbelstück. Schüttelte den Kopf. Das war doch alles albern!
Vielleicht war der Stuhl ja ein der Sarg eines Vampires gewesen, hatte dessen negative Energien aufgesaugt und war nun selbst ... Ich unterbrach meine Gedanken.
Peter. Ich musste Peter finden.
Stellte man Särge überhaupt aus Kiefer her? Verwendete man dazu nicht Eiche? Und waren die Bretter nicht eigentlich zu schmal, um später aus ihnen einen Stuhl...
"Schnauze!", schrie ich mich an. "Schnauzeschnauzeschnauze!"
Ich drehte mich um, rannte durch die Wohnung, suchte nach Peter. Im Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, erneut im Bad, öffnete die Wohnungstür, rannte ins Erdgeschoss, auf die Straße, entdeckte niemanden, keinen Peter, keine Menschenseele, absolut niemanden. Vielleicht hatte ich ihn übersehen, dachte ich, stürmte zurück. Vielleicht in dem hohen Sessel im Arbeistzimmer. Vielleicht war er - aus welchem Grund auch immer - gerade im Kleiderschrank. Jedes Zimmer durchforstete ich, suchte Peter, öffnete Schränke und Schubladen, schaltete Lampen an und aus, riss das Fenster auf, rief seinen Namen, wieder und wieder, rannte in die Küche zurück, weil ich ein Geräusch zu hören glaubte - und hielt dann inne.
Keuchte. Außer Atem. Fassungslos. Verständnislos.
Was geschah hier? Wo war Peter? Was war das für ein bescheuerter Stuhl?
Mir drehte sich alles. Die Welt drohte in meinem Kopf zu kollabieren, und ich setzte mich.
Auf den Stuhl.
morast - 8. Okt, 13:50 - Rubrik:
Wortwelten
Das Paket konnte noch nicht lange dort stehen. Vor einer halben Stunde hatte ich noch den Müll herausgebracht, hatte die Wohnungstür geöffnet, war die sieben Stufen hinuntergelaufen, hatte mich durch die Haustür begeben, die fünfeinhalb Meter Fußweg zurückgelegt, den Beutel mit dem bereits unangenehm riechenden Inhalt in die erstbeste Tonne geworfen und war zurückgelaufen, zurück in meine Wohnung, zurück in meine Küche, wo der Wasserkocher bereits seinen Betrieb eingestellt hatte und geduldig darauf wartete, mir einen heißen Morgentee zuzubereiten. Sicherlich war ich gerade aufgestanden gewesen, hatte trotz wasserintensiver Reinigung noch das eine oder andere Krümelchen Müdigkeit in meinen Augenwinkeln kleben, doch bezweifelte ich, dass ich selbst bei absoluter geistiger Abwesenheit imstande gewesen wäre, dieses Paket zu übersehen.
5 Uhr 30 kam noch keine Post, stellte ich fest. Die halbvolle Tasse Tee war längst erkaltet und ich stand in Wintermantel, Schal und andere gesellschaftlich akzeptierte Körperverhüllungen gekleidet in der Tür und betrachtete das Paket, das meinen frisch geputzten Schuhen so unerwartet Widerstand geleistet hatte. Es konnte noch nicht lange dort stehen, stellte ich fest. 5 Uhr 30 kam noch keine Post, stellte ich fest. Meine Nachbarn, allesamt im Rentenalter, wären niemals imstande gewesen, dieses Monstrum von einem Paket anzuheben und in frühester Morgenstunde geräuscharm vor meiner Tür abzustellen, stellte ich fest. Meine Nachbarn hätten niemals ein Paket für mich angenommen, stellte ich fest und grinste säuerlich.
Woher stammt also dieses Paket, wunderte ich mich. Doch nicht sehr lange, denn das Paket selbst, dessen fast absurdes Äußeres, lud viel mehr zur Verwunderung ein. Es war groß, überaus groß, nahm fast die gesamte Breite des Türrahmens ein und ging mir teilweise bis zum Bauchnabel. Teilweise. Denn das Paket war kein Paket, das der üblichen Achteckigkeit, der altbekannten Sechsflächigkeit frönte, nein es hatte zahllose Flächen unterschiedlichster Form und Größe und weigerte sich, auch nur annähernd quaderförmig zu sein. Fast war es, als wäre das Paket von einem Wahnsinnigen entworfen worden, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Grenzen der menschlichen Wahrnehmungsfähigkeit auszuloten.
Das Paket war pink. Und damit meine ich nicht das Pink, das kleine Mädchen und Jugend erstrebende Mittvierziger gerne als Kleiderkoloration wählen, nicht jenes Pink, dem eine gewisse kecke Mädchenhaftigkeit beiwohnt, jenes Pink, das ich zwar noch nicht für hübsch erachtete, dessen Existenz ich aber keineswegs bedauerte. Nein ich meinte Pinkpink. Überpink. Grellpink. Ein Pink, das mich anschrie, meine Augen auspeitschte, eines, das selbst nach dem Wegsehen noch im Blick nachglomm, das sich sogar auf meine Zunge gelegt, meine Geschmacksnerven beeinflusst zu haben schien. Echtes Pink.
Und dann die Schleife. Sie war keine Schleife, sondern die Karikatur einer Schleife, die Groteske einer Schleife, ein monströses Konstrukt, das lächerlich und beeindruckend zugleich war, das schaffte, mich schmunzeln zu lassen, während mir das Herz vor Schreck beinahe stehen ...
Das Paket bewegte sich.
Nein, das konnte nicht sein! Pakete bewegten sich nicht. Selbst derart abstruse Pakete wie das vor meiner Tür bewegten sich nicht. Nie-mals!
Das pinkfarbene Papier riss auf. 'Kein Dinosaurier!', dachte plötzlich und ohne Grund. 'Bitte lass es kein Dinosaurier sein!'
Vorsichtshalber trat ich einen Schritt zurück.
"Tadaa!", rief der Kerl, der soeben auf dem unförmigen Paket sprang und breite die Arme aus. Verdutzt starrte ich ihn an. Sein Anzug war pink. Normal pink. Nicht überpink, grellpink, kreischpink, sondern normal pink. Wie man es kennt. Er grinste und schob sich die zerzausten Haare aus der Stirn.
"Ich komme gleich zur Sache:", sagte er und sein Grinsen verbreiterte sich proportional zu meinen den Gesetzen des Entsetzens frönenden Pupillen.
"Du schläfst zu wenig. Viel zu wenig. Es ist jetzt...", Er hielt inne, schaute auf sein linkes Handgelenk, wo er mit Filzstift ein paar zeigerähnliche Linien hingekrakelt hatte. "... viel zu früh, und du bist schon wach."
Er starrte mich an, blickte mir ins Gesicht, und ich konnte die Augenringe spüren, die unter meinen Sehorganen hingen, fühlte die Schlafsandreste in meinen Augenwinkeln, spürte bereits jetzt die Kraftlosigkeit, die sich im Laufe des Nachmittags in meinem Körper ausbreiten würde, erkannte jede einzelne Sekunde fehlenden Schlafes.
"Wann bis du ins Bett gegangen?", fragte er mich. "Um elf? Um zwölf?"
"Halb eins.", murmelte ich. Das war korrekt. Dass ich anschließend noch mindestens zwanzig Minuten gelesen hatte, verschwieg ich jedoch.
"Halb eins?!?", schrie der Anzugmensch und streifte sich letzte Paketpapierreste ab. "Halb eins?!? Das ist zu spät! Ich meine, jetzt ist es gerade mal ..." Er sah wieder auf seine aufgemalte Uhr. "viel zu früh, und du bist bereits wach!"
"Ich...", setzte ich an.
"Und so geht das seit Tagen!", rief der Anzugmann.
"Ich..."
"Seit Wochen!!"
"Aber..."
"Du brauchst Schlaf. Jetzt. Sofort. Auf der Stelle.", sagte der Anzugmann und beruhigte sich ein bisschen.
"Aber ich muss doch arbeiten!"
"Nicht jetzt. Nicht für die nächsten Stunden.", widersprach der Anzugmann.
"Ich schlafe morgen länger.", versprach ich.
Der Anzugmann schüttelte den Kopf. Wurde ernst. Und leise.
"Schau dich an. Schau dich ganz genau an. Du brauchst Schlaf. Viel Schlaf. Nicht nur ein bisschen, sondern viel. Und zwar jetzt." Er seufzte. "Ich sage das als Freund, weil ich dir helfen will, weil ich möchte, dass es dir gutgeht. Schau dir doch an, wohin du gekommen bist: Du stehst morgens um ..." Er sah auf seine nicht existierende Uhr. "Äh... ganz schön früh auf dem Flur und hast Halluzinationen."
"Halluzinationen? ich habe keine Hallu..."
"Und was bin ich?"
"Du bist e-echt?"
"Und dieser pinkfarbene Anzug?"
"Echt."
"Und dieses überpinke Paketpapier?"
"Auch echt."
"Und diese wahrlich abstruse Schleife?"
"Die ist ebenfalls echt.", meinte ich und war mir meiner Sache äußerst sicher.
"Und dieser überaus nutzvolel, aber auf jeden Fall halluzinierte Gummihammer?", fragte der Anzugmann.
"Ech-", begann ich. "Welcher Gummihammer?"
"Der hier!", rief der Anzugmann triumphierend und zog aus der Innentasche seines Jackets einen drei Meter großen überpinkfarbenen Gummihammer.
Ich begann zu zweifeln. Das konnte doch nicht echt sein, oder?
Der Hammer drehte sich ein Stück und raste dann direkt auf mich zu. Der Anzugmann lachte irssinig, dann traf mich eine Wucht aus pinkfarbenem Gummi und ich fiel in Ohnmacht.
Ich erwachte in meinem Bett. Schaute auf den Wecker. "8 Uhr 15. Zeit zum Austehen.", sagte ich, gähnte kurz und lächelte. Heute hatte ich endlich mal gut geschlafen.
morast - 7. Okt, 07:02 - Rubrik:
Wortwelten