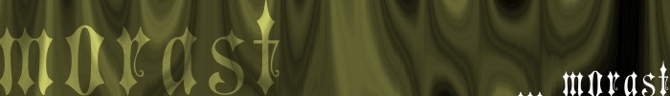Noch ... Tage bis ...
Mir mißfällt derartiges Denken. Insbesondere an mir selber. Fragte ich mich nach dem Grund, so antwortete ich wahrscheinlich, daß vorausschauendes, Zukunft organisierendes Denken nicht meinem Naturell entspräche, ja daß bereits Schwärme allergischer Verpustelungen über mein schwerstes Organ krauchen, sobald ich ein Wort wie "Planung" nur in den Mund nehme. Und um mich mit ebenjener Behauptung nicht in ungünstiges Licht zu rücken, würde ich relativierend ergänzen, daß ein auf die Zukunft orientiertes Denken die Gegenwart, den Moment, vernachlässige, und daß ich mich bemühe, jeden Augenblick als kostbar zu begreifen. Doch das klingt ausgelutscht und kitschig und erinnert mich dessen, daß ich zu früheren Zeitpunkten argumentierte, daß ein Augenblick viel zu kurz sei, um ihn fassen oder gar nutzen zu können, daß also so etwas wie eine Gegenwart gar nicht existiert. Bedenkt man zusätzlich, daß das Zukünftige noch ungelebt durch das All dümpelt, bleibt uns nur die Vergangenheit, welche die bedeutsamsten Teile des eigenen Daseins befüllt.
Doch ich schweife ab, stehe noch immer hier und versuche zu er- und begründen, warum es mir mißfällt, abwartend zukünftigen Tagen entgegenzusehen - je nach anstehendem Ereignis mit lachendem oder weinendem Auge [oder natürlich mit beidem]. Ich zögere, mir einzugestehen, daß die Komponenten Trägheit und Entscheidungsunfreudigkeit ihre fauligen Pranken im Spiel haben könnten, daß mein gepriesenes Augenblick-Leben mit weniger positiv attributierten Argumenten einhergehen könnte. Dann raffe ich mich auf und gestehe, daß es mir zusagt, Entscheidungen erst im letzten Augenblick zu fällen, doch begründe jenes - bevor diese Negativeigenschaft meine güldene Aura zu verdunkeln beginnt - mit dem Wunsch, mir jede Möglichkeit, jeden Weg, bis zuletzt offenhalten zu wollen, als liefen unzählige Fäden durch meine Hände, denen es nur eines kräftigen Rucks bedürfte, um Alternativen aufzuzeigen und begehbar zu machen. Daß sich durch das Warten bis zum Letzten von selbst Pforten verschließen, verschweige ich mir.
Mein Naturell - es bedarf keiner Begründung. Ich winke selbstironisch schmunzelnd ab. Der Künstler in mir formt diese affektierte Gebärde, der Auf-Dem-Boden-Gebliebene lacht darüber.
Wahrlich, es bedarf keiner Begründung, keiner Verteidigung. Doch nicht, weil richtig ist, wie ich bin, sondern weil ich derzeit nicht zu sein vermag, was jenes Naturell mir auferlegt. Denn ich plane, organisiere, berechne im Voraus, erwarte zukünftige Stunden und Tage mit Sehnsucht und fürchte wieder andere mit ängstlich abgewandtem Blick. [Immerhin: Der Blick zeigt zum Moment, das Kommende nicht wahrhaben wollend, das Jetzt genießend.] Die letzten und die nächsten Tage, die letzten und die nächsten Wochen, ja Monate, sie waren und sind angefüllt mit Voraussicht, mit zögernder, nicht weiser, mit unwilliger, doch nötiger.
Und wo ich eben noch mein planungsunfreudiges Naturell pries, sehe ich mich nun als eifriger Rechner Kleinstes und Größtes vorauskalkulieren, sehe mich den Zwängen beugend die Zukunft greifen - obgleich sie nach wie vor und immer ungreifbar in der Ferne schlummert, nur Vages von sich zeigt, nur Silhouetten, die mir genügen müssen in meinem auferlegten Planen. "Dein Naturell verdirbt!", wirft da ein aufmerksamer Sorgender ein und bringt zur Sprache, was wahr ist: So unklar ich auch formulierte, das Zukünftige behagt mir nicht. Ich führe längst kein Leben mehr, sehe mich degradiert auf Momente der Ruhe zwischendrin, auf Augenblicke im Schweben, in denen ich die Welten des Jetzt aus meinem Schädel zu bannen trachte.
Ich zähle verbleibende Stunden, ja Minuten, zerstückle die Zeit und werfe sie dem Nichts zum Fraß vor. Tage mutieren zu Folter und Erlösung. Gedanken kreisen wie Aasgeier um Kommendes, auf daß seine Kadaverfetzen meinen Leib bedecken mögen.
Ich verliere mich, und wenn ich daherkäme und mich fragte, warum es mir mißfällt, Tage zu zählen, bis Ereignisse beginnen oder enden, dann zeigte ich auf mich, auf die Ringe unter meinen Augen, auf die Tage, die ich mit Existenz fülle, ohne mir ihrer bewußt zu sein, auf das Verlangen nach dem Schweben, nach dem Mittendrin, nach einer Pause, die mich erhellt und mir für einen winzigen Zeitbruchteil mein Naturell zurückgibt.
Doch ich schweife ab, stehe noch immer hier und versuche zu er- und begründen, warum es mir mißfällt, abwartend zukünftigen Tagen entgegenzusehen - je nach anstehendem Ereignis mit lachendem oder weinendem Auge [oder natürlich mit beidem]. Ich zögere, mir einzugestehen, daß die Komponenten Trägheit und Entscheidungsunfreudigkeit ihre fauligen Pranken im Spiel haben könnten, daß mein gepriesenes Augenblick-Leben mit weniger positiv attributierten Argumenten einhergehen könnte. Dann raffe ich mich auf und gestehe, daß es mir zusagt, Entscheidungen erst im letzten Augenblick zu fällen, doch begründe jenes - bevor diese Negativeigenschaft meine güldene Aura zu verdunkeln beginnt - mit dem Wunsch, mir jede Möglichkeit, jeden Weg, bis zuletzt offenhalten zu wollen, als liefen unzählige Fäden durch meine Hände, denen es nur eines kräftigen Rucks bedürfte, um Alternativen aufzuzeigen und begehbar zu machen. Daß sich durch das Warten bis zum Letzten von selbst Pforten verschließen, verschweige ich mir.
Mein Naturell - es bedarf keiner Begründung. Ich winke selbstironisch schmunzelnd ab. Der Künstler in mir formt diese affektierte Gebärde, der Auf-Dem-Boden-Gebliebene lacht darüber.
Wahrlich, es bedarf keiner Begründung, keiner Verteidigung. Doch nicht, weil richtig ist, wie ich bin, sondern weil ich derzeit nicht zu sein vermag, was jenes Naturell mir auferlegt. Denn ich plane, organisiere, berechne im Voraus, erwarte zukünftige Stunden und Tage mit Sehnsucht und fürchte wieder andere mit ängstlich abgewandtem Blick. [Immerhin: Der Blick zeigt zum Moment, das Kommende nicht wahrhaben wollend, das Jetzt genießend.] Die letzten und die nächsten Tage, die letzten und die nächsten Wochen, ja Monate, sie waren und sind angefüllt mit Voraussicht, mit zögernder, nicht weiser, mit unwilliger, doch nötiger.
Und wo ich eben noch mein planungsunfreudiges Naturell pries, sehe ich mich nun als eifriger Rechner Kleinstes und Größtes vorauskalkulieren, sehe mich den Zwängen beugend die Zukunft greifen - obgleich sie nach wie vor und immer ungreifbar in der Ferne schlummert, nur Vages von sich zeigt, nur Silhouetten, die mir genügen müssen in meinem auferlegten Planen. "Dein Naturell verdirbt!", wirft da ein aufmerksamer Sorgender ein und bringt zur Sprache, was wahr ist: So unklar ich auch formulierte, das Zukünftige behagt mir nicht. Ich führe längst kein Leben mehr, sehe mich degradiert auf Momente der Ruhe zwischendrin, auf Augenblicke im Schweben, in denen ich die Welten des Jetzt aus meinem Schädel zu bannen trachte.
Ich zähle verbleibende Stunden, ja Minuten, zerstückle die Zeit und werfe sie dem Nichts zum Fraß vor. Tage mutieren zu Folter und Erlösung. Gedanken kreisen wie Aasgeier um Kommendes, auf daß seine Kadaverfetzen meinen Leib bedecken mögen.
Ich verliere mich, und wenn ich daherkäme und mich fragte, warum es mir mißfällt, Tage zu zählen, bis Ereignisse beginnen oder enden, dann zeigte ich auf mich, auf die Ringe unter meinen Augen, auf die Tage, die ich mit Existenz fülle, ohne mir ihrer bewußt zu sein, auf das Verlangen nach dem Schweben, nach dem Mittendrin, nach einer Pause, die mich erhellt und mir für einen winzigen Zeitbruchteil mein Naturell zurückgibt.
morast - 11. Jan, 20:08 - Rubrik: Geistgedanken
0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks