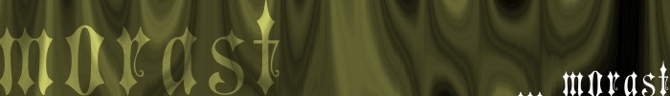Bahnbegegnungen
Erfrischende Glattheit reckte sich glänzend meiner Hand entgegen, als ich die Kastanie aufhob. Doch nun sitze ich auf dem Bahnhof, die Herbstfrucht in der Hosentasche verstaut, wartend, während meine Banknachbarin dem alten Gesetz der Nichtraucherei frönt: Raucherqualm sucht sich stets zu belästigende Nichtraucheropfer.
Ich steige in den ankommenden Zug ein und entsinne mich, dass ich einst wusste, welche die Fahrtrichtung die richtige war. Vermutlich sitze ich falschherum, doch die Bedeutung des In-Fahrtrichtung-Sitzens wird ohnehin als zu immens gewertet. Denn sowohl als Nach-Vorne- als auch als Nach-Hinten-Blickender werde ich im Laufe der Fahrt das gleiche, ja: dasselbe, zu Gesicht bekommen. Die dazwischenliegende, minimale Verzögerung ist angesichts endlos langweiliger Außenlandschaften und deren einschläfernder Monotonie unbedeutend.
Noch nie hörte ich von einem, der ein außerzugliches Ereignis aufgrund seiner Sitzposition vor anderen entdeckte und durch einen rasch abgesonderten Warnlaut alle anwesenden Nach-Hinten-Blicker vor deren Tod bewahrte. Allerdings muß ich eingestehen, bisher auch noch nicht allzu vielen Zugunglückserfahrern gelauscht zu haben. Eigentlich keinem. Es besteht also Grund zur Freude, dass niemandem aus meinem Umfeld bisher ein Zugunglück zustieß. Hurra. Ich freue.
Eigentlich freue ich mich, weil freuen ein transitives Verb ist, also stets eines Akkusativobjektes bedarf und keineswegs allein im Raum bzw Satz stehen sollte. Doch ich wollte es der Bibliotheksfahrstuhlstimme nachmachen, welche wieder und wieder die Fahrstuhletagen und dieselben zwei Sätze zu wiederholen hat: "Tür schließt." und "Tür öffnet."
"Tür schließt." ist zwar ein kurzer, aber dennoch unzweifelhaft richtiger Satz, "Tür öffnet." dagegen klingt und ist schlichtweg falsch. Für ein lächerliches "sich" hätte das Tonband sicherlich auch noch Platz gehabt. Ich weiß, dass in modernen Fahrstühlen die Stimmen keineswegs "von Band" kommen, sondern in digitaler Form an die Lautsprecher übergeben werden, doch ist es ohnehin schlimm genug, dass von Studenten genutzte Fahrstühle mit Stimmen bestückt werden müssen, die nicht nur die jeweilige Fahrstuhletage verkünden, sondern auch noch über die Zustand der Fahrstuhltüren informieren. Studenten nämlich freuen sich über ein wenig akustische Hilfeleistung, wenn sie mal wieder ratlos im Aufzug stehen und nicht wissen, auf welcher Etage sich dieser befindet oder ob die Tür sich gerade öffnet oder schließt.
Allerdings wird mir gerade bewusst, dass Studenten nicht nur schlau genug sein könnten, um den leuchtenden Etagentasten die jeweilige Fahrstuhletage entnehmen zu können, ohne dass sie durch eine grammatikalisch inkorrekt sprechende Stimme darauf hingewiesen werden müssen, sondern dass einzelne Exemplare womöglich über eine weitere Eigenschaft verfügen, die jede Stimmmaßnahme – abgesehen von der inkorrekten Grammatik – rechtfertigt: Sie sind blind. Natürlich ist Otto Normalstudent [um mal einen wahrlich unschönen Begriff deutsche Alltagssprache zu missbrauchen] nicht blind, doch es gibt Ausnahmen und wäre äußerst unnett, des Sehens nicht Mächtigen die Informationen über die derzeitige Fahrstuhletage vorzuenthalten. So grausam bin ich nicht, lungere ich doch, was die Stärke bzw Schwäche meiner Augen betrifft, doch selbst in bemitleidenswerter Nähe zur Hund-Stock-Dreipunktarmbinde-Fraktion herum.
Andererseits sind die Blinden, wenn die schreckliche Fahrstuhlstimme nur für sie installiert wurde, eindeutig die Schuldigen, auf die sich mein anklagender Finger richtet, wenn ich mich mal wieder über das fehlende "Tür öffnet."-sich beschweren möchte. Ich werde durch die Stadt laufen, auf jeden einzelnen Blinden mit meinem Zeigefinger deuten [was sicherlich wenig nützt, angesichts ihrer Sehschwäche] und lauthals die von Trübsal und Verzweiflung triefenden Worte proklamieren: "Die Blinden sind schuld! Die Blinden sind schuld!"
Allerdings sollte ich bedenken, dass die Blinden vermutlich mit mir leiden, nicht auf der Straße, den anklagenden Worten lauschend, sondern im Fahrstuhl stehend, das ungute Falschdeutsch vernehmend. Blinde sind schließlich nicht dafür bekannt, sich hundsgemein gegen korrekte Spache verschworen zu haben. Nein, vielmehr werden sie genauso sehr auf das fehlende "sich" erpicht sein wie ich, weil sie zwar nicht mit den Augen, aber doch mit den Händen lesen können und somit vermutlich ein gutes Stück Literatur ebenso zu schätzen wissen wie einen grammatikalisch richtigen Aussagesatz. Vielleicht werden wir uns, sobald die Fahrstuhlstimme wieder ihr unsägliches Deutschimitat von sich gegeben haben wird, an den Händen fassen und gemeinsam weinen. "Blinde können zwar nicht sehen, aber weinen." werden die in der Bibliothek herumstromernden Studierenden staunen und hilfsbereit blütenweiße Taschentücher zücken und uns die salzigen Perlen [<= standardisiertes Tränensynonym] aus dem Antlitz wischen.
Ups, da ist mir doch in den vorangegangenen Satz ein Wort hineingeschlüpft, dessen es im allgemeinen und auch in meinem persönlichen Sprachwortschatz nicht bedarf: "Studierende". Studierende sind Studenten. Bloß weil man der konsequenten Femininisierung aller Worte in Form eines Wortmitten-Is überdrüssig ist und auf "StudentInnen" verzichten möchte, herrscht nicht automatisch Bedarf nach einem geschlechtsneutralen substantivierten Partizip.
"Es gibt aber Studenten, die den ganzen Tag lang in der Gegend rumgammeln und ihr Bafög versaufen, somit also gar nicht studieren! Und es gibt welche, die fleißig jede Vorlesung besuchen und tonnenschwere Bücher wälzen, als studieren. Da muß man doch differenzieren!", mischt sich ein Kritisierender … äh … Kritiker ein. "Letztere Gruppe sind die Studierenden, die eindeutig geringer an Zahl sind als Studenten, weil sich ja jeder ein Student ist, der einen entsprechenden Ausweis besitzt, aber nicht jeder von denen wirklich studiert."
Jaja!, entgegne ich äußerst unwirsch. Aber bloß weil ein Bauarbeiter mal biertrinkend und Bildzeitung betrachtend in der unverputzten Ecke sitzt, muß man doch nicht gleich zwischen Bauarbeitern und Bauarbeitenden unterscheiden. Außerdem ist das etymologisch betrachtet …
"Was?!", unterbricht mich der Kritiker, der Fremdwörter nicht zu mögen scheint. Ich verbessere mich:
Wenn man sich die Sprachgeschichte des Wortes "Student" betrachtet, stellt man schnell fest, dass der Wortstamm im lateinischen "studere" beheimatet ist.
"Stimmt.", meint der Kritiker, der mich diesmal verstanden hat. "Das sagte mein Professor auch immer: 'Student kommt von studieren – sich bemühen.'"
Eben., antworte ich. Das Partizip Perfekt Aktiv, also das deutsche Partizip I, also "sich bemühend", lautet im Lateinischen "studens"; im Genitiv, also im zweiten Fall, im Wes-Fall, "studentis". Dort sieht man ihn schon, den Wortstamm, der für unsere Betrachtung von Bedeutung ist und zu unserem "Student" führen wird. Er steckt im Partizip "sich bemühend". Ein Student ist also ein Sich-Bemühender.
Will man aber aus dem Studenten einen Studierenden formen, so muß man ihn entweder zum Sich-Bemühen animieren oder erneut das Partizip bilden, diesmal jedoch in der deutschen, nicht in der lateinischen Sprache; um genau zu sein: von "studieren", nicht von "studere".
Dennoch ist das Ergebnis dasselbe: Ein "Student" ist ebenso wie ein "Studierender" nichts weiter als ein substantiviertes Partizip, abgeleitet vom lateinischen Wort für "sich bemühen". Wozu muß man also "Student" ersetzen, wenn der Ersatz, "Studierender", nicht nur das Gleiche bedeutet, sondern auch länger und umständlicher ist?
Der Kritiker schweigt. Mein Vortag langweilte ihn wohl. Jaja, diese Kritiker: political correctness duldet zwar Pingelichkeiten, doch keine Berichtigungen. Ich jedoch sage: "Wenn pingelig, dann richtig!" und ergänze: "Wenn Fahrstuhlstimme, dann grammatikalisch korrekt!" Der Schaffner betritt das Abteil und meint: "Wenn Zugfahren, dann ohne Schuhe auf den Sitzen!"
Er hat recht. Beschämt stelle ich meine beschuhten Füße auf den Boden und reiche ihm meine Fahrkarte. Für einen Moment sehne ich mich danach, dass er diese nicht mit einem uninteressanten Datumsstempel, sondern mit einem gestanzten Loch versieht, so wie es einst üblich war. Ein Loch stünde meiner automatenbedruckten Bahnfahrkarte sicherlich prima. Doch er stempelt und verlässt das Abteil, ohne zurückzuschauen und zu bemerken, dass meine Schuhe schon wieder klammheimlich die kostbaren Zweite-Klasse-Sitze in Beschlag nahmen.
Böse Schuhe!, tadle ich matt, doch für heute habe ich schon genug Tadel verteilt. Außerdem sind es nicht meine Schuhe, sondern die ungünstig geformten Sitze, die Schuld daran tragen, dass ich mich genötigt fühle, meinem Leib in eine bequemere Verweil-Position zu suchen – welche die verbotene Schuhablage mit einschließt. Gerne würde ich aufstehen und durch den Zug laufen, meinen anklagenden Zeigefinger auf jeden einzelnen der unförmigen Sitze richtend, und rufen: "Die Sitze sind schuld! Die Sitze sind schuld!"
Doch in Anbetracht eines Zuges voller Sitzmöglichkeiten – selbst die Sitzmöglichkeiten der ersten Klasse erwirken die Schuh-auf-Sitz-Bewegung – und somit anstehender, aufwendiger Dauerbeschuldigung schweige ich lieber, lege mein Notizbuch weg und erfreue mich der beruhigenden, glänzenden Glattheit der vorhin aufgelesenen Kastanie.
morast - 29. Sep, 18:07 - Rubrik:
Bahnbegegnungen
In seinen Augenwinkeln bemerkte ich Lachfältchen, ungewohnt ausgeprägt und zahlreich für sein Alter, das ich - in solchen Fragen oftmals unsicher - auf Mitte Zwanzig schätzte. Die Lachfältchen wußten bereits eine Geschichte zu erzählen und stimmten mich fröhlich.
Sein Gesicht war gepflegt, dessen Behaarung ebenso. Sein Lachen war echt und ansteckend, offenbarte weiße, mustergültige Zahnreihen. Ein modischer Kurzhaarschnitt und unaufdringliche, jedoch zeitgerechte, stilbewußte Kleidung komplettierten das Bild.
Es gab keinen Grund, ihn unsympathisch zu finden - sah man von seiner Freundlichkeit ab.
Jeden neu eintreten Straßenbahnbahnnutzer strahlte er vergnügt, mit funkelnden Augen an, grinste fröhlich und grüßte. Seine hohe, mit Speichel getränkte Stimme verriet ihn, die übertriebene Hektik seiner Gesten vernichteten den gewonnenen Positiv-Eindruck:
Der Verstand des jungen Mannes weilte abseits normalen Denkens.
Doch er lächelte, lächelte und grüßte und fand Gefallen dran, sich umzudrehen und seinen Hintermann zu fragen, wohin er unterwegs sei. "Nach Hause?" Der Hintermann nickte, wollte sich nicht auf das Spiel [denn mehr schien es nicht zu sein] einlassen. Zufrieden mit der knappen Antwort drehte sich der junge Mann um und versuchte die Aufmerksamkeit des an der Tür stehenden Kindes erwecken: "Hallo!" rief er durch die Straßenbahn, steht kurz auf, um dessen Pullover zu berühren und sich - nach beharrlicher Ignoranz seitens des Kindes - wieder zu setzen - jedoch ohne jede Spur von Enttäuschung.
Als ich die Straßenbahn betrat, begrüßte er auch mich, verriet den Eindruck, den sein normales Äußere erweckte, schnell durch unnormales Verhalten. "Hi!", grüßte ich zurück und lächelte ihm zu. Er griff meinen Arm, ohne mich meiner Bewegung zu entreißen. Und noch bevor ich Überraschung zeigen konnte aufgrund der fast aufdringlichen Annäherung, war ich bereits vorbei, hatte mich schräg hinter ihm plaziert.
Ich sah ihm zu, wie sein Frohsinn, seine Offenheit, von den verwirrten Gesichtern der Fahrgäste abprallte, wie er sich nicht entmutigen ließ, auch noch den nächsten Einsteigenden zu begrüßen, den nächsten Aussteigenden zu verabschieden.
'Warum nicht?', dachte ich und überlegte, ob nicht wir Normalen es waren, die sich unnormal verhielten. Warum grüßten wir einander nicht, lächelten einander nicht zu, auch ohne uns zu kennen? Warum setzten wir und auf engsten Raum nebeneinander, ohne uns füreinander zu interessieren, versteckten uns hinter Kopfhörern und Büchern, hinter Schweigen und Blicken aus dem Fenster und versuchte, möglichst nicht da, nicht in dieser Straßenbahn zu sein, durch die anderen Mitfahrenden hindurchzusehen, als wäre niemand von uns wirklich existent?
Mir fiel es schwer, den Zeilen des Buches auf meinem Schoß zu folgen; immer wieder lugte ich zu diesem jungen Mann, den als "zurückgeblieben" zu bezeichnen ich nicht wagen würde, erfreute mich seiner nie endenen Fröhlichkeit, als könnte sie sich auf mich übertragen.
'Gern würde ich die Welt einmal durch seine Augen betrachten.', dachte ich, einen Gedanken aufgreifend, den ich schon früher in meinem Schädel gefunden hatte:
Vielleicht ist zuweilen besser, dumm zu sein und davon nichts zu wissen.
Meine Ausstiegshaltestelle näherte sich. Ich klappte ich mein Buch zusammen und stand auf. Bewußt wählte ich den Weg zur Tür an ihm vorbei, wollte keiner Feigheit, keiner Ignoranz frönen. Als er, um mich zu verabschieden, seine Hand ausstreckte, ergriff ich sie.
"Mach's gut.", sagte ich lächelnd und stieg aus.
Durch die sich schließenden Türen vernahm ich noch seine Worte, an den Hintermann gerichtet:
"Das war aber ein netter Mann."
[Im Hintergrund: Die Apokalyptischen Reiter - "All You Need Is Love"]
morast - 20. Apr, 17:27 - Rubrik:
Bahnbegegnungen
An der Straßenbahnhaltestelle warteten bereit Leute. 'Ein gutes Zeichen.', dachte ich, 'Wahrscheinlich kommt der Nachtbus bald.'
Die Verifikation dieses Gedankens wünschend versuchte ich, den aushängenden Fahrplan zu studieren, ein Unterfangen mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, da sich ein Pärchen dazu entschlossen hatte, genau hier, vor dem Fahrplan, vor meinen Augen, auf den Bus warten zu wollen. Es wäre mir egal gewesen; meine Blicke hätten sicherlich einen Weg an ihnen vorbei, zwischen ihnen hindurch gefunden, ohne ihnen ihren erworbenen Stehplatz streitig zu machen. Als ich jedoch den Fahrplan meiner Musterung unterzog, begannen die beiden Blockierenden direkt vor meiner Nase damit, einander eingehend zu küssen, ja erdreisteten sich, dabei von ihren Zungen intensivst Gebrauch zu machen. Nichts liegt mir ferner, als Liebenden oder Nichtliebenden das Küssen verbieten zu wollen, doch in diesem Augenblick befand ich mich nicht mehr als dreißig Zentimeter von ihren speichelfeuchten Zungen entfernt und blickte an ihren einander verschlingenden Mündern vorbei auf den Fahrplan.
Kaum hatte ich die ersuchte Information ergattert, floh ich aus dem Wartehäuschen und erfreute mich der leuchtenden Reklamewand zwischen mir und dem Zungengeflecht. Rechts neben mir befanden sich nun zwei Mädel. Während die eine einen etwas ruppigen, burschikosen Eindruck machte, kicherte die andere ununterbrochen. Ihre offensichtliche Trunkenheit schien für die Erstgenannte kein Hindernis oder vielleicht gar eine Bestätigung dafür zu sein, ihr flüsternd intimste Sexualgeheimnisse zu gestehen und dabei immer wieder ein lautes, dümmliches Kichern zu erwirken.
Leider hörte ich zu viel und vermochte leicht, mir den Rest zusammenzureimen. Allerdings war ich gerade nicht in der Stimmung dafür, mir Geschichten von zu tief in den eigenen Mund gestopften männlichen Geschlechtsorganen erzählen zu lassen.
"Gestopft" ist tatsächlich das richtige Wort.
"Der Magen war wohl schon bereit war für die Nahrungsaufnahme?", kicherte die Kichernde.
"Es gibt Dinge, die werde ich nie mögen.", meinte die Burschikose, von ihrer eigenen Erzählung angewidert, "Ich weiß nicht, was erniedrigender ist. Diese Stellung oder der Mann, den ich neulich sah, der im Park mit einem kleinen Plastikschäufelchen und Tütchen hinter seinem Hund herrannte, um dessen Fäkalien zu entsorgen."
Themawechsel. Die Burschikose hatte ein Date gehabt. Ihre Freundin hatte wohl an irgendeiner Stelle verkündet, daß die Burschikose auf Ältere stehe und Single sei. Prompt war sie mit einem 36jährigen Polizisten verabredet.
'36!', wunderte ich mich, denn die Burschikose war gerade einmal Mitte Zwanzig. 'Bestimmt berichtet sie davon, wie eklig dieser Typ war und was er ihr alles in den Hals stopfen wollte.'
"Er war so langweilig.", meinte sie jedoch. "Als ich fragte, was er am Wochenende mache, erzählte er, er stehe total auf Spieleabende. Da sitzt er mit seinen Freunden bei Monopoly und findet das geil."
Die Kichernde kicherte nicht mehr.
"Mein Vater hat's ja auch nicht so mit den Bullen. Als ich ihm sagte, ich hätte ein Date mit eine Bullen, war er erstmal geschockt. Dann meinte er, ich solle fragen, ob der Bulle im Innen- oder Außendienst arbeiten würde. Die im Innendienst dürfen nicht mit Blaulicht fahren. Und ein Bulle ohne Blaulicht ist ein trauriger Bulle."
Nicht nur das pseudolässige Wort "Bulle" stieß mich ab, sondern auch die Art und Weise, mit der über Klischees das noch nicht erlebte Date vom Vater schon von vorneherein niedergemacht wurde.
Mittlerweile näherte sich der Bus.
"Als ich wieder nach Hause kam, hatte mein Vater aus dem Internet eine Statistik ausgedruckt, nach der Frauen von Polizisten häufiger von ihren Männern erschossen wurden als Frauen von Jägern oder Sportschießern..."
Ich floh in den Bus. Mir gegenüber setzte sich jedoch das Pärchen, das die ganze Fahrt über nicht anderes tat, als Speichel auszutauschen...
morast - 8. Jan, 12:54 - Rubrik:
Bahnbegegnungen
Es begann, als ich mich ausnahmsweise, einer inneren Trägheit folgend, dazu entschloß, an der "Pfälzer Straße" auf die 2 zu warten, anstatt wie sonst üblich die wenigen Fußwegminuten zur Haltestelle "Universität" in Kauf zu nehmen, wo unter den vielen zugleich verkehrenden Linien auch eine Bahn sein würde, die mich bis fast vor die Haustür trüge. Während die studentische, geduldig wartende Menschenmasse immer größere Ausmaße annahm, entdeckte ich allmählich nicht nur verstörte Blicke auf die eigene Uhr und in die Richtung, aus der die Straßenbahn eintreffen würde, sondern auch immer wieder Wesen, die ihren Warteprozeß mit enttäuschtem Gesichtsausdruck abbrachen und leise seufzend die Wegstreckenabarbeitung den eigenen Füßen überließen.
Mit fehlender Uhr fiel es mir schwer zu schätzen, wie lange ich wartete, doch als gefühlte zehn Minuten vergangen und noch immer keine öffentlichen Verkehrsmittel in Sichtweite zu entdecken waren, gab auch ich auf und machte mich mit einem resignierenden Gedanken über das Schicksal, das ausgerechnet dann die 2 verschluckt, wenn ich sie zu benutzen gedenke, auf dem Weg zur Haltestelle "Universität".
Ich sah es schon von weitem: Eine Bahn stand auf den Gleisen, ihrer Passagiere beraubt, tot und träge blinkend. In meinem Schädel formte sich die Hoffnung, es möge nicht meine Richtung sei, die mit wartend-defekten Bahnen blockiert war, doch ich glaubte das Gegenteil, vermutete gar, daß das Fehlen der 2 an der "Pfälzer Straße" mit der stehenden Bahn an der "Universität" zusammenhing.
Ich hatte recht, in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur eine, sondern drei Bahnen standen still, reglos in ihren Gleisen verharrend, auf dem Weg in die Richtung, die ich als "meine" bezeichnete. Ein 'War ja klar!' erübrigte sich; statt dessen bedeckte ich mein Antlitz mit einem Lächeln, plante meine weitere Wegstrecke voraus. Wenn die Gleise blockiert waren, mußte ich noch drei Haltestellen weit laufen, um an die nächste Gleiskreuzung zu gelangen, von der die Möglichkeit bestand, eine Bahn zu erwischen, die mich nicht nur nach Hause brachte, sondern sich überhaupt bewegte.
Im Magdeburger Zentrum liegen zwischen drei Haltestellen nicht mehr als ein Kilometer, fünf Minuten Fußweg über den Breiten Weg, den derzeit unzählige, wegen des Weihnachtsmarktes vom Alten Markt vertriebene Stände blockieren. Es war kalt, doch die wenigen Minuten zu Fuß hatten mich bereits genug erwärmt, um jeder Sorge, wegen möglicher, totaler Straßenbahnfehlfunktion letztendlich nach Hause laufen zu müssen, mit einem desinteressierten Schulterzucken begegnen zu können.
Am Universitätsplatz stand die 5, blinkte müde in Richtung des orangefarbenen Einsatzwagens der Magdeburger Verkehrbetriebe, ein lautloser Hilferuf, dem keine Hilfe folgte. Schon minutenlang schien die Bahn hier zu stehen, jede Richtung zu blockieren, ohne daß ein Schaden offensichtlich war. Ich glaubte, eine Oberleitung beschädigt herabhängen gesehen zu haben, doch war mir nicht sicher. Ordnungsgebietend blitzten die Blaulichter zweier Polizeiwagen, doch niemand interessierte sich dafür.
An den Haltestellen, die ich passierte, stauten sich wartenden Menschenhaufen. Niemand hatte ihnen gesagt, was geschehen war, und obwohl sie sehen konnten, daß keine der Bahnen in Sichtweite sich auch nur einen Millimeter rührte, obwohl sie sehen konnten, daß es unwahrscheinlich war, in den nächsten Minuten von der Haltestelle abgeholt zu werden, blieben sie stehen, warteten wie eine verirrte Schafsherde auf ihren Schäfer, der ihnen mitteilte, was zu machen sei.
Doch kein Schäfer kam, und die Schäferhunde - Blaulichtwagen besetzende Polizisten - hielten Informationsweitergabe für überflüssigen Luxus.
Das Gedränge auf dem mit Ständen und Menschen vollgesopften Breiten Weg störte mich nicht, würde doch das Gedränge in den wenigen noch verkehrenden Straßenbahnen um eine Größenordnung stärker sein.
Am Alten Markt angekommen entdeckte ich die 6. 'Meine Bahn!', dachte ich erfreut, nicht zuletzt, weil es so aussah, als würde sie noch fahren können. Überall um mich herum standen leere Bahnen wie abgestorben in ihren Gleisen. Hinzukommende Bahnen wichen in andere Richtungen aus, auf Strecken, die sie sonst nie befuhren, bewirkten, daß die Bewegungsabläufe des öffentlichen Personennahverkehrs aussahen, als wären sie die kranken Gehirn eines Irren entsprungen, von unfähigen Kinderhänden auf Stoffservietten gekrakelt und von blinden Psychopathen realisiert. Doch es funktionierte. Ich sah keinen Autostau, keinen Unfall, keine Verletzten, noch nicht einmal ordnungshütende Uniformierte.
Die 6 stand an der Haltestelle und wartete. Ich wartete ebenfalls. Die Ampel zeigte Rot, und wie bei einem Marathonlauf lauerten mit mir unzählige andere auf den Startschuß, das Ampelgrün, das den Wettlauf einläutete, dessen Ziel die Sicherung eines Platzes im Sardinengedränge, im Inneren der Straßenbahn, war. Ich positionierte mich günstig, war schnell, als einer der Ersten, im Inneren, fand einen guten Platz zum Stehen, hielt mich fest.
"Könnten Sie vielleicht...", hörte ich eine alte, brüchige Stimme, deren Besitzerin eine Fahrkarte in meine Richtung hielt.
"Na klar.", meinte ich lächelnd, nahm die Karte in Empfang, wühlte mich durch menschliche Leiber bis zum Entwertungsautomaten, wartete auf das bestätigende Piepen des Stempels, kämpfte mich zurück und überreichte der alten Frau ihre - offensichtlich unnütze [Welcher Kontrolleur würde sich schon durch dieses Gedränge zwängen?] - Fahrkarte, stolz, als hätte ich soeben die hintertibetanischen Dschungelwüsten mit verbundenen Augen durchquert. Sie nickte nur, freundlich und schüchtern zugleich, und ich versuchte, mir meinen Stehplatz zurückzuholen, der jedoch in der Zwischen von Tannengrün besetzt worden war.
Als die Bahn zwei Ampelphasen später losfuhr, atmeten alle Straßenbahnheringe auf. Die Stimmung war gut.
"Wenn Sie fallen, fallen Sie unter Garantie weich.", lachte eine dickte Frau neben mir.
Die nächste Ampel war ein Greuel. Vor uns standen zwei weitere Bahnen, auf Grün wartend, und pro Grün fuhr nur ein Metallkoloß durch. Es dauerte Minuten, bis wir wieder vorankamen - und am "City Carre" hielten. Nur eine Handvoll Menschen stieg aus; doch mindestens zehnmal so viele begehrten Einlaß - unter ihnen auch eine Frau mit Kinderwagen und eine Gruppe Punker, standesgemäß mit Kassettenabspielgerät und Bier beziehungsweise Wein, sowie mehreren riesigen Hunden bestückt, von denen einer allerdings - vermutlich aufgrund einer Verletzung - auf einer Art Bollerwagen Platz genommen hatte, welcher natürlich ebenfalls in unserer vollgestopften Straßenbahn Platz finden sollte.
"Kinderwagen! Kinderwagen!", riefen die Punker, als wollten sie der Mutti mit ihrem Gefährt Zutritt und Platz verschaffen. Doch kaum waren wir noch enger zusammengerückt, drängten sich die vier Gestalten, samt ihrer Hunde und ihres Bollerwagens in die Bahn und sicherten sich damit die ungeäußerte, aber auf vielen Mienen deutlich lesbare Abneigung der anderen Passagiere. Die Mutti paßte nun natürlich nicht mehr hinein. Ihr Kinderwagen ersdt recht nicht.
Interessiert beäugte ich den Penny-Markt-Aufnäher auf einer Lederjacke, der zwischen unzähligen Punkbandemblemen und Antifa-Zeichen eine Besonderheit darstellte. Die Frau neben mir stand auf, und ich konnte mich setzen, trat versehentlich einem schwarzen Hund auf den Schwanz, der gequält winselte, aber meine Entschuldigung - inklusive eines beruhigenden Kopftätschelns - zu akzeptieren schien.
Niemand beschwerte sich, und tatsächlich waren mehrere Zusammengedrängte trotz ihrer Situation freundlich zu den Punkern, gaben den Hunden Platz und akzeptierten, daß eine Tür durch den Bollerwagen versperrt worden war. Als jedoch ein Herr die zurückhaltende Bitte äußerte, den schwarzen Hund, der ihn in einer Ecke einsperrte und somit sein Aussteigen verhindern würde, wegzunehmen, reagierte das einzige Mädel erbost und unwillig, als müßte sie, deren Gruppe erstaunlich viel Toleranz entgegengebracht worden war, immense Aufwände auf sich nehmen, um den armen Hund ein paar Zentimeter zu verrücken, als wäre sie, der es von allen Straßenbahnmitfahrenden noch am besten ging, die einzig Gequälte hier.
Unterdessen unterhielt sich die alte Frau, die ihre Fahrkarte fürsorglich in ihrer Geldbörse verstaut hatte, mit ihrer Nachbarin, einer vielleicht zwanzig Jahre jüngeren Dame, die geduldig jede Frage beantworte und jede Aussage mit nichtssagendem Geplänkel bestätigte. Von der Frage, warum es denn so voll sei, führte die Thematik der alten Frau jedoch über die Feststellung, daß ihr sowieso nur noch wenige Jahre blieben bis hin zu Krankheiten und Tod, bis hin zur Behauptung, daß, wenn man alt und ein wenig wirr wurde, sowieso niemandem mehr für einen da sei, jeder nur die eigene Unwilligkeit mit geheuchelter Anteilnahme überdeckte, um mehr erben zu können.
Das Thema behielt sie bei, ungeachtet der Punkersituation um sie herum, erzählte mit weinerlicher Stimme, was sie wohl schon Tausend Mal erzählt und sich selbst eingeredet hatte. Sie bemitleidete sich selbst, stellte ich fest, und bewunderte die neben ihr Sitzende, die immer wieder zu reagieren vermochte, niemals zu weiteren Aussagen anregte, aber trotzdem den Eindruck erweckte, am Gespräch interessiert zu sein, obgleich auch sie von der Thematik wenig begeistert war. In Gedanken zollte ich ihr meinen Respekt und verlor für kurze Zeit sogar die Punker aus dem Sinn, die sich jedoch alsbald bemerkbar zu machen wußten.
Ein Hund stand an der Straßenkreuzung, die wir soeben passierten, und einer der Punks glaubte in ihm seinen Hund, besser: einen seiner Hunde, erkannt zu haben.
"Halt an!", rief er nach vorne, zum Straßenbahnfahrer, der jedoch unbekümmert sein Gefährt erst mehrere Hundert Meter später zum Stehen brachte - an der dafür vorgesehenen Haltestelle. Ein unscheinbarer Mann drängelte sich aus der blockierten Tür und erwarb so den Ärger der ebenfalls aussteigenden Punks, die sichtlich Mühe hatten, den mit Hund befüllten Bollerwagen aus der Bahn zu hieven. Er kippte; der verletzte Hund fiel auf seine eigenen Beine, winselte, wurde grob von der Straße gezerrt, wieder auf den Bollerwagen gehoben.
Das Fehlen der Punks löste keinerlei Erleichterung aus. Nur ich freute mich, hatte ich doch endlich genug freien Platz um mich herum - zumindest bis zur nächsten Haltestelle, wo ich ausstieg und die abenteuerliche Heimreise beendete.
morast - 2. Dez, 18:59 - Rubrik:
Bahnbegegnungen
Der Straßenbahn entfliehend, in dem stimmenstarke Kinder geräuschintensiv den Namen Benjamin wiederholen [Ich dachte die ganze Zeit an Herrn Blümchen und sein Törööö.] und versuchen, die Lieblingsbonbonsorte kundzugeben, stellte ich fest, daß die Jugendlichen in der nächsten Straßenbahn, die hämisch lachend gemeinsam Verlebtes auswerteten, dabei mehr Sitzplätze als nötig blockierten und eine Aura der Bösartigkeit in die Runde warfen, noch unerträglicher waren als die Kinder, und überlege, ob ich in Begriff bin, zum Misanthrop zu mutieren.
[Erstaunlich, daß das latein-griechische Wort "homophob" nicht die Abneigung/Angst {phobos} Menschen {homo} gegenüber bezeichnet, sondern die Ablehnung von Homosexualität.].
morast - 7. Nov, 15:10 - Rubrik:
Bahnbegegnungen
Als ich heute in der Straßenbahn saß und den Kopfhörerklängen eines mir Unbekannten lauschen mußte, stellte ich mir zwei Fragen:
1. Wie kann ich herausfinden, ob ich meine Sitznachbarn auch derart belästige, wenn ich derjenige mit den Kopfhörern im Ohr bin?
2. Wieviele Lieder von Linkin Park gibt es eigentlich?
Ersteres zu beantworten erschien mir vorerst überflüssig, war doch die zweite Frage die interessantere. Die Diskographie dieser Band behauptet nämlich, es gäbe fünf Alben. 'Das kann nicht sein.', denke ich und lausche der Kopfhörermusik des Unbekannten, jedes einzelne Lied erkennend.
Ich gebe zu, daß auch ich mich im Jahre 2001 von der allgemeinen Linkin-Park-Euphoriewelle tragen ließ und gewisse Begeisterung für diese Band und deren Album "Hybrid Theory" aufbrachte. Als mein Bruder jedoch erwähnte, er habe das Werk gekauft, schüttelte ich ungläubig mit dem Kopf, denn als kaufenswert hatte ich es bei weitem nicht erachtet.
Zwölf Lieder befanden sich auf "Hybrid Theorie" und klangen allesamt ähnlich. 'Nun gut.', dachte ich damals, 'Eine Band sollte einen eigenen Stil haben.' und akzeptierte die Monotonie - schließlich war es eine gute. Eine Ausnahme bildete Titel 10 oder 11, der nur aus Scratchereien bestand, daher anders klang und zum steten Skip-Tasten-Kandidat wurde.
Im Jahr darauf, mein Interesse hatte sich bereits gelegt, brachten Linkin Park ein neues Album heraus. "Neu" war allerdings maßlos übertrieben, begnügten die Musiker sich doch mit albernen und für mich absolut überflüssigen Remixen ihrer bisherigen Stücke.
2003 dann freuten sich alle Musiksender und leierten die aktuelle Single des neuen Linkin-Park-Werks rauf und runter. "Meteora" hieß das gute Stück und kam zu spät, um mich aus meinem Desinteresse zu lösen. 'Die klingen ja immer noch so.', stellte ich unbeteiligt fest.
Das nächste Werk, das noch im selben Jahr folgte, war ein Live-Album. 'Bitte was!?', wunderte ich mich. 'Nach zwei Alben eine Live-CD herauszubringen, ist doch absolut lächerlich!'. Daß auf dem Live-Album nichts Neues auffindbar war, bedarf wohl keiner Erwähnung.
Doch Linkin Park überboten sich selbst in ihrer Lächerlichkeit, holten sich 2004 den Reimesprecher Jay-Z herbei und brachte die alten Lieder noch einmal heraus, geringfügig mit überflüssigem Rap-Gebrabbel modifiziert.
Mittlerweile mag ich Linkin Park nur noch aus einem Grund: Sie lieferten mit ihren beiden, auf fünf Werke gestreckten, abwechslungslos konstant klingenden Alben das Ultimativbeispiel profitabler Eigenwerkaufbereitung, der Optimalvermarktung wiederholten Monotonie-Recyclings.
Mich würde es übrigens nicht überraschen, wenn es sich beim nächsten Album um ein Best-Of handeln würde...
Dann säße ich vergnügt in der Straßenbahn, lauschte den längst bekannten Kopfhörklängen anderer, kramte mein eigenes Musikabspielgerät heraus und schaltete es an, uninteressiert an der Frage, ob ich irgendwen mit meinem Lärm belästigen könnte...
[Im Hintergrund: Deftones - "White Pony"]
morast - 1. Nov, 15:12 - Rubrik:
Bahnbegegnungen
An der Straßenbahnhaltestelle begegnen sich zwei Menschen. Nichts Ungewöhnliches soweit, doch es ist offensichtlich, daß der einen Hälfte der an dieser Begegnung Beteiligten selbige unangenehm ist.
Sie kennen sich, vermute ich, doch nicht gut, gerade gut genug, um über ein Thema reden zu können. Handball. SCM. Bundesliga. Heimspiele. Champions-League.
Person A, er sieht aus wie ein Günther ["Mit T-H, bitte."], trägt eine Brille, die in intelligenter wirken läßt als seine Worte klingen. Er lispelt ein wenig, und seine Kleidung erweckt den Eindruck, daß sie den Körper bedecken, nicht irgendwie aussehen muß. Die braune Cordhose soll mit ihren unzähligen Taschen vielleicht modern sein, deformiert aber Günthers Körper noch mehr als seine graue, stillose Jacke.
Person B, ein forscher Kerl, ich nenne ihn Ralf, freut sich sichtlich über die Begegnung. Seine Stimme ist laut und biergestählt. Die hochgewachsene Gestalt kompensiert die Rettungsringe, die sich unter einer Jeansjacke verstecken. Jeans scheint sowieso das zu sein, was Ralf am liebsten trägt, und betrachtet man seine sportliche Erscheinung, so könnte man meinen, daß das zu ihm paßt.
Ralf ist selbstsicher, er lacht grob, begrüßt den fast eingeschüchterten, mit leiser, sprachfehlergequälten Stimme antwortenden Günther überschwenglich, legt gleich los mit dem Gespräch, dessen Thematik minutenlang in demselben, einseitigen Brei herumdümpelt.
Ralf ist ein begeisterter SCM-Fan, ist mit seinen Kumpels bei jedem Spiel dabei, trinkt dabei gern die Menge Bier, die es braucht, um lauthals seine Meinung in der vollbesetzten Sporthalle kundgeben zu können, wenn der Scheiß-Schiri mal wieder Mist baut.
Günther ist eher der rationale Typ. Er ist zu alt, um sich noch zu ändern, steckt fest in seinem langweiligen Beruf, in seinem sich wiederholenden Tagwerk, das er nun gerade beendet hat, als er Ralf begegnet - ünrigens zum ersten Mal seit langer Zeit, denn außer Handballfreuden teilen die beiden nichts.
Vermutlich wirken bei ihm zwei Bier Wunder, dann läßt er sich gehen, schließt sich Leuten wie Ralf an, brüllt seine Ansichten umher und darf mal kurz alle Bedenken beiseite werfen. Er mag Ralf nicht sonderlich, doch er mag Handball, und er mag es, sich mit Ralfs Kumpanen zu einer Gruppe zugehörig, stark fühlen zu können.
Und weil er in der Halle hin und wieder die Sau rauslassen, sich selbst vergessen, kann, hat er sich eine Jahreskarte besorgt. Denn wie alle gebeutelten Deutschen muß er sparen und hat flink errechnet, daß er, wenn er für jedes Spiel einzeln löhnt, wesentlich mehr zu bezahlen hat als mit einer Jahreskarte.
Günther ist stolz auf seine schlauen Überlegungen, stolz auf seine Jahreskarte, und kann dadurch etwas berichten, das Ralf, der immer alles zu wissen glaubt, noch nicht weiß. Ralf schaut verdutzt und fragt nach dem Preis einer solchen Jahreskarte.
Der stolze Günther, dem Zahlen eigentlich sehr lieb sind, freut sich, die Antwort geben zu können, nennt irgendeine krumme Zahl, die Ralf schnell wieder vergißt. Zu hoch, zu viel Geld, das auf einmal ausgegeben werden müßte.
"Hast du eigentlich 'nen Spielplan?", fragt Ralf, der sich um solche Sachen erst kümmert, wenn sie ihm einfallen. Günther dagegen ist bestens vorbereitet auf die neue Saison, nickt stolz.
"Kannste mir einen mitbringen?", fragt Ralf, der nicht einmal daran denkt, daß es außer Günther sicherlich leichtere Wege gibt, einen Spielplan für seinen Lieblingshandballverein aufzutreiben.
"Nee.", antwortet Günther leise, "Ich hab nur einen."
"Machste mir ne Ablichtung?", fragt Ralf, und es klingt fast wie ein Befehl.
[An dieser Stelle stutze ich. Das Wort "Ablichtung" als Synonym für "Kopie" begegnete mir noch nicht häufig.]
Günther nickt, doch ist verwirrt. Er weiß nicht, wohin er die Kopie schicken soll, will aber sein Unwissen nicht zugeben. Er kennt Ralf doch schon so lange, allerdings ohne zu wissen, wo er wohnt oder wie er heißt.
Doch Ralf hilft ihm aus der Patsche:
"Bringste mir dann mit, die Ablichtung, ja? Beim nächsten Spiel. Wir sehen uns ja dann."
Erleichtert nickt Günther erneut. Kein Ort, keine Uhrzeit ist ausgemacht. Die Bördelandhalle faßt 8.000 Zuschauer, aber Günther weiß, wo er Ralf finden wird. An der Bar, rechts vom Eingang, wie immer. Zusammen mit seinen Kumpels.
Eine Straßenbahn nähert sich.
"Das ist meine.", sagt Günther und deutet auf die Bahn. Ralf nickt, muß in die andere Richtung.
"Wir sehen uns ja dann.", verabschiedet er sich und überquert die Gleise.
Als die Bahn hält, steigt Günther ein, ein wenig zu hastig. Das Gefährt schließt die Türen, bewegt sich, fort von Ralf, der zu laut, zu fröhlich, nüchtern kaum erträglich ist, der alles besser zu wissen glaubt, aber doch nicht recht hat.
Hinter der Straßenbahn wird Ralf kleiner und kleiner, verliert seine Bedeutung. Günther schiebt seine Brille hoch, doch blickt nicht zurück.
Als die Bahn an der nächsten Haltestelle stoppt, steigt er aus und gesellt sich zu einer gesichtslosen Gruppe schweigend Wartender.
[Im Hintergrund: Ensiferum - "Ensiferum"]
morast - 25. Okt, 16:30 - Rubrik:
Bahnbegegnungen
Ich platziere mich rechts, am Fenster, ein Einzelplatz unweit der Tür. Ich liebe es, hier zu sitzen, aus dem Fenster zu starren und die vorbeigleitende Welt zu beobachten. Nicht minder liebe ich es, hier zu sitzen und meine Gedanken zwischen fesselnden Zeilen zu vergraben, hin und wieder aufzusehen und zu befürchten, die Aussteigehaltestelle zu verpassen.
Das Rumpeln der Straßenbahn gefällt mir, ihr schwerfälliges Anfahren, die beängstigenden Geräusche in den Kurven, welche die Frage nach der Sicherheit der Fahrzeuge öffentlichen Personennahverkehrs mit stetiger Aktualität belegen, die Ziehharmonikatüren und der grüne Knopf an der metallenen Außenseite.
Meine Straßenbahn ist fast immer eine alte; ein klobiges Ungetüm, ein ratterndes Monster, das Fahrgäste verschlingt und ausspeit wie schlechte Nahrung. Ich freue mich darüber, mißfallen mir doch die schrillen Tür-Schließ-Warntöne der neueren Bahnen, die schwarz-drohenden Kameraaugen an der Decke, die an der Glastür angebrachten Ein- und Aussteigeknöpfe, deren fehlende Versenkbarkeit immer wieder Unsicherheit aufkommen läßt, ob man sie nun ausreichend intensiv gedrückt habe oder nicht.
Heute sitze ich in einer neuen Bahn. Das Fenster neben mir ist glaskratzerfrei und erlaubt mir einen Blick auf das sonnige Äußere, auf die vorbeischwebenden Menschen und Fahrzeuge. Für einen Augenblick ersehne ich mir ein Buch auf meinen Schoß, doch dann entsinne ich mich der letzten beiden Tagen, in denen ich mich mit nahezu nichts anderem als mit der Lektüre zweier angenehmer Bücher beschäftigt hatte, deren Geschichtenfetzen mir noch immer durch den Kopf wirbeln und das Gefühl hinterlassen, vorläufig lesegesättigt zu sein und alle Eindrücke und Gedanken erst einmal verarbeiten zu müssen.
Links von mir, auf der anderen Seite des schmalen Ganges, befindet sich ein Vierersitz, erstaunlicherweise nicht von einer Omi und zwei Taschen, sondern tatsächlich von vier Personen besetzt, deren geschätztes Alter ich in den Sechziger-Bereich einordnen würde, sollte mich jemand danach fragen.
Die Vier unterhalten sich. Eine Frau bemängelt die Straßenbahnunpünktlichkeit und die daraus entstehenden Umsteigeprobleme, die ein wiederholtes Zuspätkommen verursachten und auch nicht durch das Nutzen einer früheren Bahn ausgeglichen werden können, da die bisher genutzte die erste am Morgen darstellt [Die schreckliche Vorstellung nachts um Fünf zur Arbeit fahren zu müssen, lasse ich nicht in meine Gedanken eindringen.]. Das Gespräch schweift ab, ich lausche dem unangenehmen Fiepgeräusch, das mit jedem Brems- und Anfahrvorgang entsteht, lenke all meine Sinne in Richtung des Magdeburger Außen, das allein durch die stete Eigenbewegung der Bahn interessant zu sein scheint.
'Bewegte Bilder fesseln.', überlege ich, 'Egal, wie sinnentleert sie sind.'
"Sie können es ruhig glauben.", vernehme ich links von mir. Die andere Frau auf dem Viererplatz hat das Wort ergriffen. Ich sehe nicht viel von ihr; nur ihr strohblond gefärbtes Haar lugt hinter dem fetten Gesicht ihres Nebenmannes hervor.
Doch ihre Stimme ist gut hörbar - sicherlich auch für den Rest der Straßenbahninsassen - und berichtet Nachdenkenswertes.
"Glauben Sie mir,", wiederholt sie, "ich habe noch nie in meinem Leben ein einziges Buch gelesen."
Am liebsten wäre ich an dieser Stelle verblüfft verstummt, doch schwieg ich bereits. Im Kopf wimmeln Assoziationen zu den beiden Büchern der vergangenen Tage herum, und ich frage mich kurz und ohne wirkliches Interesse, wieviele Bücher ich in meinem Leben bereits las, ja, wieviele ich davon doppelt genoß.
"Ich habe es probiert, wissen Sie. In der Schule mußten wir ja lesen, doch konnte mich immer drücken."
"Sie liest ja.", weiß ihr Mann mit dem Fettgesicht zu ergänzen. "Aber eben keine Bücher."
"Das glauben Sie nicht, oder? Nicht ein einziges Buch habe ich bisher gelesen. Einmal wünschte ich es mir, hier, dieses Buch von dem Süß... Südmann, «Das Parfüm», Sie wissen schon, dieser Süskind oder wie der heißt, das habe ich mir wirklich gewünscht. Ich habe es wirklich probiert, ich wollte es ja lesen. Doch ich habe es angefangen und dann weggelegt, auf meinen Nachttisch, da lag es dann wochenlang, ohne daß ich es anrührte.
Nicht ein einziges Buch habe ich bisher gelesen."
Ihre Begleiter schweigen, und ich frage mich, ob ich ihr nicht ein gutes, leichtes Buch empfehlen sollte, etwas, das fesselnd und anspruchslos zugleich ist. Karl Mays "Winnetou" fällt mir ein, Gerd Prokops "Detektiv Pinky" und noch ein paar andere Werke, die ich als Kind verschlungen hatte. Ich beschließe zu schweigen und recke meine Lauscher noch einmal in Richtung der Leseunwilligen.
"Nicht ein einziges Buch.", wiederholt sie gerade. Ungläubig wende ich mich ab und starre abwesend auf die bewegten Bilder hinter der Scheibe.
[Im Hintergrund: EverEve - "The more she knows"]
morast - 14. Okt, 12:45 - Rubrik:
Bahnbegegnungen
In der Straßenbahn haben sich mehrere Kinder versammelt. Ihr Alter zu schätzen, fällt mir schwer, doch offensichtlich kommen sie gerade von der Schule und befinden sich auf dem Heimweg.
Ein Junge liest ein Zettelchen vor, das sie sich während des Unterrichts schrieben.
"Griechenland ist blöd. Aber Mandy ist noch viel blöder."
Ungefähr 80 Prozent des weiteren Inhalts besteht aus dem Satz "Mandy ist doof."
Währenddessen klaut ein anderer Junge einem dunkelhaarigen Mädchen einen Ball.
"Gib den Ball wieder her.", schreit sie, zugleich erzürnt und belustigt, "Sonst bring ich dich um."
Der Junge reagiert nicht, und läßt sich selbst, als sie sich von ihrem Platz erhebt, zu ihm eilt und versucht, den Ball seinen Händen zu entwinden, nicht beeindrucken.
"Gib den Ball wieder her.", wiederholt das Mädchen, "Sonst verliebt sich Maria wieder in dich."
"Mir doch egal.", meint der Balldieb achselzuckend.
'Was für eine Drohung!', denke ich belustigt.
morast - 1. Sep, 15:39 - Rubrik:
Bahnbegegnungen
In die Regionalbahn von Halle nach Magdeburg steigen zwei junge Männer, vielleicht 20 Jahre alt, zu. Sie tragen verschmutzte Blaumänner und schieben prollige Mountainbikes. Kaum haben sie ihr Räder vertäut und Platz genommen, zücken sie ihre Handys, klobige, grellbunte Geräte, die anscheinend dem neuesten Stand der Technik entsprechen.
'Poser.', denke ich, doch betrachte neugierig ihre Aktivitäten. Diese beschränken sich allerdings auf nur eines: Auf den Austausch von Handy-Klingeltönen. Axel F, Tweety, Tweety Remix und der ganze andere Schwachsinn, den Musiksenderwerbepausen den Fernsehenden penetrant aufzuschwatzen versuchen.
Immer wieder vernehme ich qualitativ minderwertige, von Rauschen überzogene Geräusche, bekannte Melodien oder niveaulose Texte anspielend, offensichtlich auf lustig getrimmt, aber eigentlich nur anstrengend und spätestens nach dem zweiten Hören zu angewiderter Ignoranz führend.
"Schade, daß man das nicht auch als Weckton verwenden kann.", meint der eine Blaumannproll.
"Stimmt."
Soviel zu der Frage, wer den ganzen nervigen Dreckmist überhaupt haben will.
morast - 5. Aug, 12:28 - Rubrik:
Bahnbegegnungen