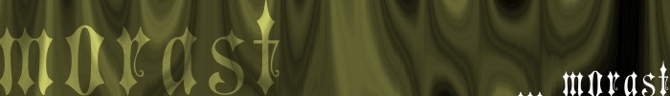Geistgedanken
Und dann die Erinnerung. Daran, dass wir dir alles durchgehen ließen, damals, als du endlich genesen warst, als du dich befreit hattest. Wir trauten uns selber nicht, trauten nicht deiner Stärke und hofften doch. Verzweifelt und erleichtert flüchteten wir in den einzig verbliebenen Weg: Die Hoffnung, dass es gelungen war, ein kleines Allesistgut heraufzubeschwören, darauf, dass Angst und Heimlichkeiten, dass Lügen und Sorgen weniger werden, dass wir nicht länger an dir vorbeisehen, darauf, dass nicht länger Trauer und Mitleid unsere Blicke füllen würden.
Ich erinnere mich. Wie wir Schach spielten. Wie ich dich mehrfach besiegte, aber im Augenblick des Verlierens deine überwältigende Begeisterung zu tragen bereit war. Wie ich plötzlich, mittendrin, begriff, erkannte, wie wach dein Geist stets gewesen war, welche Intelligenz in dir schlummerte, wieviel Witz und Wissen all die Jahre unter tumbem Nebel begraben gewesen war. Ich hatte mich an dich gewöhnt, an dein Siechen, den physischen Abstieg, der den psychischen mit sich zog, an den Teufelskreis, den zu brechen wir niemals ernsthaft versucht hatten. Ich hatte dich eines Tages in dein Bett getragen, ich, schmächtig, muskelarm, dich, ein Vorbild, Hort meines Respekts, und etwas war in mir zerbrochen. Etwas, vielleicht alles.
Doch ich erinnere mich an den Funken. Daran, dass ich ihn bemerkte, dass er mich jäh überraschte und mich fassungslosem Staunen aussetzte. Daran, dass ich einen Augenblick lang begriff, wer du gewesen warst, wer du hättest sein können, was du im Nebel verlorst. Und wie gerne ich es dir gesagt hätte, wie gerne ich meine Freude, meine Begeisterung über deine Rückkehr, über dein Auftauchen, in Worte gepresst und sie dir überreicht hätte. Doch ich konnte nicht, wagte es nicht, zu groß war mein Respekt vor dir, deinem Handeln, zu riesig die Furcht vor deiner Zerbrechlichkeit, vor einer Änderung des plötzlich Bestehenden.
Wir ließen dich gewähren. Warum sollten wir nicht? Was schadete schon Schokolade in Anbetracht der bereits erfahrenen Schäden, in Anbetracht der Spuren, die Vergangenheit und Nebel auf dir hinterlassen hatten? Froh waren wir, entdeckten wir Begeisterung in deinen Augen, und nur zu gerne folgten wir ihr, war sie auch noch so unnütz und unsinnig. Begeisterung hieß Leben. Leben hieß Rückkehr. Zu uns. In die Wirklichkeit. Kauf doch Musik, die du nie zuvor hörtest, kauf doch eine Wohnzimmeruhr, die niemanden außer dich wirklich interessierte, kauf doch. Denn jeder Erwerb war ein Stück Echtheit, das du dir suchtest, ein Stück Dasein, das dir gehörte, das du umklammern konntest, falls irgendwann nichts mehr verblieb, das dir noch Halt gab.
Wir versuchten es, versuchten Halt zu sein, Antrieb und Begegnung, doch wir versagten, scheiterten an dir, der du dich noch immer verschlossen zeigtest, noch immer nicht imstande schien, sein Befinden zu offenbaren. Hin und wieder entsprang dir jener begeisterte Funke, der von uns gierig aufgesogen, gewürdigt, wurde, doch war er nur winziger Teil deiner Selbst, das uns wohl ewig ein Rätsel bleiben wird. Ich versuchte, zaghaft nur, dich zur Öffnung zu bewegen, dich mit Interessen zu benetzen, dir das Gefühl zu schenken, in dieser Welt noch immer, nach all den Jahren, willkommen zu sein, versuchte, dich inmitten des weichenden Nebels zu finden, wiederzuentdecken, doch versagte.
Ich erinnere mich, dass ich mich fragte, wo all deine Freunde waren, wie du mit all der Monotonie umgehen würdest, erinnere mich an meine Angst, an meine nie endende Angst davor, dich in alten Formen wiederzufinden, wieder derjenige sein zu müssen, der dich ins Bett trägt. Als es so weit war, als der Nebel dich erneut gefunden hatte, war niemand überrascht. Wir sahen wieder weg, und irgendwie war ich noch immer imstande zu glauben, dass du den Weg zurück finden würdest, war imstande zu hoffen, zu hoffen, mich in Blindheit zu hüllen und zu hoffen.
Es gab keinen Weg zurück. Keinen Weg nach vorne. Du verließest alle Wege, ließest uns zurück, uns und eine Uhr, die im Wohnzimmer steht und Zeit vergehen lässt. Und die Erinnerung an Schokolade, an Herrenschokolade, die du mochtest, an Salmiakpastillen, die du mochtest, aber das war vorher, an dich auf dem Balkon rauchend, an dich vor den Kinderzimmern stehend, es mit Zigarette nicht betreten wollend, an dich, dessen Krankheit so viele Bilder in meinem Kopf bedecken, an ein Schachspiel, das ich verlor und einen Funken, den ich fand.
Ich erinnere mich.
morast - 19. Jan, 09:25 - Rubrik:
Geistgedanken
ich vermisse dich.
nicht dich, die jemals existierte, sondern dich, die du traumbild bist, wunschbild, sehnsucht abseits aller realitäten, abseits aller möglichkeiten. ich vermisse dich, vermisse den trost, den du mir schenkst, die intensität, mit der sich deine nähe zeigt. ich vermisse dein lächeln, das mich dazu bringt, mich wieder und wieder in dich zu verlieben, vermisse deine hauchzarte berührung, das einander finden, die bedeutung, die in diesem fast nur erahnbaren kontakt innewohnt, das wissen, das diese berührung mit sich bringt. ich vermisse dich, vermisse dich, als wärest du teil von mir, teil meines daseins, vermisse dich, als hätte ich dich nicht nur ersonnen, als erfülltest du nicht ideale, nicht gedanken, sondern als wärest du hier gewesen, eben noch, vor kurzem, als röchen die laken nach dir, als fände ich irgendwo hier eine spur von dir, einen beweis dessen, dass du hier verweiltest, dass du mich zurückließest mit der erinnerung, gefangen in meinem kopf und dieser lächerlich belanglosen spur. ich vermisse dich, als könnte ich auf dich warten, hier ausharren, bis du zurückkehrst, bis du mich entdeckst, lächelnd, voller liebe. ich vermisse dich, vielleicht weil du auch vergangenheit bist, weil du teile des gewesenen zusammenfügst, tatsächliches mit träumen kombinierst, zu einem gewebe verdichtest, das mich fast weinen, fast lachen lässt, das dich malt, wie du niemals sein wirst, niemals, niemals, niemals. und in meinem kopf erwachen bilder von vergangenheiten, von momenten, die zu schön waren, als dass ich mich ihrer ständig erinnern könnte, von momenten, die bedeutung besitzen. und selbst wenn die bedeutung ursprünglich abseits deiner existenz stattfand, so ist sie nun mit dir verknüpft, schönheit mit schönheit, erinnerung mit erinnerung, träumen mit träumen. ich vermisse dich, meine liebe, vermisse dich, und obgleich ich dich niemals halten, niemals finden werde, bin ich doch bereit, dich zu suchen, dich in täglichen begegnungen zu erahnen, teile deines daseins in anderen zu erkennen und mich in dich, in sie, zu verlieben. und, trotz allem, bin ich nicht gewillt aufzugeben, nicht gewillt, die hoffnung sterben zu lassen. vielleicht, vielleicht finde ich dich ja doch. irgendwann. irgendwo.
morast - 12. Nov, 21:24 - Rubrik:
Geistgedanken
Ich stand still, wie so oft. Alle Wege schienen vor meinen Füßen zu bersten, und es spielte keine Rolle, in welche Richtung ich mich begab. Die Suche hatte ich vor Äonen unter einem Berg des Lächelns begraben, denn auch sie spielte keine Rolle. Glaubte ich.
Wie leicht es fällt, sich auszugraben, denke ich, kurz nachdem ich dem Finden begegnete, kurz nachdem es mich überraschte, auf falschem Fuß erwischte. Nicht jetzt, will ich noch rufen, doch ist es zu spät. Ich lächle bereits.
morast - 14. Sep, 01:28 - Rubrik:
Geistgedanken
Ich hatte dich nicht hier vermutet. Nicht in diesen Momenten. Nicht hier in meinem Kopf. Ich lächle dir zu, als du dich langsam der Blässe entziehst, als dein Leib sich trotz aller Unbestimmbarkeit zu manifestieren beginnt, meinen Erinnerungen entgleitet und zu einem Gedanken wird. Ich hatte dich nicht hier vermutet, nicht inmitten meiner Flüchte, nicht in diesen Tagen, da ich kaum imstande bin, einen eigenen Atemzug zu ergattern. Ich hatte dich nicht erwartet. Ich weiß, flüsterst du, flüstere ich mit deiner Stimme, mit deinen Worten, und ich halte mich an dir fest, als hätte ich dich nie verloren. Bleib!, wünsche ich mir. Bleib!, hauche ich dir entgegen, als du erneut verblasst.
morast - 9. Sep, 02:35 - Rubrik:
Geistgedanken
Regen!, denke ich, doch es regnet nicht. Ich wünsche es mir, erhoffe, dass sich der Himmel erbricht, dass schweres, kaltes Nass auf mich niederstürzt, um mich zu betäuben, alle Sinne zu lähmen - und mich zugleich aufzuwecken, der Lethargie zu entreißen, diesem Nebel, der mich umgibt. Ich wünsche mir, dass es regnet, damit auch ich regnen, weinen darf, verborgen unter feuchten Fäden dem Druck auf meiner Brust nachgeben darf.
Ich hocke kraftlos auf dem Boden irgendeines Hauseingangs, kalt und hart grüßt die Wirklichkeit unter mir, lenkt mich ab, für einen Augenblick lang fort von mir selbst, ich ziehe meinen Rucksack herbei, schiebe ihn unter mich, suche den Gedanken, den ich vorhin verlor, finde ihn nicht wieder, nur eine wirre Masse aus Trübsal, der ich nicht nachgehen, die ich nicht hinterfragen möchte, aus Angst, Antworten zu finden, aus Angst, keine Antworten entdecken zu können.
Ich darf nicht weinen, flüstere ich tonlos, halte zurück, was sich freikämpft, was die Kehle verkloßt, was mich menschlich machen würde in den Augen derer, die wieder und wieder den Eingang betreten, mich mit verwunderten Mienen mustern, als gäbe es keinen Grund hier, auf dem kalten Boden zu sitzen und gegen den Nebel zu kämpfen, der grundlos das Gemüt verschlang.
Ich stehe auf, trete ins Freie und suche den Regen in grauen Wolken. Ich warte auf dich, denke ich, und betrete die Wirklichkeit.
morast - 29. Jun, 13:14 - Rubrik:
Geistgedanken
Und als ich dich sehe, wie dein blaues Fahrrad zusammen mit dir den Hügel hinabrauscht, wie der Frühlingswind deine Haare zerzaust, wie du dich umwendest, mit glitzernden Augen zu mir zurückblickst, als ich sehe, wie du vor Vergnügen lachst - da begreife ich beglückt, daß ich mich in jeder vergehenden Sekunde erneut in dich verlieben werde...
morast - 27. Mär, 23:40 - Rubrik:
Geistgedanken
Und dann das Gefühl heimzukehren. Nicht, daß sich seit meiner Abwesenheit etwas geändert hätte - schließlich vergingen gerade einmal fünf Tage, seitdem ich die wohnungsgemeinschaftliche Tür hinter mir schloß, um erneut, ein letztes Mal, in ferne Welten, in Arbeitsleben und Müssen, aufzubrechen.
Und dennoch wirkt alles neu, anders - unvertraut und heimelig zugleich. Ein Anfang wartet auf mich, eine kleine, meine, bessere Welt vielleicht. Zunächst jedoch eine begeisterte Umarmung und ein Lächeln der Zuversicht auf meinem Gesicht.
Das Wochenende füllt sich selbst. Kisten harren ihrer Entleerung, das neue Leben, das dem alten nicht gleichen soll, muß eingeweiht und beordnet werden. Der neue Schreibtisch, doppelmeterlang, lockt zur kreativen Tat, doch zunächst soll das Nötige vollbracht, Unrat beseitigt werden.
Schwer fällt es, den unzähligen Vergangenheiten zu begegnen. Überall verstecken sie sich, auf winzigen Zettelchen, in kaum lesbaren Worten, in Skizzen und nutzlosen Gegenständen, die wegzuwerfen ich nicht über das Herz bringe. Ich erinnere mich, entsinne mich meiner, zuweilen lächelnd, sehnsüchtig, zuweilen mit dem Unglauben desjenigen, der sich im Spiegel nicht wiederzuerkennen vermag.
Mit eifrigen Händen sortiere ich Vergangenheiten und Zukünfte, während mir die Gegenwart einen Kuß zuflüstert.
Die Heimat, überlege ich, blieb vielleicht dieselbe. Doch ich bin es nicht länger.
morast - 18. Mär, 13:24 - Rubrik:
Geistgedanken
Mir mißfällt derartiges Denken. Insbesondere an mir selber. Fragte ich mich nach dem Grund, so antwortete ich wahrscheinlich, daß vorausschauendes, Zukunft organisierendes Denken nicht meinem Naturell entspräche, ja daß bereits Schwärme allergischer Verpustelungen über mein schwerstes Organ krauchen, sobald ich ein Wort wie "Planung" nur in den Mund nehme. Und um mich mit ebenjener Behauptung nicht in ungünstiges Licht zu rücken, würde ich relativierend ergänzen, daß ein auf die Zukunft orientiertes Denken die Gegenwart, den Moment, vernachlässige, und daß ich mich bemühe, jeden Augenblick als kostbar zu begreifen. Doch das klingt ausgelutscht und kitschig und erinnert mich dessen, daß ich zu früheren Zeitpunkten argumentierte, daß ein Augenblick viel zu kurz sei, um ihn fassen oder gar nutzen zu können, daß also so etwas wie eine Gegenwart gar nicht existiert. Bedenkt man zusätzlich, daß das Zukünftige noch ungelebt durch das All dümpelt, bleibt uns nur die Vergangenheit, welche die bedeutsamsten Teile des eigenen Daseins befüllt.
Doch ich schweife ab, stehe noch immer hier und versuche zu er- und begründen, warum es mir mißfällt, abwartend zukünftigen Tagen entgegenzusehen - je nach anstehendem Ereignis mit lachendem oder weinendem Auge [oder natürlich mit beidem]. Ich zögere, mir einzugestehen, daß die Komponenten Trägheit und Entscheidungsunfreudigkeit ihre fauligen Pranken im Spiel haben könnten, daß mein gepriesenes Augenblick-Leben mit weniger positiv attributierten Argumenten einhergehen könnte. Dann raffe ich mich auf und gestehe, daß es mir zusagt, Entscheidungen erst im letzten Augenblick zu fällen, doch begründe jenes - bevor diese Negativeigenschaft meine güldene Aura zu verdunkeln beginnt - mit dem Wunsch, mir jede Möglichkeit, jeden Weg, bis zuletzt offenhalten zu wollen, als liefen unzählige Fäden durch meine Hände, denen es nur eines kräftigen Rucks bedürfte, um Alternativen aufzuzeigen und begehbar zu machen. Daß sich durch das Warten bis zum Letzten von selbst Pforten verschließen, verschweige ich mir.
Mein Naturell - es bedarf keiner Begründung. Ich winke selbstironisch schmunzelnd ab. Der Künstler in mir formt diese affektierte Gebärde, der Auf-Dem-Boden-Gebliebene lacht darüber.
Wahrlich, es bedarf keiner Begründung, keiner Verteidigung. Doch nicht, weil richtig ist, wie ich bin, sondern weil ich derzeit nicht zu sein vermag, was jenes Naturell mir auferlegt. Denn ich plane, organisiere, berechne im Voraus, erwarte zukünftige Stunden und Tage mit Sehnsucht und fürchte wieder andere mit ängstlich abgewandtem Blick. [Immerhin: Der Blick zeigt zum Moment, das Kommende nicht wahrhaben wollend, das Jetzt genießend.] Die letzten und die nächsten Tage, die letzten und die nächsten Wochen, ja Monate, sie waren und sind angefüllt mit Voraussicht, mit zögernder, nicht weiser, mit unwilliger, doch nötiger.
Und wo ich eben noch mein planungsunfreudiges Naturell pries, sehe ich mich nun als eifriger Rechner Kleinstes und Größtes vorauskalkulieren, sehe mich den Zwängen beugend die Zukunft greifen - obgleich sie nach wie vor und immer ungreifbar in der Ferne schlummert, nur Vages von sich zeigt, nur Silhouetten, die mir genügen müssen in meinem auferlegten Planen. "Dein Naturell verdirbt!", wirft da ein aufmerksamer Sorgender ein und bringt zur Sprache, was wahr ist: So unklar ich auch formulierte, das Zukünftige behagt mir nicht. Ich führe längst kein Leben mehr, sehe mich degradiert auf Momente der Ruhe zwischendrin, auf Augenblicke im Schweben, in denen ich die Welten des Jetzt aus meinem Schädel zu bannen trachte.
Ich zähle verbleibende Stunden, ja Minuten, zerstückle die Zeit und werfe sie dem Nichts zum Fraß vor. Tage mutieren zu Folter und Erlösung. Gedanken kreisen wie Aasgeier um Kommendes, auf daß seine Kadaverfetzen meinen Leib bedecken mögen.
Ich verliere mich, und wenn ich daherkäme und mich fragte, warum es mir mißfällt, Tage zu zählen, bis Ereignisse beginnen oder enden, dann zeigte ich auf mich, auf die Ringe unter meinen Augen, auf die Tage, die ich mit Existenz fülle, ohne mir ihrer bewußt zu sein, auf das Verlangen nach dem Schweben, nach dem Mittendrin, nach einer Pause, die mich erhellt und mir für einen winzigen Zeitbruchteil mein Naturell zurückgibt.
morast - 11. Jan, 20:08 - Rubrik:
Geistgedanken
Now I Walk alone
Naked to the bone
My heart has fled far from me
Until another day
I find the one
Who looks beyond the eyes in me
My Dying Bride - "The Deepest Of All Hearts"
Früher war ich der Ansicht, Menschen trügen immerfort Masken, hinter denen sie ihr wahres Ich verstecken. Ich glaubte, daß jede Begegnung mit anderen ausreiche, um sich selbst mit einer Maske bedecken zu wollen, sei es aus Anpassungsgründen, um Gefallen erregen, Sympathien gewinnen zu wollen, sei es, um nach außen hin jemanden darzustellen, der imposanter, beeindruckender ist als das wahre Ich oder sei es, um sich selbst zu schützen, abzugrenzen, die Welt außen vor zu halten. Der Mensch trägt Masken, die wie Zwiebelschalen sein wahres Ich verbergen, glaubte ich zu wissen.
Ich selbst neigte eher dazu, mich zu schützen. Schwarz bedeckte meinen Leib, und ich floh zu gerne nach Innen, um inmitten von Menschen das Alleinsein zu suchen. Ich baute Mauern und erwartete den Tag, an dem jemand käme, um sie einzureißen, um die lächerliche Fassade, hinter der ich mich versteckte, zu durchschauen, jemand, den [eigentlich: die] mein Äußeres, meine Maskerade nicht interessierte, die das wahre Ich hinter all den Zwiebelschalen zu suchen bereit war, ein Ich, das vielleicht noch nicht einmal ich selbst wirklich kannte.
Ich glaubte fest daran, daß es Situationen gibt, in denen es keiner Masken bedarf, Menschen, bei denen jeder Schutz, jedes Nicht-Ich, unnötig wäre, hoffte, einen solchen Menschen zu finden, der das wahre Ich schätzen würde, so sehr, daß es mir tatsächlich gelingen könnte, ich selbst zu sein.
Die Theorie der Masken, die sich zwiebelschalengleich um das eigentliche, zu erkennende Ich legen, verwarf ich längst, obgleich ich sie nie für falsch hielt. Nur für unzureichend, ungenau.
Versuche ich heute, ähnlich zu denken, so frage ich mich zunächst, ob die Vorstellung eines "wahren Ich" nicht albern ist. Doch das ist sie nicht; vermutlich ist dieses Ich inkonstant und schwammig, aber es existiert. Jedoch verbirgt es sich nicht irgendwo in den Tiefen des eigenen Seins, sondern ist stetig vorhanden, pulsiert an der Oberfläche des eigenen Tun und Handelns, des Denkens und Redens, ist stetig präsent - wenn auch nur in Stücken.
Ich gelangte zu Ansicht, daß die Masken existieren, daß man aus diversen Gründen dazu gezwungen ist, Masken zu tragen, sich zu verstellen - oder freiwillig sich selbst entfremdet. Aber all dieses angebliche Nicht-Ich-Sein gehört zum wahren Ich, alle Masken in ihrer Gesamtheit bilden einen Teil des Ich, vielleicht sogar einen großen.
Sich zu verstellen bedeutet also noch immer, Ich zu sein, zeigt man doch durch die Maskerade einen Teil seiner Selbst, und sei es nur den, der sich gern maskiert. Sich zu entfremden ist demnach nicht möglich; man trägt nur Teile des Ichs nach außen, die in ihrer Gesamtheit vielleicht schon erahnen lassen, was sich hinter den Masken, hinter den durchaus existenten Zwiebelschalen verbirgt. Zu versuchen, alle Mauern zu durchbrechen, hinter die Augen zu schauen, ist demnach nicht von oberster Priorität; zuweilen reicht schon das Betrachten der Mauern allein, um einschätzen zu können, wie das dahinter versteckte Gebäude beschaffen ist.
Die Konsequenz aus diesem Denken ist eindeutig: Ich bin Ich, egal, was ich tue.
Mit dem Einverleiben der Masken in das Ich fand ich einen Teil meiner selbst, erkannte das, was ich bin und tat, wie ich mich nach außen hin gab, wie ich redete und dachte, an und begriff auch, welche Wirkung diese Maskerade, hinter der ich auf Entdeckung wartete, entfaltete. Meine Maskerade ist ein Teil von mir, begriff ich, und begann, Mauern abzubauen. Nicht alle, bedarf es noch eines ausreichend großen Abstandes zwischen mir und der Welt, um flüchten zu können, doch genug, um mich selbst zu erleben, wie ich gesehen, akzeptiert, verachtet und betrachtet werde.
Das Spiegelbild meiner Selbst in den Augen anderer hatte mich immer erschreckt, weil sie nur die Masken zu sehen imstande gewesen waren. Es erschreckt mich noch heute, wenn die Blicke abgleiten und nicht sehen wollen, was unter der ersten Zwiebelschicht liegt. Doch mittlerweile bin ich imstande zu begreifen und zu akzeptieren, welches Bild ich in die Welt werfe, bin imstande es zu ändern, zu formen, je nachdem, welchen Eindruck ich zu hinterlassen wünsche, bin imstande, Mauern, meine Mauern, selber einzureißen, mich dem Sein zu öffnen, anstatt auf es irgendwo in meinen Tiefen zu warten.
Sehe ich andere, mich Interessierende, will ich mehr erkennen als nur das Stück Mauer, das vor mir liegt. ich möchte ringsumgehen, betrachten, tiefer blicken. Andere sind auch nur sie selbst, selbst wenn sie sich verleugnen.
Der Blick auf die Mauer reicht niemals, um den Menschen, das wahre Ich, vollständig zu erfassen, doch vielleicht reichen dafür auch nicht Jahre intimster Anteilnahme. Bedenke ich, welche Facetten zu zeigen ich imstande bin, versuche ich zu erfassen, welche Seiten es an mir gibt, die ich mag oder nicht mag, die ich zu wenig oder zu gut kenne, fällt es leicht zu akzeptieren, daß das Außen nur ein Teil des Innen ist, vielleicht nicht der größte, bedeutsamste Teil, doch ein Teil, der Aufschluß zu geben vermag, der bereits zu verraten imstande ist, ob hinter den Mauern ein Ich wartet, das zu entdecken sich lohnt.
[Im Hintergrund: Agalloch - "Ashes Against The Grain"]morast - 21. Aug, 12:01 - Rubrik:
Geistgedanken
Ich sehe nicht, was meine Augen mir zeigen, erblinde beim Anblick der Straßen, Menschen, Gebäude um mich herum, lächle in mich hinein, als gäbe es nur den Mikrokosmos meiner Gedanken, nein: meiner Gefühle. Ich erahne, daß die Außenwelt mich erreicht, mich berührt, mich zu berühren hat, notwendig ist: Es bedarf der nächtlichen Finsternis, durch künstliches Licht zu halbem Dunkel geschmälert; es bedarf der Lärmlosigkeit, des Halbschweigens der Menschmaschinengeräusche; es bedarf der Temperaturen, des kühlen Windhauchs, warm genug, um mich des Sommers zu erinnern, kalt genug, um mich in Wohlbefinden zu suhlen.
Ich bin zufrieden, zufrieden mit dem, was ist, was mich umgibt. Vielleicht, weil ich die Welt vergessen habe, sie zur Randbemerkungen in meinem Lebensroman degradierte; vielleicht, weil ich bemerke, daß sich ein Lächeln in mein Gesicht geschlichen hat; vielleicht, weil ich einen Teil meiner selbst wiederentdeckte, den ich längst vergaß, den zu spüren ich mich nicht mehr zu entsinnen vermocht hatte.
Ich sehne mich, weiß nicht, wonach, weiß nicht, wohin, doch sehne mich, nicht fort, nicht weg, nicht tiefer. Ich suche keine Richtung, suche keinen Weg, sehne mich einfach. Schmerzlos, ungebunden, fast frei. Ich hatte vergessen, daß es sie gibt: die Sehnsucht ohne Pein, positive Sehnsucht nach dem Ungreifbaren, das Lächeln, das sich eigentlich nur nach innen richtet, wenngleich es nach außen hin geheimnisvoll funkelt. Ich hatte vergessen, daß es mich gibt, diesen Teil von mir, den ich immer liebte, genoß, den ich mich in Nächten wie dieser, in anderen Momenten der Stille, hingab, in denen ich badete, als wären sie die wahre Essenz meines Seins, als wären sie der erste Schritt zur Erfüllung des Möglichen. Ich hatte vergessen, wie es sich anfühlt, sich der eigenen Liebe bewußt zu sein, der ungerichteten Liebe, dem überschäumenden Wollen, dem berauchenden Können, dem Sehnen.
Ich entsinne mich deiner, erinnere mich, daß ich in solchen Augenblicken deinen Namen, dein Gesicht heraufzubeschwören, dir zuzulächeln pflegte, in welcher Ferne du auch verweiltest. Ich ließ dich teilhaben an mir, an meiner Sehnsucht, von der ich unendlich viel zu haben schien. In solchen Augenblicken suchte ich dich, fand ich dich, obgleich du niemals davon auch nur ahntest.
Heute schweige ich, verweile, entweiche nicht, suche nicht. Namen- und gesichtslos, frei von Schmerzen, frei vom Jetzt, betrete ich die nächtliche Straße und sonne mich im Halbdunkel, sonne mich in der Sehnsucht, die ich war. Irgendwo am Rande des Horizonts taumeln Menschen ihren Schicksalen davon, doch ich bin längst blind. Wie hatte ich leben können, ohne dieses Leuchten in mir, dieses Erblinden, dieses Sehnen zu vermissen, ohne dieses Lächeln zu erdenken, das nur mich zu finden weiß? Ich entsinne mich, irgendwann deinen Namen gerufen zu haben, immer wieder, als hätte er meine Sehnsucht mit sich getragen, meinen Traumwandel, irgendwo zwischen Horizont und mir, entsinne mich, alte Worte, alte Bilder getrunken zu haben, als könnte ich dem süßen Geschmack des Gestern seine Bitterkeit entreißen. Ich entsinne mich deiner, als Fluchtpunkt, als unberührbarer Halt.
Heute jedoch ist es anders, bin ich anders. Ich flüstere wortlose Silben, lächle mir entgegen und tanze, bewegungslos schweigend. Ich bin hier, denke ich zufrieden und tauche tiefer in meine Sehnsucht.
morast - 13. Aug, 23:27 - Rubrik:
Geistgedanken