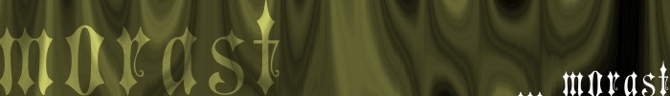Geistgedanken
Die bedrückende Überlegung, zu einem Klischee mutiert zu sein, Zusehen-und-Meckern anstelle notwendigen Aktionismus', läßt in mir die Frage reifen, ob es notwendig ist, Dingen, die mir miß- oder auffallen, in Richtung Besserung nachzuhelfen, wenn sich trotz mehrmaliger Versuche anderer keine solche einstellt, und ob ich mich bei Nichttat hinter einer regionalen Zuständigkeitsmauer ["Darum brauch ich mich nicht kümmern. Gehört ja nicht mir. Irgendwer wird schon zuständig sein."] verstecke, um aus meinem Schlupfwinkel heraus zusätzliche Beobachtungen durchzuführen und weiterhin Kritikworte zu formulieren. Die Alternative, ungehemmte Tat allen offensichtlich-fadenscheinigen Widrigkeiten zum Trotz, lockt natürlich nicht; Arbeit steckt in ihr und die Gefahr, beim Einrennen der Zuständigkeitsmauer irgendjemandem Mauersteine vor dessen Revierdenken zu schleudern und entsprechenden Unmut zu erwirken. Und dann die allseits beliebte "Ich kann mich doch nicht um alles kümmern."-Formulierung auf dein eigenen Lippen zu finden und sich zu fragen, ob sie nicht auch auf den Lippen anderer, bisher mit Mißtrauen Betrachteter Klischeeverkörperer liegt. Die Alternative zwischen Tun und Nichtstun liegt eindeutig im Nichtstun, denn die Überlegung, welche Aktivität wohl die geeignete sei, führt zur Inaktivität, hinter der zu verstecken sich lohnt. Vermutlich sollte ich, um künftiger Untätigkeitskritik aus dem Weg zu gehen, meine amüsierten Beobachtungsbeschreibungen einstellen und die Augen verschließen vor dem, was niemand sehen will. Und wieder ein Klischee: Anstatt mehr Energie in Analysen als in Maßnahmen zu stopfen einer gesunden Portion Nichtsehen zu frönen, in trauter Zweisamkeit mit der Zuständigkeitsmauer. Vielleicht jedoch ist es notwendig, eben jene Mauer einzurennen, den ersten Stein und weitere zu werfen, auf daß ansteckender Aktionismus die Welt befülle und statt blinder Ignoranz oder lästerndem Gejammer die Umgebungsungutheiten bereinigt werden mögen. Als gutes Beispiel voranzueilen, um durch sichtbare Tat einem positiven Schneeballeffekt zu frönen und zuschauen zu dürfen, wie die Welle des Gutmenschentum die Vorgärten und Kleinkriegsschauplätze überrollt und eine Art Minimalparadies auf Erden kreiert. Doch gute Vorbilder ziehen selten Nachahmer mit sich. Einzig Bewunderer werden kreiert - und jene, die auch im Gutmensch-Sein Negativkritikpotential finden und sich meckernd hinter ihrer persönlichen Zuständigkeitsmauer verbergen. Aktionismus erwartet Belohnung; allein die Tat ist nicht Ruhm genug. Denn allein die Tat gebärt Fragen nach dem Warum [nicht zuletzt betreffend die Zerstörung der eigenen Zuständigkeitsmauer] und die kommende Verantwortung, die Tat wiederholen zu müssen, die eigenen Schultern mit künftiger Verantwortung beladen zu haben, die einst irgendwem anders gehörte. Mit der Last des Müssens bestückt jedoch fehlt dem Aktionismus jeder Reiz; Normalität, nein: Pflicht, wird, was vorher freiwillige Anteilnahme war, bis die Last zur Totalträgheit mutiert und jede Tat blockiert. Das eigene Gutmenschtum schweigt, weil es nach dem Wandel zur Normalität längst keines mehr ist, und schaut desinteressiert zu, wenn der unfreiwillig auferlegten Pflicht alsbald nur unzureichend nachgegangen wird und letztlich das verkümmert, was eigentlich gerettet werden sollte. Doch an der nächsten Ecke wartet schon der nächste Enthusiast darauf, die eigene Zuständigkeitsmauer einzurennen und das Verkümmernde zu bewahren, Aktionismus zu verbreiten und mit der eigenen Gutmenschaktivität den gängigen Klischees zu entfliehen und allen anderen ein leuchtendes, initiierendes Vorbild zu sein...
[Es lebe die Kryptik.]
[Im Hintergrund: Die Apokalyptischen Reiter]
morast - 5. Jul, 11:18 - Rubrik:
Geistgedanken
die frage jedoch ist, ob ich möchte, daß alles so bleibt, wie es ist.
zuerst bin ich versucht, "nein!" auszurufen. und dann. stille. nachdenken.
vieles ist gut. längst nicht alles. doch ich brauche es einfach nur nicht wahrzunehmen, es einfach außerhalb meiner welt passieren, nur das gute zu mir durchdringen zu lassen. und dann.
ich fliehe nicht. ich fliehe, ohne zu fliehen. bleibe stehen. grenze alles aus mir aus, wovor ich fliehen wollen würde. bis ich zuviel ausgefiltert habe, zu viel von mir wegließ. bis ich feststelle: das ist nicht mein leben. das bin nicht ich.
und dann mache ich mich auf und will einen moment lang meine wirklichkeit wahrhaben. sie verbessern. bis ich wieder anfange, die augen zu verschließen. zu fliehen. stehenzubleiben. nicht zu sein.
doch ist es ein nichtleben, das ich bin? eine nichtexistenz?
grenzgänger. ich wandle, tanze, mich zwischen ich und nicht-ich hindurch. gebe mir genug berechtigung, um mich lebend zu heißen. doch nicht genug, um tatsächlich lebend zu sein. das alibi-sein schützt mich vor leben und nichtleben zugleich. schützt mich vor einschlafen und erwachen. schützt mich vor mir un bewahrt mich.
vielleicht IST das alibi gar kein alibi, sondern mein echtes leben, während sich der rest darum gruppiert, rotiert.
doch der weg des alibis ist keiner. er ist nur schöner schein. nur anker. für den augenblick. nicht für die ewigkeit. folge ich ihm, werde ich die sackgasse erkennen, die er ist. die illusion, die er birgt. oder er wird sich verzweigen und letztlich zu dem führen, wovor ich zu fliehen versuche.
ich schließe mich aus. bewußt. ziehe mich zurück. und fühle mich wohl dabei. bis das exil zum gefängnis wird, und der einzige rettungsanker das alibi ist. oder das erwachen. das ich fürchte.
solange das alibi meine augen bedeckt, sehe ich nicht. bin ich zufrieden mit mir selbst. wälze mich im jetzt. ohne zukunft. doch bin ich imstande, dahinter zu blicken, einen flecken wahrheit zu finden, fürchte ich mich, krall ich mich fest. an meiner blindheit.
abseits meiner selbst bin auch nur ich.
der grat ist schmal. die unzufriedenheit [mit mir selbst. der rest ist bedeutungslos.] lauert überall. doch noch kann ich tanzen.
blind.
morast - 2. Jul, 22:25 - Rubrik:
Geistgedanken
Und ich finde mich, auf eiskaltblauen Fliesen hockend, ein Handtuch vor den Mund gepreßt, das meine Schreie fängt. Ich befürchte, mich könnte jemand hören - und wünsche es mir zugleich.
morast - 7. Apr, 11:04 - Rubrik:
Geistgedanken
Ihrer Frage bedarf es nicht. Sie weiß, was ich antworten würde. Ich weiß es ebenso, obgleich ihre Frage unausgesprochen zwischen uns verharrt. Ich weiß, daß ich ausweichen, etwas Beruhigendes, Besänftigendes formulieren würde, um ihr das schlechte Gewissen zu ersparen. Sie weiß, was ich antworten würde, weiß um den Wunsch in meinen Worten, ihr keine Schuld, keine Last aufzubürden, weiß, was hinter dem Ungesagten steht. Sie weiß um mein Empfinden, kennt meine Gedanken zu in diesen Augenblicken, ahnt vielleicht, daß ich auch die ihren kenne.
Die Stille zwischen uns entbehrt jeder Frage. Und doch fehlt keine Antwort.
[Im Hintergrund: Sirenia - "At Sixes And Sevens"]
morast - 21. Jan, 11:52 - Rubrik:
Geistgedanken
Noch immer wach, hoffend, in fremden Gedanken das Echo meiner eigenen zu finden und doch ein Wort, das mich von mir selbst entrückt.
Noch immer wach, versuchend, in fremden Stimmen diejnige zu finden, die jede Einsamkeit betäubt.
Noch immer wach, auf der Suche nach meinem Leben...
morast - 4. Jan, 00:39 - Rubrik:
Geistgedanken
Heute ist wieder einer von diesen Tagen. Ich atme, laufe durch die Wohnung, finde ständig Dinge, mit denen ich mich beschäftigen könnte und andere, die in meinem Leib verschwinden, um Gemüt und Magen zu besänftigen. Tatsächlich kann ich sogar behaupten, Sinnvolles geschaffen, Nützliches bewirkt zu haben. Dennoch fühle ich mich unnütz. Jeder Schritt, den ich gehe, scheint falsch, überflüssig, ziellos, planlos, sinnlos zu sein. Wenn ich versuche, mich zukonzentrieren, höre ich die stetigen Stimmen, die ihren "Du-mußt"-Singsang von sich geben und jede Tat, jede Handbewegung mit zusätzlicher Falschheit bepudern.
'Ich bin nicht hier.', denke ich und wünsche für einen Moment, vor mir selber fliehen zu können. Doch das ist Unsinn. Ich mag mich, ein wenig, mir gefällt, wer ich bin, was ich kann. Aber zuweilen könnte ich mich stundenlang nur für das ohrfeigen, was ich verpaßte, was ich vernachlässigte, vergrub, ignorierte, was ich noch immer verdränge, als gehöre es nicht zu mir zu meinem Leben, als würde es, wenn ich es vergesse, auch aus dem Bewußtsein sämtlicher anderer Menschen verschwinden.
Es gibt Listen. Ich versuche, mich zu kontrollieren, mich überwachen, mich dabei zu ertappen, wie ich mal wieder tagelang hinter unnützen Gedanken herhing, wie ich mich mit fadenscheinigen Beschäftigungen über Wasser hielt und eine Berechtigung zum Dasein erwirke. Ich observiere mich und finde Befriedigung darin, die vielen Häkchen und durchgestrichenen Zeilen zu zählen, die auf meiner Liste von Erfüllung künden - und doch keine Befriedigung verschaffen. Nicht, weil es nicht genug sind. Nein, es sind einfach nicht die richtigen Stellen, nicht die richtigen Worte, vor denen Häkchen gesetzt, die mit schwarzem Fineliner durchgestrichen wurden.
Es ist, als würde ich ein riesiges Puzzle zusammensetzen, aber mich nur um den Hintergrund, den Himmel, die Sonne, das Meer und ferne Bergsilhouetten kümmern, statt das Hauptmotiv, das riesige Schiff im Vordergrund, das mich mit dröhnenden Motoren gen Zukunft tragen soll, zu bearbeiten, als ließe ich es aus, um es für später aufzuheben, für ein Später, das es hoffentlich nie geben wird.
Ich fürchte mich vor diesem Später, weil ich weiß, daß es der Zeitpunkt sein wird, an dem mein Versagen öffentlich wird, an dem ich es mir selbst gegenüber zugeben muß. Das Später ist ein roter Fleck in meinem Auge, der sogar verbleibt, wenn ich die Lider zusammenpresse und mir den entführenden Traumschlaf herbeirufe.
Wenn es nach mir ging, so würde ich dieses Später aus meinem Dasein streichen. Es sollte ein Davor geben und ein Danach, aber kein Mittendrin, keinen Punkt, an dem alles geschieht, keine Realisation meiner Selbst, das die letzten Meter zum Abgrund endlich überwand und nun auf den Sturz wartet.
Ich übertreibe, sicherlich. Doch wenn ich mich betrachte, sehe ich den komischen Kauz, der seit Monaten seine Zeit vertreibt. Nein, er läßt sich auf der Zeit treiben, wartet ab und weiß nicht, worauf. Alles möge in seine Hände fließen, sie sind harrend geöffnet, versuchen, die Chancen zu greifen, doch können es nicht, weil er nicht fähig zu sein scheint, sich selbst zu bewegen, sich zu ihnen hin zu neigen, eigene Schritte in ihre Richtung zu wagen.
Unlängst sah ich mich am Tisch meines Bruders sitzen, in ferner Zukunft. Ein Lockenbart wuchs mir vom Kinn, in dem sich bereits graue Fäden zeigten. Mein Bauch war ein weiches Hüpfkissen für meine Neffen und Nichten, die neugierig zu ihrem wundersamen Onkel aufschauten, wie er da saß, in abgewetzten Klamotten, mit einem selbstironischen Lächeln auf den Lippen, einem leisen Funkeln in den Augen, das nur schwer die Trauer dahinter verbarg. Der Onkel wußte Geschichten zu erzählen, absonderliche Gesichten, die zum Lachen und Staunen einluden. Und manchmal zeichnete er. Ein kleines Tier mit großen Kulleraugen, eine Fledermaus vielleicht oder einen Käfer. Wenn er zeichnete, verwandelte er sich für einen Moment selbst in ein Kind, vertiefte sich in die Spitze des Stiftes, in die wenigen Linien, die auf dem weißen Blatt bereits zu sehen waren. Seine Zungenspitze ragte ein wenig heraus, spielte mit dem Mundwinkel, ohne daß er sich dessen gewahr wurde. Und während die Kinder freudig triumphierend die Zeichnung hochhielten und bewunderten, flogen meine Gedanken zurück in die Vergangenheit, dorthin, wo ich am Anfang aller Möglichkeiten stand, ohne sie wahrzunehmen, ohne sie erfassen zu wollen, dorthin, wo ein junger Mann selbstzweifelnd auf der Stelle klebte und unsicher dort verharrte, wo die Wirklichkeit ihn nicht finden konnte.
Einen Tritt in den Hintern benötige ich, sage ich mir oft genug und weiß, daß ich selbst es sein muß, der mir diesen verpaßt. Oft genug bekomme ich Hinweise, Ratschläge, Nachfragen; doch irgendwie fühle ich mich stets bedroht, belästigt, angegriffen, glaube, nicht verstanden zu werden, es besser zu wissen, andere Richtungen einschlagen zu wollen, die sich mir nur noch nicht offenbart haben.
Ich selbst bin es, der sich aufraffen, der mich antreiben muß. Das weiß ich, und wenn sich diese Erkenntnis endlich wieder einmal in mein Bewußtsein gefressen hat, kann ich nicht anders, als aufzustehen und anzufangen. Ich weiß nicht genau, womit, doch ich fange an, beschäftige mich, finde Dinge, die seit Jahr und Tag hätten erledigt sein sollen, raffe mich auf, weiterzumachen oder von neuem zu beginnen, finde alte Kraft, wo ich sie einst ablegte und treibe mich an.
Doch dann kommt die Pause, die Ruhephase, die Erschöpfung; vielleicht sogar das Begreifen, daß unmöglich zu schaffen ist, was zu schaffen sein soll. Ich atme durch, setze mich hin und lenke mich von düsteren Gedanken ab, die nun vermehrt meinen Geist bevölkern. Wie konnte ich glauben, voraneilen zu können, wo ich doch noch immer ich bin, noch immer derselbe faule, träge Kerl, der lieber auf das Leben wartet, statt ihm entgegenzueilen?
Der erste Widerstand auf meinem Weg, das erste Hindernis, kann schon genug sein, um mich aufzuhalten, mich zu zerbrechen. Ich sehe mir zu, wie ich zu Boden gehe und zucke desinteressiert mit den Schultern. War ja klar, denke ich und wende mich ab. Irgendwo warten irgendwelche Nebensächlichkeiten darauf, von mir mit geschickter Hand vollbracht zu werden, mich vom Eigentlich abzulenken
Ich finde mich wieder mit meinen Gedanken allein gelassen in meinem Zimmer, sehe mich um und erfasse, was alles noch vor mir liegt, wovor ich Angst habe. Dinge, die mich enttäuschten, für die ich nur noch Resignation übrig habe, keine Empfindung mehr, nur Desinteresse. Dinge, die mir etwas bedeuten, doch niemals so liefen, wie erhofft, die mich irgendwann zaudern, straucheln, aufgeben ließen. Dinge, die zu erreichen ich mir nie wünschte, die auf mich zukamen, um dann in meiner Hand doch zu zerbrechen...
Ich sehe sie und sehe mich in diesem Haufen aus Scherben, und es schmerzt zu begreifen, daß neue Scherben sich zu den alten gesellen werden. Vielleicht liegt mein Bestreben darin, sie zu verhindern, mich vor weiteren Scherben zu bewahren, die Gefahr des Zerbrechens zu meiden, indem ich die Gefahr, ja das Leben selbst meide.
Aus Angst vor der Möglichkeit zu scheitern, scheitere ich schon vor dem Beginn des Weges. Das klingt, als ob es richtig wäre, und doch stimmt es nicht. Nicht ganz.
Genug Leute kenne ich, die mich daran erinnern, daß das, was ich bin und will, daß meine Taten und Gedanken nicht unnütz sind. Genug Momente in meinem Dasein gibt es, die mir Freude und Leben schenken, die mich den alten Scherbenberg vergessen und mich mutig nach vorne stürzen lassen. Und doch ist heute einer von diesen Tagen, an denen ich glaube, längst stehengeblieben zu sein, stehengeblieben, während die Welt sich um mich herum weiterdrehte, stehengeblieben, irgendwann, als ein winziger Schritt, eine winzige Tat, die bessere Möglichkeit gewesen wäre...
morast - 3. Jan, 22:48 - Rubrik:
Geistgedanken
Glück gibt es nicht. Dessen bin ich mir sicher.
Zumindest ist das Glück, das totale, unendliche, nicht greifbar, nicht findbar, inexistent. Ich glaube, daß Glück eine Sache ist, über die man sich nachträglich bewußt werden muß. Es fällt schwer, den Augenblick zu loben, weil er sofort wieder enteilt ist und dem Gedanken wich, daß der vergangene Augenblick womöglich voller Glück gewesen war. Leichter hat man es, will man die Vergangenheit betrachten und in ihr Dinge finden, die entzücken, berühren, die das innere Lächeln nach außen kehren.
Wenn ich mich selbst befrage, vermag ich nicht festzustellen, an diesem oder jenem Tag, in derundder Woche glücklich gewesen zu sein. Nein, ich fühlte mich glücklich, als der heiße, süße Pfefferminztee meine Kehle hinunterrann. Oder als ich neulich auf dem Bett lag und begriff, daß ich froh darüber bin, ich zu sein, hier, jetzt und für immer.
Die Suche nach dem totalen Glück, nach der Perfektion des Seins muß im Chaos enden. Schließlich ist die menschliche Natur so beschaffen, daß nur der Kontrast zweier Gegensätze die eine oder andere Seite begreiflich zu machen vermag. Gibt man sich ständigem Glück hin, verliert man das Gefühl dafür und vergißt gar den eigenen Zustand. Nebensächlichkeiten werden zu ungewollten Unglücken, die wiederum natürlich in der Lage sein können, die winzigen Höhepunkte auf der eigenen Glücksgebirgskette hervorzuheben.
Zum Glück bedarf es jedoch nicht zwangsläufig des Unglücks. Nein, selbiges ist nun einmal, was es ist, und wird schwerlich zu Glück führen. Für Glück bedarf es eines Selbstverständnisses, eines Blickes auf das eigene Sein und Wollen. Die Perfektion liegt nicht im groben Großen, sondern im Detail, in den Winzigkeiten, die Freude bereiten, in den unbemerkten Nebensächlichkeiten, die letztendlich aber mehr bedeuten als alles andere.
Zum Glück bedarf es der Gabe des Sehens, der Selbstreflexion. Schon sich selbst sagen zu können - und oft geschieht das mit einem fragenden Unterton des Erstaunens - "Mir geht es gut.", vermag auszureichen, um für einen Moment Glück zu finden.
Blicke ich auf mein Leben, entdecke ich Unzulänglichkeiten und Unfreuden in großen Mengen. Doch horche ich in mich hinein, spüre ich, daß irgendwie der Moment richtig und gut ist, daß ich mich wohl fühle mit dem, was ist. Ich sehe, daß die Zukunft sich nicht in ursprünglich gewünschte Richtungen bewegt, daß mein Weg durch Welten führt, die ich nicht immer zu begehen wünschte. Doch ich finde mich damit ab und harre vorfreudig der Dinge, die mich erwarten.
Mir geht es gut.
Und, ja, ich bin glücklich.
Hier und jetzt.
[Im Hintergrund: Dornenreich - "Hexenwind"]
morast - 21. Nov, 01:20 - Rubrik:
Geistgedanken
Wenn ich schreiben könnte, was ich denke, wüßte ich, was ich meine.
Wenn ich schreiben könnte, was ich denke, wüßtest du, wer ich bin.
Ich kann es nicht, versuche es immer wieder, finde Worte, neue, alte, finde Wege, mich zu beschreiben, zu umschreiben, doch finde nirgendwo mich, nur einen Teil, einen Fetzen, dem Augenblick entrissen, einem Wunsch, einem Blick, einem Gefühl entleibt, abgetrieben, rausgerissen aus dem Geist, der mich dachte, der mich fühlte, der ich war, irgendwann.
Die Summe bildet kein Ganzes, bildet weniger, nur einen Hauch dessen, was ist, nur eine Idee dessen, was aus mir besteht.
Die Summe bildet kein Ganzes, bildet mehr, ein Meer aus Fragen, die mich, dich, zu überfluten drohen. Meine Sprache ist nicht meine Sprache ist nicht deine Sprache, fremde Vokabeln anderer Welten, die wir zu verstehen glauben und doch anderes bedeuten.
Vielleicht sollte ich schweigen. Vielleicht sollten meine Hände ruhen, wartend die Zeit unter den Fingernägeln bewahren, die Augenblicke in den Ausfluß gießen, als existierten sie nur in meinem Kopf, als bedürfe es nicht mehr, sich zu erinnern, das Innere nach außen zu tragen.
Doch die Worte quellen unter meinen geschlossenen Lidern hervor, brechen aus, umrahmen meine Welten, doch sehen sie nicht, krakeln wirre Silhouetten zu Boden, die du findest, aufnimmst und zu begreifen versuchst, die du findest und mit deinen eigenen Welten, deinen Gedanken, deinen Tränen schmückst, zurücksendest in meinen wirr quellenden Schädel, um Antworten zu suchen, die mir selbst verborgen bleiben.
Für einen Augenblick versuche ich zu erklären, mich zu erklären, zu klären, was ich dachte, fühlte, war; doch vermag es nicht. Der Moment verrannte in der Unendlichkeit des Vergangenen, und alles, was ich von ihm zurückbehielt, sind Silhouetten, Fragmente, konturenschwere Formen, die ich sein könnten, mich spiegeln, erklären könnten. Doch sie schweigen, senden falsche Signale, falsche Worte in den Äther, als höhnten sie hämisch deiner Verwunderung.
Und zuweilen sehe ich sie Lieder schreiben, Lichter, die über mich hinweg zu strahlen, mich in den Schatten eines größeren Ichs zu stellen vermögen, die Blicke und Zeilen auf sich ziehen, als wäre ich mir überlegen. Ein Lächeln findet mich, doch ich weiß, es gilt nicht mir, es gilt nicht meinem Kopf, nicht meinen Gedanken, nur dem strahlenden Schatten, nur dem Konstrukt meiner selbst, das in fließender Bewegung bezaubernde Blasen aus glitzernder Luft in die Sonnenstrahlen wirft. Ich sehe mir zu und trete Risse in den Spiegel, freue mich selbstverlustig meines Andersseins.
Als das Schweigen mich weckt, finde ich mich erneut. Die Worte kribbeln unter den Nägeln, suchen die Flucht, ein neues Werk zu beginnen, neue, alte Teile von mir durch Welten zu streuen, als bildeten sie irgendwann ein anderes, besseres, richtigeres Ich, als bedürfe es nur mehr und mehr von ihnen, um ihnen mein Leben zu schenken, um mit ihnen mich erklären zu können.
Ich sehe ihnen nach, sehe sie im Abendrot verschwinden, ein feines Gespinst fremdbekanntschöner Krakeleien, deren Stärke mich ängstigt und mit Stolz erfüllt, deren Sinn jedoch mir noch immer verborgen bleibt.
[Im Hintergrund: Gravenhurst - "Fires In Distant Buildings"]morast - 8. Nov, 21:03 - Rubrik:
Geistgedanken
Und immer wieder die gleichen Worte, die ich an die Leere richte:
Fang mich auf
Doch längst verlor ich das Gesicht des Wesens, das mich fangen, mich halten könnte, sollte, würde. Ich atme meine Angst gegen Spiegel und spüre die Zeit mich nach unten treiben, tiefer und tiefer hinein in den endlosen Fall. Die Wucht des kommenden Aufschlag wächst mit jeder welkenden Sekunde. Ich kann meinen Schrei ersticken hören, dort, in naher, ferner Zukunft, doch noch schreie ich, presse die verbleibende Luft aus meinen Lungen, als wäre sie Gift, das Gift des Alltags, das Gift des Lebens.
Der beschlagene Spiegel gibt nur zöglerlich mein Antlitz preis, schämt sich dessen, was er zu offenbaren hat, als ahnte er, daß ich mich in ihm nicht länger finden kann, das Wesen in seinem Inneren niemals werden wollte. Ich bin entsetzt von mir selbst, wende mich ab, als könnte ich es.
Fang mich auf
Die Worte schmelzen bereits auf meiern Zunge, verbreiten den bitteren Geschmack fehlender Auswege.
Fang mich auf
Die Leere schweigt.
[Im Hintergrund: Oomph! - "Wunschkind"]
morast - 8. Nov, 12:15 - Rubrik:
Geistgedanken
Der Versuch, sich der Wirklichkeit anzupassen, das bereits Falsche zu akzeptieren und trotzdem voranzuschreiten, die gemachten Fehler und unglücklichen Umstände, die sich stets dann zu häufen scheinen, wenn ich ein erreichbares Ziel gefunden zu haben glaube, zu beseitigen oder zu übergehen, aus den Löchern, die ich selbst schaufelte oder in die ich unfreiwillig geriet, herauszuklettern [mühsam stets], scheitert immer wieder an den alten Sorgen, die neu erblühen oder an neuen, die hämisch grinsend den alten die Hände reichen und sich mit ihnen verbrüdern.
[Im Hintergrund: Samsas Traum - "Mater Lagrimarum" --- "Was schmerzt, ist das Wissen, daß es einst anders war..."]
morast - 28. Okt, 18:12 - Rubrik:
Geistgedanken