Zu Besuch
Noch vor wenigen Monaten betrachtete ich dieses winziges Stückchen Erde, diesen grauen, kalten Stein, als etwas Fremdes, als einen unbedeutenden Ort, ohne wirklichen Bezug zu mir - oder zu meinem Vater. Bei der Beerdigung lachte ich traurig in mich hinein: 'Was soll ich hier? Das ist nicht mein Vati.'
Wie sollte ich, wie sollte irgendwer, begreifen, daß derjenige, den ich liebte, der mich zeugte, zu staubiger Asche verbrannt, in einem Metallgefäß verwahrt in dunkler Erde verschachert wurde? Wie sollte ich begreifen, daß fortan unter dem gravierten Mamorstein eine Flut aus Vergangenheiten, Erinnerungen, Gedanken und Bildern begraben liegt? Ich konnte es nicht, kann es noch immer nicht.
Bin ich nur Begeleiter, nur Fahrer, der meine Großmutter, meine Mutter, zum Friedhof bringt, mit ihr zusammen das Grab von Stöckchen und verwehten Blättern bereinigt, mit klarem, kalten Wasser begießt und den sorglos rankenden Blütenschmuck sorgsam pflegt, dann wünsche ich mir, alleine zu sein, wünsche ich mir, in Stille gekehrt verweilen zu können, um am Grab zu stehen, zu denken, zu reden. Ich wünsche mir, für einen Moment innezuhalten, mich zu erinnern, Tränen auf meiner Wange zu spüren.
Wir jedoch eilen weiter, erledigen, was als notwendig erwachtet wird, kehren zum Auto, nach Hause, zurück.
'Ich vermisse dich.', denke ich dann lautlos in Richtung des Grabes.
Heute bin ich allein. Umrankt von Sonnenschein und herbstlich von den Bäumen blätterndem Laub wirkt der Friedhof angenehm, fast schön. Einen Augenblick lang spiele ich mit dem Wunsch nach einer abgelegenen Bank, auf der ich sitzen und im Augenblick verharren könnte, in mich gekehrt, in Gedanken bei meinem Vater verweilend.
Noch vor wenigen Monaten hätte ich mich gewundert ob dieses Wunsches, hätte mir zu verstehen gegeben, daß mein Vater nicht dort ruht, nicht unter den lächerlichen 80x80 Zentimetern Erde, sondern allein in meinem Herzen, in meinem Geist, weilt.
Ich stimme mir zu. Meinen Vater an seinem Grabe zu suchen, ist falsch, unsinnig.
Und doch ist der Friedhof der Platz, an dem ich die Ruhe, die Besinnung finde, um mich ihm in meinem Herzen, in meinem Geiste, zu nähern. Als ich zum Grabplatz laufe, ertappe ich mich dabei, wie ich bereits Worte suche, die ich an meinen Vater wenden möchte. Ich lächle und spüre zugleich die Tränen in den Augen.
Der Anblick des Grabsteins betrübt mich. Liebevoll entferne ich jedes herabgewehte Blatt, gieße die gedeihenden Pflanzen, hinterlasse ein sauberes, gepflegtes Grab.
Doch das ist es nicht, weswegen ich hierherkam. Nicht ausschließlich.
Mir fällt schwer, den Mund zu öffnen, die vorbereiten Worte in die warme Herbstluft gleiten zu lassen. Die Wege sind zu eng, die Nähe zu anderen, frmeden Gräbern zu groß. Irgendwo schmimpft eine alte Frau mit ihrem Mann, entfacht eine kleine Diskussion, lenkt mich ab von mir, von meinen Gedanken.
Ich rede trotzdem, leise nur, als könnte ich für verrückt gehalten werden, erzähle von meiner Mutti, erzähle von mir, verspreche durchzuhalten, nicht aufzugeben, verspreche es mir selbst.
Die Tränen sind nah, doch fließen nicht. Ich bin nicht bei mir. Zuviel Äußeres, zuviel Fremdes, Anderes.
Für einen Moment wünschte ich mir, an einen Himmel glaube zu können, um meine Worte, meine Gedanken, dorthin zu richten. Doch ich kann nicht, stehe auf, verabschiede mich leise und gehe.
'Noch immer fehlt mir die Beziehung zu diesem Ort.', stelle ich fest - und weiß nicht, ob ich darüber glücklich oder traurig sein soll.
Wie sollte ich, wie sollte irgendwer, begreifen, daß derjenige, den ich liebte, der mich zeugte, zu staubiger Asche verbrannt, in einem Metallgefäß verwahrt in dunkler Erde verschachert wurde? Wie sollte ich begreifen, daß fortan unter dem gravierten Mamorstein eine Flut aus Vergangenheiten, Erinnerungen, Gedanken und Bildern begraben liegt? Ich konnte es nicht, kann es noch immer nicht.
Bin ich nur Begeleiter, nur Fahrer, der meine Großmutter, meine Mutter, zum Friedhof bringt, mit ihr zusammen das Grab von Stöckchen und verwehten Blättern bereinigt, mit klarem, kalten Wasser begießt und den sorglos rankenden Blütenschmuck sorgsam pflegt, dann wünsche ich mir, alleine zu sein, wünsche ich mir, in Stille gekehrt verweilen zu können, um am Grab zu stehen, zu denken, zu reden. Ich wünsche mir, für einen Moment innezuhalten, mich zu erinnern, Tränen auf meiner Wange zu spüren.
Wir jedoch eilen weiter, erledigen, was als notwendig erwachtet wird, kehren zum Auto, nach Hause, zurück.
'Ich vermisse dich.', denke ich dann lautlos in Richtung des Grabes.
Heute bin ich allein. Umrankt von Sonnenschein und herbstlich von den Bäumen blätterndem Laub wirkt der Friedhof angenehm, fast schön. Einen Augenblick lang spiele ich mit dem Wunsch nach einer abgelegenen Bank, auf der ich sitzen und im Augenblick verharren könnte, in mich gekehrt, in Gedanken bei meinem Vater verweilend.
Noch vor wenigen Monaten hätte ich mich gewundert ob dieses Wunsches, hätte mir zu verstehen gegeben, daß mein Vater nicht dort ruht, nicht unter den lächerlichen 80x80 Zentimetern Erde, sondern allein in meinem Herzen, in meinem Geist, weilt.
Ich stimme mir zu. Meinen Vater an seinem Grabe zu suchen, ist falsch, unsinnig.
Und doch ist der Friedhof der Platz, an dem ich die Ruhe, die Besinnung finde, um mich ihm in meinem Herzen, in meinem Geiste, zu nähern. Als ich zum Grabplatz laufe, ertappe ich mich dabei, wie ich bereits Worte suche, die ich an meinen Vater wenden möchte. Ich lächle und spüre zugleich die Tränen in den Augen.
Der Anblick des Grabsteins betrübt mich. Liebevoll entferne ich jedes herabgewehte Blatt, gieße die gedeihenden Pflanzen, hinterlasse ein sauberes, gepflegtes Grab.
Doch das ist es nicht, weswegen ich hierherkam. Nicht ausschließlich.
Mir fällt schwer, den Mund zu öffnen, die vorbereiten Worte in die warme Herbstluft gleiten zu lassen. Die Wege sind zu eng, die Nähe zu anderen, frmeden Gräbern zu groß. Irgendwo schmimpft eine alte Frau mit ihrem Mann, entfacht eine kleine Diskussion, lenkt mich ab von mir, von meinen Gedanken.
Ich rede trotzdem, leise nur, als könnte ich für verrückt gehalten werden, erzähle von meiner Mutti, erzähle von mir, verspreche durchzuhalten, nicht aufzugeben, verspreche es mir selbst.
Die Tränen sind nah, doch fließen nicht. Ich bin nicht bei mir. Zuviel Äußeres, zuviel Fremdes, Anderes.
Für einen Moment wünschte ich mir, an einen Himmel glaube zu können, um meine Worte, meine Gedanken, dorthin zu richten. Doch ich kann nicht, stehe auf, verabschiede mich leise und gehe.
'Noch immer fehlt mir die Beziehung zu diesem Ort.', stelle ich fest - und weiß nicht, ob ich darüber glücklich oder traurig sein soll.
morast - 19. Sep, 18:21 - Rubrik: Wortwelten
0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks
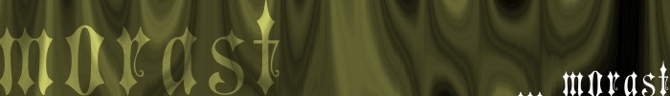



Trackback URL:
https://morast.twoday.net/stories/988797/modTrackback