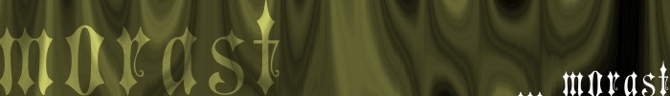Wortwelten
Donnerstag, 24. August 2006
Ich lese keine Zeitschriften. Das stimmt natürlich nicht, gilt aber dennoch.
[Ich liebe es, am Anfang eines Textes Behauptungen zu machen, die sich, wenn man sie genau betrachtet, als unwahr herausstellen, so daß ich mich genötigt fühle, eine Korrektur einzufügen, die zugleich wieder relativiert werden muß, damit der erste Satz nicht seine Bedeutung verliert.]
Besser wäre vermutlich zu behaupten, ich würde mir keine Zeitschriften kaufen. Doch auch das ist nicht ausreichend präzise. Zählt man beispielsweise Comichefte zu den Zeitschriften, weil sie ja zeitschriftengleich formiert und bebildert sind, so ist es durchaus möglich, mich dabei zu ertappen, wie ich eine solche "Zeitschrift" erwerbe. Behauptet man aber, daß Comics keineswegs zu Zeitschriften zählen können, weil sie vielmehr Kunstprodukte als gewöhnlicher Alltagskrimskrams seien, dann stimmt es vielleicht tatsächlich: Ich kaufe keine Zeitschriften.
Nun gut, wirklich wahr ist diese Aussage immer noch nicht: Denn ich kaufe normalerweise keine Zeitschriften. Doch ich fand mich bereits mit einer Musikzeitschrift an einer Kioskkasse wieder, vorfreudig durch deren Seiten blätternd. Allerdings ist das nicht die Regel, nein, eigentlich habe ich seit Monaten darauf verzichtet, meine Musikinformationen auf diese Art und Weise zu beziehen - zum einen weil das Internet diesbezüglich mehr zu bieten hat, zum anderen, weil ich mich so nicht genötigt fühle, uninteressante Artikel zu lesen, bloß weil ich sie bezahlt habe.
Ich kaufe also fast keine Zeitschriften.
Dieser Umstand hat nichts damit zu tun, daß ich nicht das Geld aufwenden möchte oder daß ich mich dessen schämen würde [aus welchem Grund auch immer]. Nein, das Medium Zeitschrift ist einfach nicht bedeutsamer Teil meiner Welt.
Freunde oder Verwandte beispielsweise bestücken sich mit Telekommunikationszeitschriften oder Computerwissensmagazinen. Hin und wieder blättere ich gelangweilt in ihnen herum, doch muß gestehen, eher nach den stets vorhandenen Cartoons als nach mich interessierenden Inhalten zu suchen. Hätte ich ausreichend Willen in mir, so fände ich in dieser oder jener Zeitschrift sicherlich Spannendes, doch allein weil der für mich relevante Inhalt in den immensen Seitenzahlen verborgen ist, allein, weil ich nicht willens bin, immer wieder großformatige Buntanzeigen überblättern zu müssen, ist schon das Durchblättern für mich mit Mißfallen bestückt.
Ich verweile nicht häufig in Arztsprechzimmerwarteräumen. Doch wenn dies der Fall ist und ich mich tatsächlich genötigt sehe, zu einer der herumliegenden Lesezirkel-Zeitschriften zu greifen, so bevorzuge ich die Comic-Rubrik. Ich lese lieber uralte Witze in der Micky Maus, anstatt mich darüber aufzuregen, daß es dem Focus an Inhalten mangelt oder daß die Spiegellektüre mich jedesmal mit dem Gefühl zurückläßt, alsbald werde die Welt untergegangen sein. [Und auch in Focus und Spiegel schaue ich zuerst nach den Cartoons.]
Unglücklicherweise meinen die Lesezirkelmacher, auch das Benjamin-Blümchen-Magazin und Mädchenpferdezeitschriften wie Wendy in die Rubrik "Comic" einordnen zu müssen, so daß der Griff zu dem neutral beumschlagten Heft sich nur allzu häufig als überflüssig herausstellt: Ich mag Benjamin Blümchen nicht. Und mit mädchenklischeehaftem Pferdefanatismus fühle ich mich absolut überfordert.
Arztbesuche, egal wie kurz die zu erwartende Wartezeit sein wird, erfordern die Mitnahme meines derzeit gelesenen Buches - unabhängig davon, ob dieses möglicherweise monströs genug ist, um durch Fallenlassen desselben Erdbeben mittlerer Stärke auszulösen.
Bücher sind meine Zeitschriftenalternative. Besser: Zeitschriften sind keine Alternative für Bücher.
Es kam bereits vor, daß ich für einen Wochenendausflug zwei voluminöse Bücher einpackte - nur weil mich bereits am Ende des ersten befand. Daß ich dementsprechend mehr Masse mit mir herumschleppte bzw. auf anderes, beispielsweise ausreichend wärmende Wäsche, verzichtete, nahm ich bereitwillig in Kauf. Der Gedanke, daß eine Zeitschrift nicht nur leichter und platzsparender, sondern womöglich auch sinnvoller sein würde, kam mir überhaupt nicht.
Ich bin einer von denen, die vor einer Zugfahrt immer in den bahnhofseigenen Zeitschriftenläden herumschauen - doch betrachte ich eigentlich nur die ausgelegten Comics und Musikzeitschriften, zumeist ohne eine von ihnen zu erwerben. Das Rucksackgewicht ist nicht selten immens genug, um mich daran zu erinnern, daß ich dieser Oberflächlichkeitsliteratur nicht bedarf.
Ja, ich weiß, nicht jede Zeitschrift ist mit Klatsch und Tratsch gefüllt; genug Wissenschaftsmagazine und Wissenserweiterer kursieren jenseits von Gala und Bunte in den Läden - warten darauf, daß ich zugreife, bezahle [nicht vergessen!] und mich bilde. Doch Zeitschriften sind wie Radiosender: Nur wenn man Glück hat, spielen sie das eigene Lieblingslied. Und ich habe nicht die Muße, darauf zu warten.
Vielleicht liegt es daran: Zeitschriften pflegt man nicht zu lesen; man blättert. Natürlich bleibt man hier und dort hängen, doch allein die Anzeigenteile sorgen für permanentes Blättern. Aber ich will nicht suchen müssen, will nicht blättern und anlesen, bis mir etwas behagt. Vielleicht bin ich zu sehr buchverwöhnt, um mit Zeitschriften klarzukommen.
Bücher liest man. [Zumindest jene, deren Hauptanteil aus Wörtern besteht.]
Ein nicht geringer Teil meiner Motivation zur Zeitschriftenlektüre besteht aus dem Wunsch nach Unterhaltung. Die Kombination aus Information und Unterhaltung, die in Zeitschriften propagiert wird, funktioniert nur selten. Musikzeitschriften können mehrere Seiten damit füllen, über das neue und das letzte Album einer Band, über deren neue Mitglieder und Instrumentenwechsel zu informieren, ohne auch nur mit einem Wort zu erwähnen, welche Art von Musik überhaupt beworben wird. Technikmagazine wiederum wandeln auf dem schmalen Grat, detaillierte Informationen zu geben, die zugleich Kenner und Unwissende verstehen - und zugleich nicht langweilen. In den meisten Fällen finde ich viel zu viele Informationen dort vor, wo ich Wissenswertes suche - und weiß letztlich, noch nicht einmal nach Lektüre des Fazits, was ich davon halten soll. Auf der Suche nach Amüsantem wiederum finde ich nicht selten Artikel, deren Unterhaltungswert ich eher als zu niedrig einstufe, so daß ich auch hier dazu neige, die Zeitschrift desinteressiert beiseite zu legen.
Hinzu kommt ein gesundes oder ungesundes Mißtrauen. Wird das neueste Handy einer Firma mit preisenden Worten gutgeheißen, so hege ich sofort Zweifel. Wie groß ist der Anteil an Werbung, wie groß der tatsächlicher Information? Zeitschriften für feminine Jungmenschen beispielsweise bestehen zur nahezu 100 Prozent aus Werbung, und ich frage mich jedesmal, wenn ich derlei zu Gesicht bekomme, wieso ich dafür Geld bezahlen sollte, mit bunten, aufdringlichen Das-Mußt-Du-Kaufen-Botschaften belästigt zu werden.
Hinzu kommt, daß ich. selbst wenn die Redakteure unbeeinflußt über einen Film, ein Album oder ein technisches Gerät schreiben, ihren Argwohn ausdrücken, Kritik üben oder Segnungen aussprechen würden, bezweifle, einhellig gleicher Meinung zu sein. Redakteure sind keine Überwesen, deren Ansichten sorglos aufgesaugt und angenommen werden können. Subjektivität zu kaufen, lohnt nicht: Um sich eine eigene Meinung zu bilden, muß man sich ohnehin mit dem Objekt selbst auseinandersetzen - der Umweg über die Zeitschrift erscheint überflüssig.
Natürlich gibt es Fakten. Wenn mir eine Zeitschrift verrät, daß der neue Audi anderthalb mehr PS hat als der neue BMW, dann steht das nicht zur Debatte. Auch, um zu erfahren, mit welchen Neuerungen die Welt gerade bestückt wird, können Zeitschriften gut sein. Dennoch ist es mein fester Glaube, daß für solche Zwecke das weltweite Netz eine bessere, vielseitigere Quelle darstellt als jede Zeitschrift.
Allerdings gebe ich zu, daß ein Buch diesbezüglich nicht mit Zeitschriften konkurrieren kann. Zeitschriften sind aktueller, ihnen haftet ein Wirklichkeitsbezug an, der Büchern nicht unbedingt häufig innewohnt. Zugleich jedoch ist die Aktualität ihr Fluch, denn alte Zeitschriften sind selten wert, sie in ein Regal zur Verwahrung und zu späteren Erneut-Lese-Zwecken zu stellen. Natürlich ist es amüsant, eine c't aus dem letzten Jahrzehnt hervorzuholen und die damalige Technik mit der heutigen zu vergleichen. Dennoch glaube ich, daß die meisten Zeitschriften entweder auf dem Müll oder verstaubend in irgendeiner Ecke landen.
Ich besitze noch immer die wenigen Musikzeitschriften, die ich jemals erwarb, doch kann mich nicht entsinnen, sie nach dem Verstauen außer zu Umzugszwecken wieder hervorgeholt zu haben.
Tatsächlich jedoch tut es mir leid, das Gekaufte, das nur für so kurze Zeit von Nutzen war, wieder zu entsorgen, bloß weil Zeitschriften nicht das Medium sind, das man aufzuheben, auszuleihen oder weiterzugeben pflegt. Zeitschriften dienen dazu, solange herumzuliegen, bis sie - auf welche Weise auch immer - entsorgt werden. Wenn sie Glück haben, blättern mehr als nur ein oder zwei Personen in ihnen. Zuweilen gar werden Teile aus ihnen herausgeschnitten und anderen Zwecken zugeführt. Doch ich bezweifle, daß dies die Regel ist.
Und obgleich ich nicht willens wäre, Zeitschriften wegzuwerfen, läge mir wenig daran, sie zu stapeln, in der Hoffnung, daß die Zukunft einen Nutzen für sie bereithält. Denn das einzige, was die Zukunft mit sich bringen wird, sind weitere Zeitschriftenstapel.
Ich bezweifle jedoch, daß meine Abneigung Zeitschriften gegenüber mit Depositionsproblemen zusammenhängt. Ich glaube eher, daß es daran liegt, daß ich bereits belegt bin, daß meine Sinne in den Momenten, da eine Zeitschrift angebracht wäre, bereits von einem Buch beansprucht werden. Es gibt zu viele gute Bücher, um sie alle lesen zu können. Da bleibt - obgleich sie schlank und wortkarg sein können - wenig Platz für Zeitschriften.
Es liegt mir fern, die Zeitschrift als Medium, ihren Sinn und ihre Nutzer zu verurteilen. Es liegt mir fern, Bücher als Ultimativlösung zu lobpreisen und jeden Andersdenkenden als schwachsinnig abzustempeln.
Ich wunderte mich nur festzustellen, daß ich mit Zeitschriften nicht anzufangen vermag - und daß ich genug Gründe dafür habe, fortan auch weiterhin zu behaupten:
Ich lese keine Zeitschriften.
[Im Hintergrund: Swallow The Sun - "Ghosts Of Loss"]
morast - 24. Aug, 13:27 - Rubrik:
Wortwelten
Straight Edge und ich
Heute las ich zum
ersten Mal von
Straight Edge, einer seit den 80ern existierenden Bewegung, deren Hauptmerkmale auf dem Verzicht auf Alkohol, Zigaretten, Drogen und Promiskuität liegen. Vertreter dieses Lebensstils erweitern die Vorgaben zuweilen, leben vegetarisch oder vegan, verzichten auf Kaffee und Sex vor der Ehe. Und wäre Straight Edge nicht streng mit Hardcore Punk verflochten, mit einer musikalischen Richutng, die mir nur wenig zusagt, hätte ich mich dariun wiedererkannt. Ich hätte mich ohne Zögern als Straight Edger bezeichnen können - selbst wenn der von Spiegel Online beschriebene Hang zu großer Tattoo-Anzahl bei mir eher gering ausgeprägt ist.
Straight Edge bedeutet hautpsächlich Abstinenz, ein großes Nein Dingen gegenüber, die allgemein als spaßbringend angesehen werden - jedoch nicht der Verzicht Vergnügen selber.
Ich las, daß Straight Edger sich zuweilen für elitär halten oder von anderen argwöhnisch für ihre Lebenseinstellung beäugt werden, und wunderte mich.
Ich bin kein Straight Edger - wie auch, wenn ich zusätzlich zu den Straight-Edge-Neins noch das Nein zur Hardcore-Punk-Musik ergänze, wie auch, wenn ich doch erst heute von der Existenz dieser Bewegung erfuhr. Dennoch verzichte ich.
Ich trinke keinen Alkohol.
Seit mehr als zwei jahren habe ich keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Doch dieser Schritt war ein winziger, da schon vorher mein Konsum alkoholischer Getränke auf ein Minimum beschränkt gewesen war - geschmacksbedingt. Im August 2004 setzte ich eine Zäsur, die keine echte war, und beschloß, was einzuhalten mir äußerst leicht fällt.
Doch im Gegensatz zu Aussagen von Texten, die ich heute las, im Gegensatz zu einem Artikel, den ich unlängst beim Blutspenden in irgendeiner Femininjugendzeitschrift überflog, werde ich deswegen nicht ungläubig beglotzt oder zu überzeugen versucht. Nein, Freunde und Bekannte, Nichtfreunde und Unbekannte akzeptieren meine Einstellung meistens sofort. Hin und wieder vernehme ich die interessierte Frage nach dem Warum, die ich beantworte, jedoch im Tonfall der Nebensächlichkeit, der darauf verweisen soll, daß es für mich nichts Bedeutsames ist, auf Alkohol zu verzichten - und daß es für andere ebensowenig bedeutsam sein sollte.
Ich will nicht missionieren. Wenn andere Vorwürfe in meinem Blick zu lesen glauben, dann ist es vielleicht ihr eigenes schlechtes Gewissen, das sich meldet. Ich entreiße niemandem die Bierflasche oder zähle die Folgen übermäßigen Alkoholkonsums auf, um Jünger für meine Antibewegung zu finden. Es fällt mir leicht, nicht mitzutrinken, und auch wenn ich bedaure, niemals Geschmack an Wein oder Bier gefunden und somit die Gemütlichkeit eines Gläschen Rotweins in geselliger Runde oder eines Feierabendbiers nie kennengelernt zu haben, so will ich doch anderen diese Gemütlichkeit nicht ausreden oder auf mich verweisen als extravagantes Vorbild.
Ich empfinde es als normal, was sich mache und freue mich, daß es die meisten, die ich kenne, ähnlich sehen.
Vielleicht werde ich sterben, ohne jemlas betrunken gewesen zu sein - doch es ist mir egal.
Ich rauche nicht.
Noch nie zog ich an einer Zigarette, und ich glaube, dem Alter, in dem man in Versuchung gerät anzufangen, entwachsen zu sein. Tatsächlich wurde ich niemals in Versuchung geführt; mein Interesse am Rauchen war stets minimal und äußerte sich allenfalls in dessen technischen oder biologischen Aspekten.
Auch hier verzichte ich auf Missionierung. Nicht zu rauchen, ist meine Entscheidung; jedem anderen sei eine eigene vorbehalten. Nicht selten vernehme ich von Rauchern, daß es die richtige Entscheidung gewesen war und wünsche mir für einen moment, ich hätte die richtigen Worte und Gesten parat, um sie auf der Stelle von ihrer Sucht zu befreien. Doch das habe ich nicht, und selbst wenn ich Zigarettenausdünstungen nur mit Mißfallen betrachten kann, werde ich doch nicht mein Nichtrauchen als einzig wahren Weg verkünden und jeden Rauchenden verteufeln.
Ich konsumiere keine Drogen.
Erstaunlicherweise war hier die Versuchung stets größer als beim Rauchen. Dennoch fiel es mir nicht schwer, standhaft zu bleiben, allein schon, weil ich selten in Situationen kam, in denen ich dankend ablehnen mußte. Ich selbst suchte nicht danach, wenngleich sich in meinem Schädel die Vorstellung eingebrannt hat, dadurch eine bedeutsame Erfahrung zu verpassen.
Vielleicht ist es der Gedanke, die Kontrolle über mich selbst zu verlieren, der mich zurückschrecken läßt.
Ich verzichte auf Kaffee.
Natürlich kann ich Kaffee trinken, ohne daß mich Übelkeit überkommt. Als Zivildienstleistender wurde ich fast täglich mit Kaffee zugeschüttet, einfach weil die Schwestern nichts anderes zubereiteten. Ich tötete den Kaffee solange mit übergroßen Mengen an Milch und Zucker, bis ich feststellte, daß eine Ärztin stets Tee trank - und ich somit keine Ausnahme mehr sein würde, wenn ich mich ihr anschloß.
Wird mir bei einem fremdfamiliären Kaffeekränzchen Kaffee angeboten, halte ich mich mit meinem Nein meistens zurück, will ich doch keine zusätzlichen Umstände bereiten. Glücklicherweise weiß meine Begleitung oft genug um meine Vorlieben und vermag ein kaffeevermeidendes Wort für mich einzulegen.
Zuweilen, also vielleicht zwei Mal jährlich, genehmige ich mir einen Milchkaffee, allerdings auch nur, weil dieser in einer Riesentasse serviert zu werden pflegt, und nicht, weil ich mal wieder aus meiner Kaffeeabstinenz auszubrechen wünsche.
Kaffee schmeckt mir nicht. Ich liebe seinen Geruch, sowohl in Pulver- oder Bohnenform als auch in gekochter; doch sein Geschmack vermag nicht, meine Sinne zu erfreuen. Ich lobe den Kakao, den ich ohne zu zögern an die Spitze der Liste meiner favorisierten Getränke setzen würde, gäbe es eine solche.
Ich verzichte auf Promiskuität, auf häufig wechselnde Geschlechtspartner. Unlängst bemerkte jemand, ich sei nicht der Mensch für einen One-Night-Stand. Vermutlich bin ich es tatsächlich nicht. Keineswegs neige ich dazu, Sex abzulehnen, mich dagegen zu verwehren, doch liegt mir wenig daran, ständig neue Frauen kennenzulernen, einzig und allein, um mit ihnen koital zu verkehren.
Vielleicht hat in meinem Denken der Mensch, also der denkende, real existierende, agierende Mensch, bestehend aus Geist
und Körper vorrangige Bedeutung und nicht nur dessen physischer Teil. Vielleicht bin ich auch zu sehr mit dem Glauben an Liebe, an deren Innigkeit und Tiefe verwachsen, um den Wunsch abstreifen zu können, Sex und Liebe miteinander kombinieren zu wollen, harmonieren zu lassen, so daß das eine das andere ergänzen möge.
All diese Verzichtserklärungen wirken in ihrer Gesamtheit möglicherweise erschütternd auf Fremde, fast so, als hätte ich mir selbst verboten, mich Genüssen hinzugeben, Freude zu empfinden, mich zu amüsieren, als wäre ich ein öder Langweiler, der auf Feierlichkeiten unbeachtet in einer Ecke darauf wartet, angesprochen zu werden.
Doch die Entscheidungen, auf dies oder jenes zu verzichten, wuchsen in mir, durchliefen einen Reifeprozeß, der möglicherweise noch nicht einmal abgeschlossen ist. Sie kamen nicht gleichzeitig in mir auf, sondern entstanden, allmählich, formten mich und das, was ich heute bin.
Sicherlich wünsche ich mir zuweilen, mit Alkohol meine Sprachlosigkeit unter Fremden zu reduzieren, unter Unbekannten nach Feuer zu fragen, um einen Kommunikationsaufhänger zu finden, Dinge zu erleben, die nur durch Bewußtseinserweiterung erfahrbar werden können, die vielen schönen Frauen nicht nur mit den Augen zu genießen oder es mir mit einer heißen Tasse Kaffee oder einem Schluck guten Rotweins gemütlich zu machen - und dennoch verzichte ich.
Doch im Gegensatz zu dem, was bei Straight Edge mitklingt, bin ich nicht stolz auf meine Lebenseinstellung, preise ich sie nicht an als Entrückung vom konsumgesteuerten Jetztsein, als selbstsuchende Andersartigkeit. Nein, ich bin, wie ich bin. Es bedurfte keiner krassen Entscheidungen, keiner Schwüre, um mich agieren zu lassen, wie ich agiere.
Denn für mich bedeutet das Verzichten keinen Verzicht. Ich enthalte mich keiner Dinge, die ich nicht entbehren kann, ich verzichte auf nichts, das in meiner Welt einen hohen Stellenwert einnimmt.
Ich verzichte auf nichts, das ich für wirklich bedeutsam erachte.
morast - 9. Aug, 15:16 - Rubrik:
Wortwelten
Möglicherweise bin ich ein Spinner, vielleicht lebe ich aber auch plan- und rücksichtslos vor mich hin. Fest steht, daß ich dazu neige, Dinge in letzter Sekunde erledigen zu wollen.
Beispielsweise geschieht es nicht selten, daß ich auf die Uhr schaue und feststelle, daß ich, ginge ich jetzt los, ein paar Minuten zu früh am Treffpunkt ankommen würde. Eigentlich empfände ich das gar nicht als sonderlich schlimm; mir macht es wenig asu zu warten, weiß ich mich doch ausreichend mit Buch, Blatt und Beobachtung zu beschäftigen, um Langeweile nicht zu kennen. Doch das rechtzeitige, nein: überrechtzeitige, Losgehen mißlingt immer, finde ich doch stets noch einen unbedeutenden Grund, mich ein paar Minuten lang zu beschäftigen. Die paar Minuten jedoch geraten länger als erdacht, so daß ich mich letztendlich mit Eile und Hast bepflastern muß, um rechtzeitig eintreffen zu können.
Zu jeder mir unbekannten Strecke wird irgendwann eine Zahl in meinem Kopf auftauchen, ob recherchiert oder geschätzt, welche die genaue Minutenzahl angibt, die ich theoretisch von ort A zu Ort B benötige. Komme ich trotzdem zu spät, so habe ich spätestens, wenn ich diese Zahl wieder aus meinem Schädel abrufe, vergessen, daß diese sich als nicht ausreichend erwiesen hatte.
Beispielsweise kann ich die Strecke Zuhause-Uni mit dem Rad innerhalb von zehn Minuten schaffen - allerdings nur mit hoher Geschwindigkeit und unter der VOraussetzung, daß ich bereits voll bekleidet bin und das Rad abfahrbereit auf dem Hof steht. Doch irgendetwas in mir will, daß ich die zehn Minuten als prinzipielle Berechnugnsgrundlage nehme - und erst zehn Minuten vor erforderlicher Ankunftszeit anfange, mir die Springersiefel [jeweils etwa eine Minute Anziehzeit] überzustülpen.
Unlängst konnte ich zusammen mit G erproben, daß es mir gelingt, die Stiefel genau in dem Zeitraum anzuziehen, die der Fahrstuhl in einem Wohnhaus benötigt, um von der 18. Etage ins Erdgeschoß zu gelangen. Kurz bevor die Türen sich im Erdgeschoß öffneten, stand ich vom Boden auf - nun endlich vollständig bekleidet und ob der auf den letzten Drücker gleungenen Tat grinsend.
Eigentlich wollte ich vorhin längst losgeeilt sein und meine Fotos abgeholt haben. Natürlich stellte ich erst 18.21 Uhr fest, daß ich noch immer untätig herumsaß - und der Abholladen schloß 18.30 Uhr. Socken aus, Flipflops anstelle von Stiefeln, Treppe heruntergestürmt [Das dauert allein eine halbe Minute.], Fahrrad abgeschlossen ["abgeschlossen" als Gegenteil, nicht im Sinne von "angeschlossen"], in die Pedale getreten, in die Laden geeilt - und gerade noch rechtzeitig gewesen. Ich hatte eigentlicht nicht daran geglaubt, daß das gelingt.
Erstaunlicherweise klappt derartiges aber meistens. Ich komme selten zu spät. Irgendwie gelingt es mir stets, zumindest bei Wichtigem, mich in den vorgegebenen Zeitrahmen hineinzuquetschen, obgleich es anfangs unmöglich aussah.
[Daß ich bei Ankunft dann Weltmeere ausschwitze und mit Gabbabeatherzen nach Luft schnappe, halte ich für vernachlässigbar. Ich war pünktlich - das allein zählt.]
Im Laufe des heutigen Abends wird G hier eintrudeln. Soeben duschte ich des Tages Schweiß und Gestank von mir fort, und so sitze ich nun im Bademantel in meinem Zimmer. Die Frage, die sich mir dabei aufdrängt, ist folgende:
Würde ich es schaffen, in der Zeit, die G braucht, um die Treppen hinaufzueilen [Und er eilt tatsächlich!], mich des Bademantels zu entledigen und in normale Klamotten zu schlüpfen...?
[Im Hintergrund: Muse - "Black Holes And Revelations"]
morast - 1. Aug, 20:09 - Rubrik:
Wortwelten
Obgleich die Frage nach der Ästhetik von FlipFlops mal wieder eine Runde dreht, weigere ich mich, darüber zu schreiben, nicht zuletzt, weil die eigentliche Frage, die dahinter steht, doch die der Barfüßigkeit und der Schönheit eines nackten Menschenfußes ist.
Mir sind Füße egal. Ich arbeitete als Zivi auf einer Station für Hautkrankheiten und sah schlimmste Exemplare des menschlichen Fußes, ohne jemals das Bedürfnis zu verspüren, den menschlichen Fuß im allgemeinen als besonders widerlich oder unasthetisch werten zu wollen. Doch genau das wird getan, sobald die Steilvorlage "FlipFlops" auf dem Tisch liegt:
Der menschliche Fuß sei bis auf wenige Ausnahmen ekelhaft. Voller Warzen, Auswüchse und Schwielen. Es sei daher unangebracht, diesen, seinen nackten, unschönen Fuß der Weltöffentlichkeit unter die Nase zu halten.
Ich begreife das nicht: Die wenigsten Menschen sind wirklich schön. Und trotzdem wird ihnen nicht verboten, öffentliche Gebäude und Straßenzüge zu betreten. Warum gilt das nicht für Füße?
Und überhaupt: Wer schaut - abgesehen von Fußfetischisten -anderen Menschen überhaupt derart genau auf die Füße? In den meisten Fällen befinden sich Füße ganz unten, am Boden, und mein Blick, wenn ich einem anderen Wesen begegne, bleibt eher in dessen Gesicht oder an auffallenden Körperteilen haften als an irgendeinem nackten Schwielenfuß.
Sicherlich kann ich mich nicht verwehren, meinen Blick in Ganzkörperbetrachtung streifen zu lassen und beispielsweise hochgezogene Socken zu Sandalen und kurzen Hosen als modefern zu bezeichnen. Doch ich werde ihne [en Blick] nicht senken und solange auf die Füße meines Gegenübers starren, bis ich auch die letzte Unebenheit erkannt habe.
Die Frage ist ohnehin: Welches Schuhwek soll man denn im Sommer tragen, wenn der Nacktfuß als solcher verpönt ist? Sandalen mit Socken, ein Kleidungsstil, der im Allgemeinen mit modebewußter Verachtung bestückt wird? Sandalen ohne Socken, am besten solche, die eher Schuh denn Sandale sind und soviel wie möglich Nacktheit verdecken? Schweißgetränkte Turnschuhe oder deren hinten offene Äquivalente, die sich im vorderen Bereich dennoch der fleißigen Schweißsammelei bedienen? Ordentliche Spingerstiefel, die meine Mami [und andere] stets zu ironischen Kommentaren anregen?
Ich trage FlipFlops, obwohl ich weiß, daß mein Gang dadurch an Unästhetik gewinnt, obwohl ich weiß, daß mein Fuß über ein paar Schwielen verfügt, die der Nacktfußästhetikkommission wohl mißfallen würden. Ich trage FlipFlops, weil es die luftigste und bei diesen Temperaturen somit sinnvollste Art ist, Schuhwerk zu tragen.
Ich mag übrigens die Hornhaut an meinem Fuß. Nicht, weil ich glaube, sie sei ein Auswuchs von besonderer Schönheit oder das Sinnbild natürlicher Eleganz, nein, einzig und allein, weil ich weiß, daß Hornhaut eine Funktion erfüllt, daß sie sich bildete, um meinen Fuß vor unangenehmem Schuhwerk zu schützen und mir ein bequemes Laufgefühl zu ermöglichen. Hornhaut ist nicht eklig, sondern Schutz.
Ich käme nie auf die Idee, mein Immunsystem absaugen zu lassen [falls möglich], um einer höheren Asthetik zu genügen. Dementsprechend albern ist es zu fordern, daß noch nutzende Hornhaut gefälligst weggeraspelt werden möge, bloß weil irgendwer nicht imstande ist, seinen Blick zu heben.
Eigentlich mag ich es, barfuß unterwegs zu sein. Allerdings lehrte mich ein Barfußpfad in Thüringen, daß Kies unabhängig von dessen Krönung heiß sein kann, daß Holz voller Splitter ist, daß Gras- und Waldboden insbesondere bei Trockenheit nur wenig Laufvergnügen bietet. Seitdem renne ich nur hin und wieder barfuß nach der Bahn, die sprintuntauglichen FlipFlps in der Hand tragend.
Ich erachte es für sinnvoll, in einer Bank, in einem besseren Restaurant oder in ähnlichen Lokalitäten auf schuhwerkfreie Füße zu verzichten. Schließlich werden auch entblößte Oberkörper dort eher ungern gesehen, so daß die Forderung nach bedeckten Füßen dort eher konsequent und akzeptabel denn freiheitsbeschränkend ist.
Daß jedoch eine solche Fußbedeckung aus ästhetischen Gründen prinzipell notwendig sein sollte, halte ich in höchsten Maßen für fragwürdig. Der Fuß gehört mit Sicherheit nicht zu den schönsten Teilen des menschlichen Körpers und wird - selbst ohne Hornhaut und eingewachsene Zehennägel - nur selten besonderes Interesse erwecken und Preise für herausragende Ästhetik gewinnen.
Dennoch braucht er nicht in Eigenschweiß zu ertrinken, bloß weil eine Warze oder eine Schwielen ihn der Norm entreißen, bloß weil ein paar Ästhetikgeile ihre Blicke nicht vom Boden heben können.
[Im Hintergrund: Mouning Beloveth]
morast - 28. Jul, 10:34 - Rubrik:
Wortwelten
Eine Ungeheuerlichkeit erschüttert Deutschland: Nun verlieben sich schon Grundschulkinder! Wohin soll das noch führen?
Moment!, denke ich, und entsinne mich meiner ersten Liebe, beziehungsweise dessen, was ich als rückblickend als erste Liebe bezeichnen würde: Nicole.
In meinen ersten beiden Schuljahren war es nicht schwer, sich in eine Nicole zu verlieben - allein unsere Klasse hatte vier davon. Ich muß allerdings zugeben, daß ich mich nur an eine von ihnen erinnern kann. Dafür entsinne ich mich beider Janas und des Umstands, daß eine von ihnen Blickfang sämtlicher maskuliner Mitschüler war. Ich kann mir gut vorstellen, daß ein Großteil unserer Jungen diese eine Jana toll fand. Schon damals dachte ich praktisch, logisch und mainstreamfern: Ich beschloß, mein Augenmerk nicht auf die allseits umschwärmte Jana zu legen, sondern auf eine der vier Nicoles. Diese sah weniger gut aus, das mußte ich zugeben, war aber mir gegenüber netter, freundlicher und, vermutlich weil sie nicht den Status der Klassenschönheit besaß, weniger abgehoben.
Wir gingen ein paar Mal gemeinsam nach Hause, doch mehr geschah nie. Abgesehen davon, daß sich Mädchen ohnehin selten für Jungen ihres Alters interessieren, war ich einer der Kleinsten meiner Altersklasse - und somit nicht unbedingt eine gute Partie. Allerdings kann ich mich auch nicht entsinnen, daß irgendwer aus meiner Klasse so etwas wie eine festere Bindung zu irgendwem besessen hatte, ja daß es irgendwo diese auf sepiafarbenen Klischeepostkarten verkörperte Kindergarten- bzw Grundschulliebe gegeben hatte.
Zur dritten Klasse wechselte ich auf eine Russischschule, wurde also mit lauter Unbekannten [und der zweiten Jana meiner alten Klasse] zusammengestopft - was eigentlich eine gute Basis bildete, um neue Freundschaften zu schließen. Allerdings war ich noch immer klein und schmächtig und hatte mittlerweile auch noch eine verunzierende Sehhilfe auf die Nase gesetzt bekommen. Es dauerte eine Weile, bis ich mich mit ein paar Jungs anfreundete, von denen eigentlich nur der unscheinbarste eine wirkliche Rolle in meinem Leben spielen würde.
Mit Mädchen hatte ich nichts am Hut; nur an Katja dachte ich manchmal. Ich kannte Katja aus dem Kindergarten, hatte sie sogar bereits mal beim Mittagsschlaf ohne Oberbekleidung gesehen. Doch in der dritten Klasse hatte sie mit ihrem langen Haar, ihrem niedlichen Gesicht und ihren Mickey-Maus-T-Shirts die Aufmerksamkeit aller erwirkt und bedurfte nicht der Bekanntschaft eines Jungen, an den sie sich vermutlich noch nicht einmal erinnerte. Ich konnte meine Chancen recht gut einschätzen und machte mir keine falschen Hoffnungen, erst recht nicht, als sie die erste war, die einen BH trug und somit zusätzliche Mittelpunktsaufmerksamkeit beanspruchte.
Doch ich kann mich nicht entsinnen, wegen ihrer Unerreichbarkeit Tränen vergossen zu haben. Im Bett schrieb ich zuweilen ihren Namen auf mein Laken und erfreute mich des geheimen Wissens, daß ihr Nachname eine mir nicht unbekannte Stadt war.
Irgendwann ging Katja [Ich vermutete, sie entfloh in ihre heimliche Heimat, in die Stadt ihres Nachnamens.], und die Aufmerksamkeit der Jungs verlagerte sich ins Unbestimmte. Da gab es Claudia, die jedoch etwas jungenhaftes, ja zuweilen unnettes an sich hatte. Oder Katharina, eine echte Blondine, die aber dem Blondinenklischee gerecht wurde. Und es gab Katy.
Bis heute weiß ich nicht, was ich an Katy fand. Sie hatte kurzes, dunkles Haar, eine recht tiefe Stimme, und ihr einziges Kleidungsstück, das ich in Erinnerung behielt, war ein pinkfarbener Pullover mit blauen Punkten. Ich glaube, ich fand ihr Gesicht hübsch.
Erstaunlicherweise war ich es sogar, der die Initiative ergriff und ihr in der fünften Klasse einen Brief zukommen ließ. Das war etwas Heimliches, Verbotenes, von dem niemand sonst erfahren durfte. Dementsprechend lange brauchte ich, um den richtigen Moment abzupassen und ihr das Schriftstück dann möglichst lässig in die Hand zu drücken. [Ich bezweifle allerdings, daß ich tatsächlich lässig aussah.]
Unsere Brieffreundschaft hielt eine Weile, und wir trafen uns sogar. Meistens holte ich sie ab - was nicht schwer war, da sie unweit meiner Großeltern wohnte. Manchmal, wenn ich zu meinen Großeltern ging, warf ich heimlich einen Blick hinauf zu ihrer Wohnung, in der Hoffnung, irgendetwas von ihr entdecken zu können.
Ich brachte ihr Süßigkeiten mit. Kaugummis beispielsweise, die sich wenig interessiert annahm - aber trotzdem konsumierte. Ich entsinne mich des wirklich unangenehmen Geruchs im Treppenhaus, das zur Wohnung ihrer Eltern führte, und dessen, daß sie mich einmal in Unterhose empfing, was mich ziemlich überraschte. Ich bezweifle allerdings, daß es einen anderen Hintergund gab als den, daß sie eben derart zu Hause herumlief. Einmal mußte ich mit ihren Barbie-Puppen mitspielen, was ich als ziemlich unangenehm empfand.
Parallel zur "echten" hielt auch unsere briefliche Beziehung an. Sie berichtete mir über ihren Ausflug, über einen Unfall, den ihr Vater hatte, über Belangloses und Interessantes. Nicht selten fand ich auf dem Umschlag einen Kußmund, einen Abdruck aus rosa Lippenstift, der zwar feminin, aber wenig anziehend roch. Der wohl dümmste Satz, den ich ihr je schrieb, war: "Ich habe extra für dich aufgeräumt." Sie besuchte mich nie, doch ich war stolz darauf, daß ich meine damals schon ausgeprägte Unordnung extra für sie in den Griff bekommen wollte [und das zusätzlich zu meinem Wunsch, leserlich zu schreiben.]
Sie trennte sich von mir mittels eines Briefes. Ich sei zu kindisch, meinte sie, und bis heute muß ich über diesen Vorwurf nachdenken. Sie hatte recht: Ich war kindisch.- Allerdings ist das keine schlechte Eigenschaft für ein Kind. Andererseits bin ich bis heute ein Kasper und erfreue mich dessen, häufig kindisch zu sein. Vielleicht erahnte sie das schon damals und war der Ansicht, das passe nicht zu ihr.
Worauf es aber höchstwahrscheinlich hinauslief, war: Ich war zu jung. Sie gab sich gerne mit Jungen ab, die fünf oder sechs [oder noch mehr] Jahre älter waren als sie und nach Möglichkeit schon Motorrad fahren konnten. Da paßte ihr ein Süßigkeiten anschleppender Spargeltarzan kaum ins Konzept.
In der neunten Klasse saß ich im Informatikunterricht neben Katy. Sie hatte zugenommen, aß ständig Bonbons und begriff nichts - und irgendwie war ich froh, daß aus uns nichts geworden war.
Abseits der Schule gab es noch ein Mädchen, dem ich Interesse entgegenbrachte: Jennifer. Ich begegnete ihr zwei Mal pro Woche im Leichtathletiktraining. Ich war viel zu scheu, um sie anszusprechen, geschweige denn, mehr als nur eine flüchtige Bekanntschaft zu erwarten. Außerdem gab es Eric und Sebastian, zwei Rabauken, die Hintergrundbevölkerer wie mich unscheinbar aussehen ließen. Irgendwann, ich trainierte längst nicht mehr, träumte ich mal von Jennifer. Wir befanden uns an einer Schießbude. Aus irgendeinem Grund besaß ich ein Basecap. Sie küßte mich, und es war das schönste Gefühl der Welt. Dann flog mein Basecap weg [oder wurde geklaut], und ich mußte den romantischen Teil des Traumes zugunsten einer Verfolgungsjagd opfern. Als ich erwachte, war ich erneut in Jennifer verliebt. Mir fiel gerade eben ihr Name ein, doch die Erinnerung an den Traumkuß reichte, um mich wieder verliebt zu fühlen.
Ich sah Jennifer wieder, als ich nach der 12. Klasse mit meiner Freundin, meiner vielleicht ersten wirlichen, erfüllten und erwiderten Liebe, auf einer Wise saß und mit Freunden unseren Schulabschluß zelebrierte. Ich blickte auf, und inmitten der Menschenmassen, die uns umgaben, entdeckte ich Jennifer, erkannte sie sofort. Das Traumgefühl war längst entschwunden, und sie erkannte mich nicht.
Lächelnd wandte ich den Blick ab, rückte ich näher an meine Freundin und genoß das Gefühl, erfolgreich verliebt zu sein.
morast - 27. Jul, 15:35 - Rubrik:
Wortwelten
Gestern dialogisierte ich mit einem Freund, und im selben Moment, in dem ich feststelle, überhaupt nicht mehr zu wissen, worüber jener Freund gerade redete, entschlüpfte meinem Mund unkontrolliert, ja fast automatisiert, ein minder gutes, aber durchaus passendes Wortspiel, ein typisch Morastscher Kommentar, der imstande war, den Eindruck zu erwecken, ich hätte tatsächlich zugehört.
Ich war überrascht und schockiert zugleich: Automatisierte Witzigkeit - Das war Oberflächlichkeit und Genialität zugleich...
[Im Ohr: Novembers Doom - "Reflecting in Grey Dusk"]
morast - 27. Jul, 13:32 - Rubrik:
Wortwelten
Es ist nicht unwahrscheinlich, daß jede größere Stadt ihre Originale hat. In Kleinstädten und Dörfern ist es ohnehin üblich, daß jeder jeden kennt, daß also über jeden einzelnen Geschichten und Gerüchte im Umlauf sind, deren Wahrheitsgehalt mitunter vernachlässigbar gering ausfällt.
In größeren Städten dagegen greift die Anonymität um sich. Ich weiß tatsächlich nicht, wer die beiden anderen Wohnungen auf meiner Etage behaust bzw ob dort überhaupt jemand einzog. Dementsprechend wenig vermag ich über Peter Schmidt zu sagen, der mir am McDonalds zum ersten und einzigen Mal begegnet - ohne daß ich ihn überhaupt bemerke, geschweige denn seinen Namen und die über ihn kursierenden Absurditäten kenne.
Doch es gibt Menschen, die jeder kennt, der ausreichend lange eine Stadt bewohnt; ich nenne sie Originale, obgleich ich nicht weiß, wer sie kopieren wollen würde. Denn ihre Schicksale sind nicht selten abstrus und sonderbar, zuweilen gar traurig - zumindest wenn man den Gerüchten Glauben schenkt.
In Halle (Saale) gab es den Klatscher. Insbesondere in Halle-Neustadt bekannt wußte doch kaum jemand, wer oder wie alt er wirklich war. 18 Jahre vielleicht. Oder zwanzig.
Er lächelte immer, und immer bewegte er sich im Hopserlauf fort. Hin und wieder klatschte er ausgelassen in die Hände, zuweilen gar rhythmisch. Und wenn er besonders guter Laune war, jauchzte er kurz. "Wuh!", tönte es dann zwischen den Plattenbauten hindurch.
Der Klatscher trug immer gute Klamotten, war gepflegt, hatte - wie meine Großeltern wußten - sorgende, liebende Eltern. Diese sah ich nie.
Der Klatscher ließ mich immer lächeln. Seine gute Laune war ansteckend. Und doch zündete er Mülltonnen an. Es dauerte eine Weile, bis man herausfand, daß er es war, und als es soweit war, wollte es keiner glauben.
Unser Klatscher?, fragten die Leute. Niemals!
Irgendwann beging der Klatscher Selbstmord. Ich weiß nichts Genaueres, doch hin und wieder entsinne ich mich seines erheiternden Hopserlaufs.
Ein weiteres Hallenser Original ist der Schreier. Der Schreier ist ein älterer Mann, vielleicht fünfzig, der immer mit Anzug und Krawatte umherläuft. Doch benimmt er sich seltsamerweise nicht seinem Äußeren entsprechend.
Er schreit. Na gut, er schimpft. Er redet laut. Mitten auf dem Marktplatz, vor Kaufhof oder dem Rathaus steht er und füllt seine Umgebung mit wüsten Beleidigungen, mit extremen Beschimpfungen. Es ist schwer zu verstehen, wen er beleidigt, doch es sind nicht die Passanten.
Angeblich mußte er einst zusehen, wie seine Frau und seine Kinder bei einem Hausbrand in den Flammen ums Leben kamen. Dieser Anblick raubte ihm die Sinne und führte zu seinem derzeitigen Verhalten.
Ich weiß nicht, inwieweit man dieser Geschichte Glauben schenken darf und hoffe, daß es sich nicht so verhielt.
In den letzten Tagen begegnete ich hin und wieder dem bekanntesten Magdeburger Original: Fidel Castro. Ein älterer Mann mit Rauschebart, der bevorzugt in Armeeklamotten, mit Armeerucksack, unterwegs ist. Er gesellt sich zu den Trinkern am Bahnhof ebenso wie zu den Punks. Selbst in glühender Hitze trägt er seine Armeeweste, die allerdings zuweilen in Beigetönen gehalten ist. Niemals sah ich ihn ohne sein Army-Cap.
Sein Gesicht besteht nur aus dem grausweißen Bart, der wohl zu seiner Namensgebung beitrug. Vorhin saß er auf einer Bank im Schatten, zusammen mit ein paar Punks, die ihn einem älteren Ehepaar vorstellten, das sich eigentlich nur ausruhen wollte: "Das hier ist Fidel Castro." Leider konnte ich deren Gesichter nicht sehen.
Fidel Castro ist erstaunlicherweise überall beliebt und willkommen. In seiner Nähe wird getrunken und diskutiert, und mehr als einmal hörte ich davon, daß jemand intelligente Gespräche mit ihm führte. Ich beobachtete, wie er in einem Jugendclub freudig begrüßt wurde, obgleich er den Altersdurchschnitt nicht unwesentlich hob.
Ich redete noch nie mit ihm, doch bezweifle nicht, daß Fidel - wie ihn alle nennen - ein Mensch ist, den kennenzulernen sich lohnen würde. Allerdings nicht im Umfeld von betrunkenen Punks.
Vielleicht weniger stadtbekannt, dennoch aber relaitv häufig zu beobachten ist der Bildleser. Mein Freundeskreis taufte ihn so, weil er - man glaubt es kaum - Bild liest. Immer.
Er ist ein kleiner Mann, vielleicht 1,50 Meter groß, und verfügt über eine beschauliche Halbglatze, die eigentlich nur noch aus einem Haarkranz besteht. Typisch für sein Äußeres ist eine dicke Hornbrille mit Aschenbechergläsern. Einmal sah ich ihn ohne diese Sehhilfe, und er wirkte hilflos, fast blind.
Man begegnet ihm nur in der Straßenbahn. Kaum hat er einen Sitzplatz gefunden, klappt er seinen Aktenkoffer auf und entnimmt ihm eine Bildzeitung, die er gewissenhaft entfaltet und genauestens studiert. Niemals sah ich jemanden mit ihm reden - noch nicht einmal Fahrkartenkontrolleure.
Unlängst fragte ich mich nach längerer Nichtsichtung, ob es ihn denn noch gäbe. Nur wenige Tage darauf sah ich ihn, in altbekannter Haltung mit der Bildzeitung auf seinem Schoß.
Die Welt war noch in Ordnung.
Mir fallen noch mehr Gestalten ein. Der dicke Fahrkartenkontrolleur beispielsweise bzw seine Begleiterin, die "Mutti". Oder den Bettler in Halle, von dem gesagt wird, er sei eigentlich weiblich - und ich frage mich bei jeder Begegnung, ob das stimmen kann. Oder den Fliegenmann, der modebewußt - meist in Schwarz - und glatzköpfig durch Stadtfeld wandelt, nicht selten bestückt mit einer weißen Fliege...
Doch wie sieht es mit Originalen in eurer Stadt aus. Gibt es welche, und was macht sie aus?
[Im Hintergrund: Grabnebelfürsten - "Von Schemen und Trugbildern"]
morast - 14. Jul, 19:39 - Rubrik:
Wortwelten
Ich habe noch nie geraucht. Noch nicht einmal an einer Zigarette gezogen. Zumindest nicht an einer echten. Aber Schokoloaden- und Kaugummizigaretten zählen nicht.
Mein Vater war starker Raucher und sehr darauf erpicht, daß wir, seine Kinder, niemals "mit diesem Scheiß" anfangen würden. Obgleich Jugendliche dazu neigen, den Vorgaben der Eltern entgegenzuwirken, rebellierte ich diesbezüglich nie. Ja, ich verspürte noch nicht einmal einen Drang zur Rebellion. In meinen Augen wirkte man nicht cool oder lässig, sondern nur dumm, wenn man als Jugendlicher mit Zigarette im Mund herumlief. Rauchende in meinem Alter, egal ob 12 oder 17, waren für mich damals der Inbegriff dessen, was ich heute "pseudo" nennen würde: Menschen, die versuchen, mit sinnlosem und nicht durchdachtem Gebaren, einen bestimmten, für mich fragwürdigen, Status zu erreichen.
Ich wollte cool sein, klar - doch das Rauchen gehörte niemals zum angestrebten Coolness-Bild.
Ich war überrascht, als eine Freundin mit dem Rauchen begann - weil es ihre Freundinnen taten. Sie notierte sich Nikotin- und Kondensat-Werte aller verfügbaren Marken in ein kleines Heftchen und rauchte die Sorte mit den niedrigsten zahlen. Irgendwann hörte sie auf, und ich war stolz auf sie. In gleichem Maße war ich enttäuscht, als sie wieder anfing.
Einmal verstand ich, warum Menschen rauchen. Ich träumte mich mit Zigarette im Mund und fühlte mich losgelöst von den üblichen Negativ-Gefühlen, die das Rauchen betrafen. Und ich verspürte mehr: Ich begriff, was es heißt zu rauchen, warum Menschen motiviert sind, sich glimmende Pflanzenreste in den Mund zu stopfen und dessen Abgase zu inhalieren.
Dann wachte ich auf, und das Wissen verschwand. Nur eine Ahnung blieb zurück, die Ahnung, daß ich einst wußte, was Rauchen bedeutet.
Gelegenheit anzufangen gab es genug. Doch ich hatte keinen Bedarf. Ich sah nicht, was der Zigarettenkonsum mir Positives bringen konnte und ließ es. Außerdem hatte ich genug andere schlechte Angewohnheiten - ein Blick auf meine Fingernägel bewies dies -, die nicht durch weitere ergänzt werden brauchten.
Ich habe bis heute Menschen nicht verstanden, die rauchen. Natürlich sehe ich, daß es ihnen Freude bringt oder daß Raucher untereinander viel schneller ins Gespräch kommen können. Die Frage nach Feuer oder einer Zigarette oder nach einer gemeinsamen Raucherpause genügt, um soziale Kontakte zu knüpfen. In einer Kneipe oder Diskothek steht ein Raucher niemals mit leeren Händen da, ist irgendwie beschäftigt und sei es nur mit dreckiger Luft.
Ich begreife Raucher so wenig, daß ich niemals daran denken würde, in meiner Wohnung einen Platz zu schaffen, an dem Gäste rauchen können. Eine fünfstündige Autofahrt würde ich vermutlich absolvieren, ohne an die armen Raucher auf der Rückbank zu denken, die irgendwann zu betteln beginnen.
Bis heute sehe ich keinen Grund, mit dem Rauchen zu beginnen. Die erwähnten Kontaktvorteile kann ich verschmerzen. In Streßsituationen gibt es genügend Möglichkeiten, mich zu beschäftigen, ohne daß es einer Zigarette bedarf. Auch nach dem Sex. Langeweile ist mir fern. Das Warten an Haltestellen überbrücke ich mit Beobachtungen, mit Zeichnungen, mit Musik, mit Büchern - oder einfach mit Warten.
Es gab eine Zeit, da trug ich zuweilen Streichhölzer oder Feuerzeuge mit mir herum; nicht, weil ich zündeln wollte, sondern nur, um bereit zu sein, falls irgendwer irgrendwann mich nach Feuer fragt. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals feuergebend nutzvoll gewesen zu sein und weiß nur, daß ich diese Eigenart irgendwann eingestellt haben muß. Ich besitze heute mehrere Feuerzeuge - die meisten sind Geschenke von Marlboro -, doch weiß nicht, ob auch nur eines von ihnen wirklich funktioniert. Irgendwo liegen Streichholzschachteln herum, um Kerzen zu entzünden, doch ich bin mir nicht sicher, ob sie noch befüllt sind.
Mein Freund G rauchte früher. Als ich nach Magdeburg kam, war eine der ersten Lokationen, die wir aufsuchten, das Alex, ein Schuppen, in dem es damals wohl die Baguettes besonders toll waren, auch wenn vorwiegend Prollvolk sich dort aufhielt.
Eine Marlboro-Werbetante trat an unseren Tisch, und mir wurden Zeichen gegeben, ich solle die Frage, ob ich Raucher sei, bejahen. Ich sagte "Ja." und erhielt neben einem Kugelschreiber auch eine Schachtel Marlboro, die ich sofort an den erfreuten G weitergab. Anscheinend hinterließ ich der Marlboro-Tante auch meine Adresse, denn in jedem Sommer bekomme ich ein Feuerzeug oder eine Tube Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 40 zugeschickt. Ich freue mich darüber, obwohl ich niemals Marlboro rauchen werde.
Mit einem anderen Freund in anderer Lokalität wollte ich das Spielchen wiederholen. Eine Davidoff-Tante trat an unseren Tisch und fragte. Ich bejahte, und sogleich erhielten wir jeder eine Schachtel Zigaretten - und eine einzelne, zum Sofortrauchen. Ich erstarrte. Rauchen? Ich hatte noch nie an einer Zigarette gezogen und bestimmt nicht vor, hier und jetzt damit anzufangen!
In jenem Augenblick kam mein Essen. Ich entschuldigte mich bei der Davidoff-Tante, legte die Zigarette beiseite und aß. Die Zigarettenschachtel trug ich mehrere Tage mit mir herum, bis ich in Halle von einem der üblichen Bettelnden angesprochen wurden: Ob ich nicht mal eine Zigarette hätte. Ich verschenkte die Schachtel und erntete ein Gesicht voller Verwunderung.
G hörte irgendwann mit Rauchen auf. Einfach so. Ich staunte und konnte - mit gewissem Stolz - anderen von ihm berichten, dem es gelungen war, sich der Sucht ohne Schwierigkeiten zu entziehen. Als seine Freundin sich von G trennte, fing er wieder an. G raucht bis heute, doch wenn ihm das Geld fehlt, läßt er es sein. Tagelang. Ich frage nach dem Grund, warum er es nötig hat, trotzdem weiterzurauchen, und er weicht mir aus. Vielleicht weil es keine Antwort gibt.
Wenn ich Menschen erzähle, daß ich noch nie an einer Zigarette zog, dann ernte ich zuweilen ungläubige Blicke. Immer jedoch höre ich davon, daß das gut sei, obwohl ich erwartete, für "uncool" oder ähnliches gehalten zu werden.
Doch Nichtrauchen ist nicht "uncool", war es vielleicht noch nie. Nichtrauchen wird erst "uncool", wenn man es offensiv betreibt, andere von seinen Ansichten überzeugen will, künstlich hustet, wenn in der Nähe jemand eine Zigarette entzündet.
Ich mag keinen Qualm, hasse es gar, in großer Hitze verrauchte Luft atmen zu müssen, bloß weil der Fußgänger vor mir mit Zigarette unterwegs sein möchte. Und kalter Rauch in Kleidungen ist ohnehin abscheulich. Doch ich enthalte mich irgendwelcher echauffierten Belehrungen. Unter Freunden lasse ich hin und wieder eine spitze Bemerkung fallen oder erwähne mit ironischem Unterton, daß Rauchen die Gesundheit gefährdet. Zu abgestumpft jedoch sind sie gegenüber kritischen Worten, um dem hinter dem Witz steckenden Ernst auch nur geringste Beachtung zu zollen.
Auf der Straße entdecke ich Menschen, die sich plötzlich eine Zigarette entzünden. Natürlich kann ich nicht in deren Inneres blicken, sehe nicht den Wunsch nach zigarettistischer Gemütlichkeit, der plötzlich erwacht, oder die Sucht ihr Recht verlangen. Und doch versuche ich die Motivation zu erhaschen, die hinter dem Entzünden der Zigarette steht. Warum ausgerechnet jetzt, wo niemand - außer mir - dieser Person zusieht? Warum jetzt und nicht zehn Schritte zuvor?
Es gibt keinen offensichtlichen Grund, und es ärgert mich, daß ich das Rauchen nicht zu begreifen vermag.
Rauchen ist sinnlos. Das ist keine Belehrung, keine vom Bundesministerium für Gesundheit propagandierte Weisheit, sondern nur eine Feststellung, die ich für mich traf. Ich sehe mich außerstande, im Rauchen einen Sinn zu finden. Doch meine Neugierde ist bei weitem nicht groß genug, um selbst probieren, "mal ziehen", zu wollen, nicht groß genug, um tatsächlich Teil zu werden. Außenstehend fröne ich meiner Neugierde, nicht auf den Geschmack, nicht auf das Rauchen an sich, sondern auf das, was dahinter steckt, auf die Motivation.
Vermutlich werde ich sterben, ohne "es" erfahren zu haben, ohne zu wissen, was es bedeutet zu rauchen.
Ich sehe mich als Opa in einem abgewetzten Sessel sitzen und meinen Enkeln voller Stolz davon berichten, daß ich niemals das Interesse verspürte zu rauchen, daß ich niemals an einer Zigarette zog - und daß ich diese Entscheidung niemals bereute.
"Jaja", werden meine Enkel dann maulen, "das hast du uns schon Hundert Mal erzählt." Und dann werden sie gehen und sich eine Zigarette anzünden.
morast - 9. Jul, 16:20 - Rubrik:
Wortwelten
Ich zeichne.
In Anbetracht dessen, daß ich einen täglichen Comic veröffentliche, kann ich sogar mit gutem Recht behaupten, häufig zu zeichnen. Es fällt mir dabei leicht zuzugeben, daß die erwähnten Comics nicht das NonPlusUltra darstellen, auch inhaltlich, aber insbesondere meine zeichnerischen Fähigkeiten betreffend.
Doch dahinter steckt Absicht. Ich weiß, daß ich zu mehr imstande bin, als Kugeln zu Figuren zu türmen und ihnen Kulleraugen zu verpassen. [Allerdings kann ich nicht umhin zuzugeben, daß ich Kulleraugenfiguren liebe.]
Ich zeichne nicht nur häufig, sondern auch gerne. Vermutlich geht das miteinander einher.
Jedoch fällt es mir schwer zu beurteilen, ob ich auch gut zeichne.
Zeichnen bedeutet für mich die Suche nach der richtigen Linie. In meinem Kopf befindet sich ein Bild, und häufig bin ich nicht imstande, es nachzuzeichnen. Ich probiere, gehe ich Kompromisse ein, wandle Fehler zu Beabsichtigtem und sehe dahinter noch immer, was es eigentlich werden sollte. Zuweilen gelingt es mir, durch Zufall etwas besseres als das Gedachte zu schaffen. Doch selbst dann kann ich nicht stolz sein, ist es doch nicht mein Werk, sondern nur eine freundliche Fügung, daß mein Stift die richtigere Linie fand.
Hinzu kommt der ewige Drang nach Perfektionismus. Selbst eine gelungene Zeichnung enthält noch Unmengen an Fehlern, die für mich unübersehbar entstellend wirken. Doch das Laienauge sieht nicht, erkennt nicht das Detail, nur das Gesamtwerk und erachtet es für gut. Oder für gut genug. Oder vergleicht es mit den eigenen Fähigkeiten und kommt zu dem Schluß, daß es gut sein muß, weil man selbst nicht imstande wäre, Ähnliches zu schaffen.
Doch derlei überzeugt mich nicht. Ich kann nicht sagen, was genau ich hören möchte, wie die richtige Kritik aussieht, jene, die mich anspricht, doch bezweifle, daß es mir hilft - so arrogant es klingt - mit Schlechterem verglichen zu werden.
Es gibt Menschen, die kein Blatt vor den Mund nehmen und mir sagen, was mißfällt, die an meine Zeichnungen gewöhnt sind und ersehen können, daß hier und dort etwas nicht stimmt. Manchmal freue ich mich, das zu hören, fühle mich bestätigt, wiegle ab, sage "Ich weiß..." und belasse es dabei. Nicht selten jedoch fühle ich mich angegriffen, über mein Werk verletzt, als hätte jemand einen Teil meiner Existenz in Frage gestellt. Ein großes, empörtes "Aber..." liegt auf meinen Lippen, bevor es mir gelungen ist, die Kritik überhaupt zu überdenken.
Meistens schweige ich, und Stunden später, in ruhiger Minute kommen mir die kritisierenden Argumente in den Kopf. Nun endlich kann ich antworten, abwägen, zustimmen oder ablehnen. Es ist zu spät, das weiß ich, doch die Kritik ging nicht an mir vorbei.
Und wieder sehe ich meine Grenzen: Zu diesem oder jenem bin ich überhaupt nicht imstande. Die Kritik ist berechtigt und unberechtigt zu gleich.
Meine Grenzen. Zu oft stoße ich auf sie, wenn ich versuche, Linien zu zeichnen, Perspektiven aus meinen Gedanken nachzuahmen. Einst träumte ich, wie man ein bestimmtes Bild zu zeichnen habe, konnte dem zeichenstift folgen, mir jedes Detail in Ruhe betrachten. Ich wußte plötzlich.
Als ich erwachte, entschwand das Wissen, das Bild, hinterließ nur Leere.
Ich habe aufgehört, meine Grenzen zu beachten. Wenn ich eine Zeichnung anfertigen soll, eine Beschreibung erhalte, kann ich bereits erahnen, wie ich das Werk beginnen werde, sehe bereits die Skizze in mir. Und ich erahne, was machbar ist, wozu ich imstande sein werde.
Längst jedoch habe ich aufgehört, Einhalt zu gebieten, wenn ich glaube, nicht fähig zu sein, wenn ich merke, daß mein Können überschritten wird. "Ich werde es versuchen..", antworte ich dann lächelnd und beschwichtigend und frage mich, ob es gelingen wird, mich zu erweitern, mich zu überbieten.
Das Ergebnis überzeugt mich nur in den seltensten Fällen. Selbst wenn alles in orndung zu sein scheint, selbst wenn der Auftraggeber zu Lob bereits ist, weiß ich, was besser hätte sein müssen, wo meine Schwachstellen liegen, daß ich die zeichnung vermutlich überarbeiten sollte, bestünde nicht die Gefahr, alle bereits gefundenen Linien wieder zu verlieren.
Das Endwerk ist ein Komromiß, und der fehlende Perfektionismus betrübt mich.
Mittlerweile darf ich eine Bezahlung verlangen. Ich weiß nicht, was ich wert bin, was meine Linien wert sind, doch ich darf mich hinstellen und darauf warten, daß ein fertiger Auftrag belohnt wird.
"Du kannst etwas, das niemand anderes kann. Verlange entsprechend.", wird mir gesagt, und ich nicke nur.
Ich bin nichts Besonderes, denke ich, kann nichts Besonderes. Ich glaube zu wissen, daß hinter den meisten meiner Zeichnungen weniger Talent als Übung steht. Mit ausreichend Geduld und Anleitung gelänge es sicherlich, nicht minder fähige Zeichner zu kreiieren.
Natürlich kann ich nicht abstreiten, über einen eigenen Stil zu verfügen. Ich bin erfreut, wenn jemand Zeichnungen von mir erkennt, ohne daß ich sie sonderlich kennzeichnete, ohne daß sie mit mir in verbindung zu stehen scheinen, wenn ich darauf angesprochen werde.
Doch was ist ein eigener Stil wert?
Was ist eine Zeichnung wert?
Als ich einer Firma mitteilen sollte, wieviel ich für meine Zeichnungen verlange, erdachte ich mir eine Stundenlohnzahl, die ich nett fand. Sie war, meiner Ansicht nach, maßlos übertrieben, bedachte ich, was ich als Kaufhallenaushilfe für schwere körperliche Arbeit bekommen hatte und wieviel Vergnügen dagegen mir die zeichnerei bereitet.
Als ich jedoch mich bei Wissenden erkundigte, meinten sie, ich verlange zu wenig. Ich erhöhte die Zahl und kam mir wie ein Betrüger vor.
Einmal saß ich an einer Zeichnung zehn Minuten und durfte genug Geld verlangen, um mit einer 6-Stunden-Schicht in erwähnter Kaufhalle gleichzuziehen. Auf einen Stundenlohn hochgerechnet ergab sich eine Zahl, die mich den Schädel schütteln ließ.
Das konnte ich doch nicht dürfen.
"Verkauf dich nicht unter Wert."
Ich schmunzle traurig über diesen Satz. Sicherlich, ich kann zeichnen. Nicht perfekt, aber ganz gut. Wahrscheinlich sogar gut genug, um ausreichend dafür bezahlt zu werden. Doch ich weiß nicht, was "ausreichend" ist, wenn die Arbeit kaum Mühe bereit, ja Freude bringt. Ich weiß nicht, was "ausreichend" ist, wenn ich jeden Fehler sehe, den ich hinterließ, jedes Detail, das vom Erdachten abweicht.
Ich weiß nicht, was ich wert bin. Es gibt Tausende besserer Zeichner. Überall. Sie verfügen über andere Fähigkeiten, über einen anderen Stil, einen anderen Humor. Doch was sind sie wert?
Es ist schwer, sich selbst einzuschätzen. Noch schwerer ist es jedoch, sich selbst, sein eigenes Schaffen in Zahlen, in Geldbeträgen, ausdrücken zu müssen. Bin ich gut genug?, frage ich mich immer wieder und finde keine Antwort.
Was kostet eine Linie?
morast - 7. Jul, 13:24 - Rubrik:
Wortwelten
... der Punker ["Wir sind viele und überall." stand auf seiner Weste und ließ mich darüber sinnieren, wie lahm dieser Spruch doch ist.], der mit seinem Billigmountainbike vor der Drogerie wendete, sich ein paar der draußen stehenden Pakete Küchenrollen bzw Klopapier schnappte und gemütlich davonradelte, beide Lenkerseiten mit Beute bestückt, ohne von irgendjemandem bemerkt zu werden.
... die Schwalbe, die sich erdreistete, in das Zehnquadratmeterzimmer meines Mitbewohners zu fliegen, sich im schmalen Spalt zwischen Bett und Fenster verirrte und erst mit einem übergeworfenen T-Shirt aus ihrer mißlichen Lage befreit und dem Himmel zurückgeschenkt werden konnte.
... das Minitaturinsektenvolk, das sich aus unerfindlichen Gründen [Das Fenster war offen, doch kein Locklicht leuchtete.] an der Zimmerdecke, direkt über meiner Matratze, angesiedelt hatte und von mir erst durch ein feines, aber penetrantes Sirren in meinem Ohr bemerkt wurde. Selbiges stammte allerdings von einer alsbald leblosen Mücke, die mit ihrem Ableben ein gutes Vorbild für das Fliegenvolk bildete, das ich mit einer Probepackung Axe-Deospray von meiner Decke vertrieb. Jedoch mußte ich, um selbst überleben zu können, das Zimmer für zehn Minuten verlassen und warten, bis sich der perverse Deo-Gestank verzogen hatte.
... die Straßenbahn, die sich wesentlich schneller als ich der Haltestelle näherte und mich dadurch beinahe verpaßte, hätte ich nicht meine FlipFlops in die Hand genommen und mich zu einem Barfuß-Sprint auf Beton bequemt, währenddessen ich plötzlich verwundert feststellte, eigentlich viel schneller laufen zu können und noch einmal beschleunigte. Als Ergebnis freuten sich meine Kleider über den hohen Schweißfluß und die Fahrtkartenkontrolleure über meinen fehlenden Studentenausweis und das somit fällige Bußgeld.
morast - 6. Jul, 10:16 - Rubrik:
Wortwelten