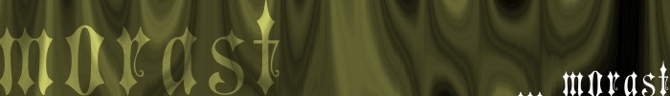Geistgedanken
Ich habe mich noch nicht entschieden, inwieweit es als Produkt meiner Spontaneität erachtet werden kann, daß ich mich gegen 0.15 Uhr doch noch einmal außer Haus begab, um in Richtung der
bereits erwähnten Bar zu radeln und dem dortigen Amüsement zu frönen. Doch begreift man in meinem Fall Spontaneität als das Ergebnis schier endlosen Herauszögerns einer eindeutigen Entscheidung in Kombination mit der Bekanntgabe und dem Ausführen des Entscheids im letztmöglichen Augenblick, so dürfte man nicht falsch liegen, auch meine kurze Reise durch einen erstaunlich dunklen Park als spontan zu bezeichnen.
Ich traf ein und fand - wie erwartet - unzählige Menschen vor, die sich die letzten Stunden der Existenz einer Magdeburger Pingpong-Bar nicht entgehen lassen wollten.
"Du hast die Versteigerung verpaßt.", begrüßte mich meine Mitbewohnerin ein wenig vorwurfsvoll, nicht im Geringsten von meiner Anwesenheit überrascht. Das wiederum überraschte mich, war ich doch selbst, als ich mit beiden Füßen innerhalb der Bar stand, nicht wirklich davon überzeugt, mich auf den Weg gemacht zu haben.
Der Vorwurf war zum Teil berechtigt: Die Versteigerung schien der Höhepunkt des Abends gewesen sein, und wenn man bedenkt, womit ich in den Augenblicken beschäftigt war, als sie vonstatten ging, kann man nur vorwurfsvoll-enttäuscht mit dem Kopf schütteln.
'Immerhin habe ich endlich die Slowakei-Fotos auf eine CD gebrannt.', versuche ich mich mir selbst gegenüber zu rechtfertigen - doch ich glaube mir nicht.
Aber die Bar war voll, die Tischtennisplatte zum Bersten von Spielwütigen umstellt. Ich besorgte mir Premium Cola und Kelle und reihte mich ein. Das Spiel war träge, doch amüsant. Ich erkannte Gesichter, wechselte wenige Worte mit denen, die sie hören wollten. Trotz Massenandrangs kam ich schnell bis kurz vor das Finale, erwarb zwei Runden später sogar einen Siegpunkt.
Ich war stolz auf mich, ein wenig, hatte ich mir - und den interessierten [und daher inexistenten] anderen - doch gezeigt, daß ich in der Lage war, mich bis zum siegreichen Finale durchzusetzen. Und zugleich war ich enttäuscht, hieß doch dieser Gewinn, daß es hier nichts mehr zu holen gab, daß mein Ehrgeiz gar nicht mehr angestachelt werden brauchte.
Einmal ertappte ich mich lächelnd, lächelte weiter, erfreut. Ich pausierte, beschaute die Spielenden, redete mit meiner Mitbewohnerin, mit anderen. Nichts Bedeutsames, nur Smalltalk, Worte, wie sie ein jeder wechseln würde, der in nüchternem Zustand gezwungen ist, Kommunikation zu betreiben.
Ich leerte meine Cola und wagte eine weitere Runde, gelangte ins Finale, erwarb einen weiteren Punkt. Meine Freude hielt sich in Grenzen.
'Es wird Zeit zu gehen.', sagte ich mir, erlebte nur wenige Sekunden der folgenden Runde, flog raus und gab meine Kelle ab.
Der Heimweg durch die Dunkelheit schaffte Klarheit:
Ich hatte inmitten von Punktwütigen problemlos zwei Punkte geholt - ein Beweis meiner noch immer schlummernden Tischtennisfähigkeiten. Doch die Anzahl der Worte, die meinen Mund verlassen hatten, war minimal. Und keines davon ging in Richtung der Wesen, die anzusprechen sinnvoll gewesen wäre.
Wie alt war ich eigentlich, daß ich mir noch immer über derlei Teenagerkaspereien Gedanken machen mußte?
Es ging mir nicht um Geltungsbedürfnis, nicht darum, der Masse zu gefallen, nicht darum aufzufallen [Und es waren genug Barbesucher dabei, denen das Auffallen durchaus vorrangig am Herzen lag.]. Es ging einzig und allein um den Wunsch nach Gesellschaft, nach dem Lächeln fremder Lippen, nach Worten, die mehr als die Oberfläche berührten.
Vielleicht war es albern, in einer Bar danach zu suchen, mit scheuen Blicken in Frage kommende Wesen zu taxieren und jedes mögliche Wort unter der eigenen Zunge versteckt zu halten. Doch wo, wenn nicht hier?
Der Heimweg war zu kurz.
Für einen Augenblick durchzuckte mich der Gedanke, daß ich keinen Schlaf wünschte, ihn für überflüssig hielt, unnütz [wenn man von den Körperregnerationprozessen absah], zeitverschwendend. Ich wollte die Nacht nutzen, fühlte mich frei in der Kühle, die meine nackten Arme berührte, in den Gedanken, die durch meinen Kopf sprudelten, aufgelöst im Moment.
'Albern.', verlachte ich mich und meinte den Wunsch, durch Schlafinexistenz nutzvolle Zeit zu gewinnen. Schließlich hatte ich die letzten Tage nahezu tätigkeitsbefreit vertrödelt, ohne auch nur einen Schimmer von Interesse für die verstreichende Zeit zu haben.
Doch ich wünschte, daß die Nacht noch eine Weile verbliebe, daß ich noch stundenlang durch das Dunkel wandern, mir selbst hinterhersinnen könnte, daß ich mich löste von dem Ich, das träge und antriebslos von Tag zu Tag kroch, ohne Plan und Ziel vor Augen zu haben, ohne sich selbst ändern zu können, ja zu wollen.
Ich wünschte, ich hätte einen Begleiter an meiner Seite, mit dem ich meine Gedanken teilen könnte, jemanden, der mit mir den Duft der Bäume im Park genoß, sich an der Stille auf den Straßen erfreute, die Glitzeraugen streunender Katzen bewunderte.
Ich wünschte mir, nicht allein zu sein, nicht in diesen wunderschönen Momenten.
Und ich wünschte, fliehen, einen Schlußstrich ziehen zu können, wieder einmal einfach alle Sachen zu packen und woandershin zu eilen. Ich wünschte, mein Studium wäre beendet, und ich bekäme Gelegenheit, irgendwo neu zu beginnen.
Dann könnte ich der Einsamkeit einen Namen geben, könnte mir einreden, es läge daran, weil ich noch so neu hier sei, noch niemanden kennen würde, könnte mich belügen und mir verschweigen, daß sich auch hier die gleichen Geschichten wiederholen werden.
Ich belüge mich, rede mir ein, ich hätte dieses und jenes Bedeutsame zu tun und verbringe die Tage damit, darauf zu warten, daß ich endlich beginne, anstatt mich mit Dingen zu beschäftigen, die ich tun möchte, die ich mir ersehne.
Ich belüge mich und glaube, daß in ein paar Monaten, wenn sich die Situation geändert, wenn in gewissen Umständen Klarheit eingekehrt ist, alles besser, alles verständlicher, vielleicht einfacher sein wird, daß ich mich dann all dem Ersehnten, Versäumten, hingeben kann.
Doch so ist es nicht, und ich weiß es, verharre im Heute, um der Zukunft nicht begegnen zu müssen. Vielleicht habe ich Angst vor ihr, Angst vor neuen Wegen, neuen Entscheidungen, Angst vor Verlusten, vielleicht vor dem Verlust eines Teiles meiner selbst.
Doch vielleicht verlor ich längst, verlor ich mich längst in meiner eigenen Trägheit.
'Sprich sie an.', flüsterte ich mir zu, als ein sympathisches Mädchen [Gibt es eigentlich einen erwachseneren Ausdruck als "Mädchen", der nicht "Frau" lautet?] sich hinter mich in die Tischtennisschlange einreihte.
'Sprich sie an.', doch ich schwieg, bewunderte sie heimlich, genieße ihre Nähe.
Später bemerkte ich, daß ich noch nicht einmal so weit gekommen war, mich zu fragen, welche Worte wohl die geeignetsten wären.
Daß die Trägheit mich festhält, gefangenhält, begriff ich längst. Doch ich selbst bin es, bin die Trägheit, bin der einzige, der mich befreien, der sich entfesseln kann.
'Ein Neuanfang.', denke ich und lächle, 'Ein Neuanfang. Irgendwo.'
Flucht als Perspektive - auch kein neuer Gedanke.
'Wer bin ich, daß ich alles Alte aufwärme und noch immer keinen Antwort fand?', wundere ich mich und schüttle mit dem Kopf.
Der Wind spielt in meinem Haar, und ich genieße den Rausch der Geschwindigkeit.
'Wie war doch gleich die Frage, die es zu beantworten gilt?', überlege ich. Ich weiß es nicht, glaube aber, nicht keine, sondern unzählige Antworten gefunden zu haben. Sie alle zeigen, deuten auf mich, behaupten, daß ich es wäre, mein Wille, der mich aus dem Dreck zu zerren, mir eine Richtung zu weisen habe.
Träge gebe ich mir recht und nicke wortlos in die Dunkelheit.
morast - 1. Sep, 02:58 - Rubrik:
Geistgedanken
Die Selbsterkenntnis verletzt mich.
Nicht nur, daß ich mich irgendwie einsam fühle - nein, ich verleugne es mir gegenüber auch noch.
Meine Mitbewohnerin beispielsweise eröffnete unlängst mit ihren Freundinnen eine außergewöhnliche Bar. Ich besuchte diese bereits zwei Mal und hätte heute, jetzt, Gelegenheit, sie ein drittes und letztes Mal aufzusuchen. Schließlich wird sie ab morgen Geschichte sein, war die Bar doch nur für einen Monat geplant.
Doch anstatt mich aufzuraffen, dort hinzugehen, überlege ich, ob es nicht besser wäre, ins Bett zu fliehen und am nächsten Morgen zeitig, in aller Frühe, aufzustehen und [endlich] anzufangen, intensiv zu lernen. Doch schon jetzt weiß ich, daß ich nicht zeitig aufstehen und daß ich vermutlich die erste Stunde nach dem Erwachen sinnbefreit rumgammeln werde, ohne auch nur einen Gedanken an Nützliches [Das schließt Frühstück mit ein.] zu verschwenden.
Was mich in Wirklichkeit zu halten scheint, ist der unschöne Umstand, daß ich in diese Bar alleine zu gehen/fahren habe, daß mir niemand einfällt, der um diese Uhrzeit, in dieser Stadt, bereit wäre, mich zu begleiten und mir den restlichen Abend zu versüßen. Tatsächlich befinden sich die wenigen Personen, die als angenehme Begleitung in Fragen kämen, in unüberbrückbar großem Abstand zu mir
Sicherlich wäre es ein Leichtes, dort einfach aufzukreuzen, sich mit meiner Mitbewohnerin, ihren Freundinnen und Freunden [mir zumeist nicht unbekannt] zu unterhalten, mich beim Tischtennisspiel zu amüsieren und flaschenweise Premium Cola in mich hineinzuschütten.
Doch ich will nicht, will nicht wieder abhängig von den erwähnten Personen sein, wäre lieber selber mit jemandem da, mit irgendwem, der auch noch an der eigenen Seite verweilt, wenn sämtliche Smalltalkthemen verschütt gegangen sind.
Träfe ich dort ein, gestände ich mir selbst ein, schon wieder ohne Begleitung anzukommen, schon wieder nur einer dieser Niemande zu sein, die an belebten Orten nach Gesellschaft suchen, die darauf hoffen, von irgendwem - vielleicht sogar einem hübschen Mädel - angesprochen, ja geschätzt zu werden. Ich gestünde mir ein, in Redepausen, zwischen leeren Themen und tiefgreifendem Philosophieren, in nüchterner Erkenntnis zu versinken, daß ich schon wieder schweige, schon wieder auf einem Stuhl sitze, dessen Nachbarplätze frei blieben. Ich gestünde mir ein, unfreiwillig allein zu sein.
Bleibe ich aber, beschäftige ich mich weiterhin mit Pseudowichtigem, gehe ich alsbald ins Bett, so kann ich mir einreden, absichtlich allein, ohne Gesellschaft, geblieben zu sein, absichtlich die Stille gesucht zu haben, um ungestört zu sein, um die Musik im Hintergrund nicht durch albernes Gerede gestört zu wissen.
Ich kann morgen früh aufstehen und mein schlechtes Gewissen, die letzten Tage müßig verbracht zu haben, mit der Gewißheit trösten, mich selbst am vergangenen Abend mit Ausgehverbot gestraft und zu intensiverer Lernleistung animiert zu haben.
Oder ich erwache und begreife, daß ich mal wieder eine Chance vertat, andere Menschen kennenzulernen, mich unter fremde Leute zu mischen, die Gedanken einfach mal gehen zu lassen, mich anderem zu widmen - daß ich mal wieder eine Gelegenheit verpaßte zu leben.
morast - 31. Aug, 23:35 - Rubrik:
Geistgedanken
There's no way to the future.
No way out at all.
morast - 5. Aug, 00:50 - Rubrik:
Geistgedanken
Es ist erschreckend festzustellen, wie fest ich mich einst an sie klammerte, wie sehr ich sie mit mir, mit meiner Anwesenheit, bedrängte - in dem festen Glauben, das einzig Richtige zu tun, sie somit dazu bewegen zu können, mir die Sicherheit zu geben, die ich ersehnte.
Es ist erschreckend festzustellen, daß ich jahrelang stillstand, einfach nur wartete, darauf wartete, daß sie sich entscheidet zurückzukommen, zu mir zurückzukehren, daß sie einsah, was - in meinen Augen - das Beste für sie war, daß sie begriff, daß ich es war, den sie suchte.
Es ist erschreckend festzustellen, daß ich - irgendwo in mir - noch immer warte.
morast - 3. Aug, 14:17 - Rubrik:
Geistgedanken
Vielleicht ist diese Beziehung eine befremdliche, eine unmögliche. Vielleicht sind aber Beziehungen stets das Gegenteil von einfach, stets verworren, für Außenstehende nicht nachvollziehbar. Vielleicht.
Ich versuche mir darüber klar zu werden, wer ich bin, was ich will, was ich empfinde, ja auch, was sie empfindet. Die Antwort auf die letzte Frage ist vielleicht die schwerste. Vielleicht auch die einfachste, bedenkt man, daß ich nach mehr als zwei Jahren noch immer nicht imstande zu sein scheine, Antworten zu finden, mir Antworten zu geben, mir selbst zuzugeben, was ist.
Dabei kann es nicht allzu schwierig sein, das Gegenwärtige auszudrücken. Ich liebe sie. Sie liebt mich nicht. Vermutlich. Ich weiß es nicht, will es mir nicht eingestehen.
Und damit beginnt die Misere. 'Vielleicht...' denke ich, immer wieder, und hoffe.
"Die Hoffnung ist mein Untergang.", schrieb ich einst und glaube es noch immer. Hoffnung birgt Trost, doch auch Unmengen von Schmerz.
Ich versuche, mich zu verstehen, zu erfassen, was ich fühle.
Manchmal zweifle ich an mir, an meiner Liebe zu ihr. Dann wieder scheint alles klar, einfach, gesichert: Ich liebe sie, tiefer und inniger denn je. Zuweilen bedarf es nur eines Blickes, eines Wortes, und ich weiß, was ich empfinde, fange mich selbst mit meiner Liebe, sperre mich in einen Käfig aus Unerreichbarkeit.
Unerreichbarkeit? Ja, Unerreichbarkeit. Denn ich kann sie nicht erreichen. Sie weiß, weiß um meine Gefühle, um meine Liebe, kann sie nicht ignorieren - und schafft es doch. Ich weiß nicht, ob es ihr schmerzt. Wenn ja, tut es mir leid, ist es doch nicht mein Wunsch, ihr Schmerz zuzufügen. Wort für Wort, Blick für Blick, reihe ich aneinander, doch erreiche sie nicht.
'Vielleicht ja doch.', denke ich und hoffe schon wieder.
Unerreichbarkeit gilt aber auch in umgekehrtem Sinne. Ich will nicht erreicht werden, unsichtbar sein, nur für sie existieren. Sicherlich, das ist dumm und weltfremd. Zuweilen unterbreche ich mich, um zu leben. Doch immer wieder flüchte ich aus dem Dasein und suhle mich in meiner Liebe, die Schmerz und Trost heißt, die Sehnsucht und Verzweiflung birgt.
Ja, ich liebe sie. Es ist einfach, das zu denken, zu schreiben. Doch ich kann es ihr nicht sagen. Ich will nicht ihre Tränen sehen, nicht ihre Verzweiflung. Und erst recht will ich nichts von der Unmöglichkeit hören, will ich nicht meine Hoffnungen begraben wissen.
Denn ich weiß, daß da etwas ist. Vielleicht ist es keine Liebe, doch ist es mehr als nur schlichte Freundschaft, mehr als nur ein Einanderkennen und -mögen. Und ich kralle mich an den Gedanken, daß dieses "mehr" vielleicht wachsen wird, vielleicht zurückkehren kann zu der Liebe, die es einst hätte sein sollen.
Die Beziehung hat vor mehr als zwei Jahren ihr Ende gefunden. Ist beendet worden. Von ihr. Nach nur drei Monaten.
Vielleicht, wahrscheinlich, hatten wir einander nur zu einem falschen Zeitpunkt gefunden. Vielleicht, wahrscheinlich, waren äußere Faktoren nicht unschuldig an der Trennung. Vielleicht lebten wir auch ein Mißverständnis. Vielleicht.
Ich glaube, daß es vorbei ist, was immer es genau war, was immer uns damals auseinanderzerrte [Denn mit Sicherheit gab es keinen präzise zu beziffernden, einzelnen Punkt, der alle Schuld auf sich laden konnte.]. Ich glaube, daß es jetzt funktionieren würde. Mit uns. Noch einmal. Doch dieses Mal "mehr". "Richtig". Länger.
Und an diesem Glauben, an dieser Hoffnung halte ich fest. Vielleicht warte ich tatsächlich auf sie. Vielleicht.
Warum auch nicht? Sie ist es wert. Dessen bin, war ich mir stets sicher.
Doch ich erreiche sie nicht. Sie sieht mit nicht, will mich nicht sehen, stöbert durch die Welt und findet. Vielleicht nicht das, was sie sucht, doch Trost, Halt, Wärme, Nähe, das Gefühl, zuweilen geliebt zu werden, ausreichenden Ersatz für mich. Ich weiß noch nicht einmal, ob sie jemals mit den Gedanken spielte zurückzukehren, weiß nicht, was sie wirklich für mich empfindet, weiß nicht, ob sie jenes "mehr" auch verspürt oder einfach nur Freundin zu sein glaubt, einfach nur jemand, der mich kennt, schätzt und versteht.
Sie versteht mich. Vielleicht ist es das. Nur drei Monate waren ausreichend, um mich geborgen, verstanden zu fühlen wie noch nie, um zu wissen, daß sie vielleicht die Ewigkeit für mich bedeuten konnte, daß sie mich vielleicht mehr begriff, als ich es je könnte.
Die Frage, die bleibt, ist die, was sie empfindet, was sie von mir hält. Es ist immer das gleiche Spiel: Was denkt sie? Was geht in ihrem kopf, ihrem Herzen vor? Was bedeute ich ihr? Was sieht sie in mir?
Und diese Fragen sind wichtig, bergen sie doch die Antwort auf alles weitere. Wenn ich ihr nichts geben könnte, wenn ich sie nur ausnutzte, aussaugte, ihr kein Leuchten, keinen Gewinn brächte, würde sie mich wohl meiden, würde sie sich niemals derart in meine Nähe begeben, wie sie es noch immer tut.
Ich bedeute ihr etwas. Doch was? Warum betrübt es sie, wenn ich sie "vergessen", vernachlässigt zu haben scheine? Warum betrübt es sie, als wäre meine Liebe die Basis unserer Beziehung, unserer "Freundschaft"? Geht sie davon aus, daß meine Liebe ewig verweilen wird, auf sie wartet, sonnt sie sich im Glanz meiner Gefühle? Genießt sie vielleicht mein Sehnen und denkt hin und wieder daran zurückzukehren, Träume zu erfüllen, die unerfüllbar zu sein scheinen?
Doch warum kommt sie dann nicht zurück? Warum weilt sie dann in der Ferne, in fremden Armen, die ihr - trotz allem - nicht ausreichen, nicht all das geben können, was sie ersehnt?
Kann ich es? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Wie könnte ich?
Doch tatsächlich bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß, was ich anders, besser, machen würde, könnte, daß Eigenschaften in mir wohnen, die sie ersehnt. Ich weiß, daß ich sie liebe, daß ich es ihr mit jedem Lidschlag, mit jedem Atemzug, zeigen würde.
Zwei Jahre sind eine lange Zeit. Sie hätte längst zurückkommen können, sollen. Warum tat sie es nicht? Warum? Sinkt nicht mit jedem vergehenden Tag die Wahrscheinlichkeit, daß sie zurückkehrt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es mal wieder nicht.
Warum sollte sie nicht - ebenso wie ich zu Kurzschlußhandlungen neigend - eines Tages spontan feststellen, daß ab nun ich, nur ich, der Richtige, der Einzige, ihre wahre Liebe, sei? Warum nicht? Die Welt ist wirr und albern.
Vielleicht sollte ich mich "bessern". Bodenständiger werden. Nur abhängig von mir selber, mich stärken, Willen und Körper. Voranschreiten, eigene Wege schaffen. Vielleicht sollte ich in meinem Leben weitergehen, aufsteigen und der Welt zeigen, daß ich es schaffe, daß ich es kann, daß ich bin, was ich bin, daß ich mag, wie ich bin, meinen Unsicherheiten begegnend, mich meinen Ängsten stellend. Vielleicht.
Vielleicht wäre ich dann attraktiver, anziehender, nicht mehr der kleine Junge, dessen einziger Sinn im Leben die Liebe zu sein scheint. Vielleicht wäre ich dann weniger anhänglich, weniger sehnend. Vielleicht.
Vielleicht wäre ich mir dann aber fremd, ein anderer, vielleicht auch ihr fremd, noch ferner. Wer weiß.
Vielleicht sollte ich mich lösen. Vielleicht hätte ich mich längst lösen sollen. Ich versuchte es. Durchaus. Damals war es zu früh. Heute wäre ich dazu bereit. Glaube ich.
Kann man zwei Menschen lieben? Ja, durchaus. Ich bin mir sicher.
Die Situation ist also nicht ausweglos. Nur unendlich verworren.
Ich wüßte nicht, was ich ohne sie täte. Allein der Gedanke, sie irgendwann nicht mehr sehen, nicht mehr mit ihr reden zu können, schmerzt. Ich verdränge ihn, vergesse ihn. Warum soll ich mir Schmerz aufbürden, der nicht zu vergehen vermag?
Ist meine Liebe zu ihr vergänglich? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Bisher verging sie nicht. Ich will es nicht wissen. Erst recht vermag ich nicht zu vergleichen. Liebe ich sie mehr/weniger als "damals"? Ich weiß es nicht.
Kann man, kann ich, zwei Menschen lieben? Könnte ich einem Wesen in meinem Herz so viel Platz schaffen, daß ich nicht ständig sehnsüchtig ihr hinterhersehne, die mich längst verließ? Vielleicht. Wahrscheinlich. Ja.
Und was wäre dann mit ihr? Wie empfände sie? Freute sie sich? Weil ich endlich aufhörte, sie mit meiner Liebe zu belasten? Freute sie sich für mich, weil ich es endlich "geschafft" zu haben scheine? Letzteres ist wahrscheinlich.
Wäre sie betrübt, weil ich nun für sie verloren wäre, weil nun nicht länger all meine Liebe ihr gelten würde? Vielleicht.
Die Schwierigkeit meiner Situation liegt nicht in ihrer Unklärbarkeit, sondern in ihrere Stagnation. In freien Augenblicken denke ich nach, sinniere, stürze mich in Hoffnung, in Licht und Leid. Ich vermag keine Antworten zu finden. Vermutlich wüßte auch sie keine.
Und so verbleibt mir nichts weiter, als Schritt für Schritt der Zukunft entgegenzuschlendern, als hielte sie Gutes bereit, als klärte sich mein Fühlen, meine Liebe, in künftigen Tagen, als wäre die Liebe in mir nicht vergebens.
morast - 16. Jun, 20:00 - Rubrik:
Geistgedanken
Ich denke nach. Oft und gerne. Es fällt mir leicht nachzudenken, Gedanken hinterherzusinnen, die wie von selbst in meinem Kopf erscheinen, sich ausbreiten, dünne Netze weben, deren Fäden ich folge. Manchmal verliere ich mich, verliere den Faden, rutsche ab, treibe in andere Gefilde. Manchmal bleibe ich aber, finde den Weg zur Mitte, zu einem Ergebnis, zu einer vermeintlichen Lösung, einer möglichen Erkenntnis.
Wenn ich nachdenke, dann meistens über mich. Selbst wenn ich nicht über mich nachdenke, bin es doch ich, ist es doch meine Welt, die mich zum Denken anregt. Alles gehört dazu, jede Kleinigkeit, jedes Detail. Alles ist irgendwie ich, Teil von mir. Ich betrachte mich, wie ich in der Gegenwart umherirre, betrachte meine Vergangenenheit, erinnere mich und folge den Erinnerungen in ihre, in meine, Zukunft. Ich schlußfolgere, sehe mich wie von einem entfernten Standpunkt aus, wundere mich über meine Taten, meine Gedanken, über die Welt, die mich umgibt und analysiere. Wo begann es? Wo führt es hin?
Ich sehe mich vor Problemen stehen und erkenne Ursachen, sehe die Wurzeln meiner Ängste, glaube mich zuweilen zu verstehen, glaube zu wissen, was ist, wie ich agieren werde, wie ich handeln sollte, um nicht alten Fehlern zu begegnen, um nicht endlos in der Starre zu verharren.
Ich fülle Seiten mit Worten, die Sinn ergeben, mit Schlußfolgerungen, die logisch erscheinen, mit Fragen, die ich zu beantworten vermag. Doch ich glaube mir nicht.
Immer beschleicht mich das Gefühl, ich würde mich selbst belügen, ich würde nur winzige Teile der Wahrheit erkennen, winzige Teile von mir begreifen. Ich sehe meine Antworten und weiß, daß das nicht alles ist, daß mehr dahinter steckt, sich vor mir verbirgt, unentdeckbar zu sein scheint. Ich sehe meine Antworten udn weiß, daß es längst nicht alle waren, daß immer wieder neue Fragen auftauchen, deren Antworten mir verborgen bleiben oder wiederum neue Fragen keimen lassen.
Ich denke darüber nach, was ich bin, wer ich bin, was ich will, wohin meine Wege führen könnten, wer welche Rolle in meinem Dasein spielt. Ich denke darüber nach, was sein könnte, was gewesen sein könnte, ob andere Vergangenheiten eine bessere Zukunft gebären würden, ob andere Schritte "richtiger" gewesen wären. Ich denke darüber nach, was ich fühle, warum ich es fühle, ob es sinnvoll ist zu fühlen, was es nützt, ich zu sein.
Und ich denke darüber nach, daß keine Antwort ausreichend wahr ist, daß ich mit jedem Wort, mit jedem Gedanken nur einen Teil zu erfassen glaube. Es ist, als beleuchtete ein Licht nur kleinste Ausschnitte eines riesigen Ganzen, und ich versuchte, mir aus den Teilen des Mosaiks ein Bild zu formen, ein Bild, das Sinn ergibt, ein Bild, das - womöglich - mich selbst zeigt. Es bedarf nur einer anderen Stimmung, nur einer anderen Denkrichtung, nur einer anderen Eingebung, um mich eine andere Wahrheit entdecken zu lassen, um mir ein neues Teil des überdimensionalen Mosaikbildes aufzuzeigen, dessen Gesamtheit womöglich die Antwort auf all meine Fragen beinhalten könnte.
Doch ich sehe es nicht, finde das Bild nicht, kann es niemals vollständig erfassen, aufnehmen, begreifen. Nur Funken, Splitter, verbleiben in meinem Geist und formen Gedanken, die richtig klingen, doch zu wenig sind.
Vielleicht ist es tatsächlich eine Art Suche nach Selbsterkenntnis, die mich unbewußt erfüllt; vielleicht will ich tatsächlich finden, wissen, erkennen. Vielleicht jedoch will ich gar nicht, vielleicht gibt es kein bewußtes Wollen, nur den Strudel der Gedanken in meinem Kopf, der mich zwingt, immer wieder in alle Richtungen zu sehen, zu denken, und Lichtblicke zu erfahren, die sich mir als "wahr", als "richtig", offenbaren - doch sich im nächsten Augenblick als unzureichend herausstellen.
Ich weiß nicht, wer ich bin, weiß nicht, warum ich so oder so agiere, reagiere, kann keine Antwort finden auf die Frage nach meinen Gründen, nach meinen Trieben, nach meinen Antrieben, glaube längst nicht, mich entdeckt zu haben.
Ich sehe Ängste, die mich lähmen, doch kann ihnen nicht begegnen, obwohl ich mir ihrer Lächerlichkeit bewußt bin. Ich sehe meine Liebe, die mich bewegt, mich lachen und weinen läßt, doch vermag ich nicht, sie zu kontrollieren, in andere Richtungen zu lenken, sie zu durchschauen. Ich sehe mich, wie ich versuche, mich selbst zu begreifen und weiß, daß ich schon zuvor Tausende Male bei dem gleichen Versuch versagte - ohne daß mir das Versagen oder das Wissen darüber Nutzen geschenkt, einen Weg aufgezeigt hatte, dessen ich habhaft werden konnte.
Ich sehe mich fliehen, wieder und wieder, in andere Welten, weil die Wirklichkeit mir nicht wirklich genug ist, weil sie vollgestopft ist mit meinen eigenen Gedanken, meinen Ansichten, meinen Hintergründen, mit meinen Anschauungen, mit meinem Wissen, mit meinen Worten. Überall begegne ich mir, höre meine Stimme denkend das Begreifen ersuchen. Ich versuche zu verstehen und danach zu handeln - doch verstehe ich zu wenig.
Und dann wünsche ich mir, ich würde verstummen, jemand drehte den Klang meiner Gedanken ab, ließ ihn lautlos verschallen, als gäbe es ihn nicht. Ich wünschte, fremde Stimmen würden meinen Schädel befüllen und mir aufzeigen, daß ich mich irrte, daß alles anderes, vielleicht leichter, wäre, daß es nicht meiner unzähligen Gedanken bedürfe, daß man nur die Augen zu verschließen bräuchte, um des Gesamtbildes habhaft zu werden.
Oder ich wünschte mir, ich könnte mich fortstehlen, würde von einem Wirbelsturm hinfortgetragen werden, ließe mich selbst zurück. Ich weiß nicht, was ich wäre ohne all diese Gedanken, ohne diese Gefühle, ohne das Sehnen nach mehr, ohne das Begreifen der eigenen Unkenntnis, ohne mich. Ich weiß nicht, was ich wäre, ohne meine Liebe, ohne meine Ängste, ohne meine Hoffnungen, ohne die zahlreichen Versuche, alles zu durchschauen, alles in mir aufnehmen zu können. Ich weiß es nicht.
Und dann begreife ich, daß es gut ist, was, wer, ich bin, daß ich mich eigentlich dabei wohl fühle, meine Existenz leben zu können, daß ich mich wohl bei einer Auswahlmöglichkeit wieder für mich, für mein Dasein, für mein Denken, entscheiden würde, daß ich mich mag, wie ich bin.
Und dann begreife ich, daß ich selbiges schon längst begriffen hatte und trotzdem immer wieder versuchte, tiefer zu gehen, mehr zu verstehen, an mir verzweifelte, an der Unlösbarkeit der eigenen Wege, der eigenen Gedanken, daß ich trotzdem, trotz des Wunsches nach meinem eigenen Leben, so wie es ist, trotz der befremdlichen Akzeptanz meiner selbst, trotz der erstaunlicherweise existierenden Liebe zu mir selbst, von mir zu fliehen versuchte, mich zuweilen ausschalten, vernichten wollte, als berge diese Tat die einzige Lösung aller Fragen.
Und nun?, frage ich mich dann - und mache weiter wie bisher, Schritt für Schritt in die Ungewißheit des Kommenden, stagnierend, voller Fragen, voller Antworten, die allesamt unzureichend erscheinen. Ich atme, lebe, als wäre es das Normalste der Welt, und bleibe ich, wasimmer ich tue.
Und nun?, frage ich mich dann - und finde wieder keine Antwort.
morast - 15. Jun, 17:12 - Rubrik:
Geistgedanken
Ich kenne sie nicht. Ihr Name ist ein nie vernommener Klang in meinem Ohr, ein Stück Leere, wo Silben hätten die Stille befüllen sollen.
Ich kenne sie nicht, doch weiß genug, um mich fernzuhalten, um ihre Unerreichbarkeit zu respektieren, um keine Worte, nur Gedanken, zu verlieren.
Ich kenne sie nicht. Einst waren wir Teil desselben Dialoges, ein jeder als erwähnenswertes Anhängsel der eigenen Begleitung. Irgendwann in der Vergangenheit, als wir auf einer Wiese den ersten Strahlen eines fernen Frühlings frönten.
Ich kenne sie nicht, doch begegne ihr häufig, versuche ihre Blicke zu fangen, grüße sie mit einem Lächeln, mit einem leichten Nicken des Kopfes , mit zwei gehauchten Silben.
Und jedesmal grüßt sie zurück. Brennt ihr Lächeln in meinen Geist, bezeugt ihre unschätzbare Schönheit.
Vielleicht verliebte ich mich - einst, damals, als ich längst liebte. Vielleicht ist es nur ihr Antlitz, das mich verzauberte, immer neu verzaubert, ihr Lächeln, das mich reizt, mich träumen, versonnen gleichfalls lächeln läßt.
Vielleicht.
Ich kenne sie nicht. Doch dessen bedarf es nicht, um ihre Schönheit zu verehren, jeden ihrer Schritte erfürchtig betrachten zu wollen, um in leisen Augenblicken heimlich von ihr zu träumen...
morast - 8. Jun, 21:42 - Rubrik:
Geistgedanken
Das Erstaunliche an der Leere ist, daß sie sich nicht auf mein Dasein beschränkt und dieses zu einer schlichten Existenz reduziert, daß sie sich nicht damit begnügt, meine Schritte erlahmen, meine Wege verblassen zu lassen, jeden Willen zu rauben und jeden Wunsch zu löschen, sondern auf mein gesamtes Ich, das mehr zu sein glaubt als das bloße Existieren, überspringt, daß sie in mein Denken kriecht und alles löscht, was träumt, mit Gleichgültigkeit füllt, was sich freuen, was trauern könnte, mit einem endlosen Grau jeden Gedanken beschmiert.
Ich treibe voran, zurück, auf der Stelle, und die Leere hält mich in ihrem Bann, löscht die Worte in meinem Schädel, in meinen Fingern, tilgt das Lächeln aus, kratzt das Funkeln aus den Augen, saugt an meinem Antlitz, an gläserner Starre, als könnte es noch den letzten Atemzug aus meinen Mundwinkeln rauben. Tränen versiegen in trockenen Höhlen, als wären sie zusammen mit den Farben dem endlosen Grau gewichen.
Meine Schreie sind matt und kraftlos, vermögen kaum, meine Lippen, mein Herz hinter sich zu lassen, dümpeln schleiertrüb durch das Dunkel und finden kein Gehör. Mein Lachen ist taub und tonlos, schallt hohl von steinernen Wänden wieder. Die Leere besetzt jeden Teil meines Leibes, meines Lebens, als gehörte ich ihr, als hätte es nie eine Wahl gegeben.
Wenn ich flüstere, vermag ich kaum, meine eigenen Worte zu verstehen, höre mich selbst altbekannte Lieder abspulen, eigene Klänge wiederholen, als wäre ich nicht zu Neuem imstande, als wäre das Gewesene das einzige, nur das Vergangene verbleibend.
Ich vermisse das Kitzeln in meinen Zehen, zu weiteren Schritten drängend, das Unbekannte suchend.
Ich vermisse das Sehnen, das mehr erträumt als Nähe, das mehr vermißt als nur irgendwen.
Ich vermisse das Lächeln auf meinen Lippen, das jeden Tag mit meinem Donneratem, meiner Lebenslust füllen, das jedes Himmelgrau zur Nichtigkeit, jeden Augenblick zum schönsten erklären könnte.
Ich vermisse das Zittern in meinen Fingern, wenn ich in Gedanken deinen Namen male.
Ich vermisse die Schreie in meinem Kopf, die Tränen auf meinen Wangen, die Abgründe meiner Seele, die mich spüren lassen, daß ich bin.
Ich vermisse das Leuchten im Herzen, das Wissen, daß alles gut werden wird.
Ich vermisse die Stürme in meinem Schädel, die mich geleiten, begeliten, fordern, die mich nicht ruhen, kaum atmen lassen.
Ich vermisse das Leben als Traum, als schlafwandlerisches Voranschreiten durch die Unwirklichkeit der Gegenwart, verbinden mit der Leichtigkeit des Unmöglichen.
Ich vermisse den Verlust der Lähmung, das Ende der Starre, vermisse den Inhalt meiner Leere.
Ich vermisse mich selbst, fühle mich verloren auf aschegrauen, leeren Wegen und vermag nicht länger, mich zu finden, mich zu suchen...
morast - 5. Jun, 23:42 - Rubrik:
Geistgedanken
Heißkalte Winde peitschen durch einst prachtvolle Gemäuer, wirbeln den Staub des Gewesenen, des unvergänglich Bebenden, des unbeständig Bestehenden, auf und blasen ihn mir ins Leben, ins Herz, ins Gesicht, bis alle Tausend Augen tränen...
morast - 1. Jun, 22:06 - Rubrik:
Geistgedanken
Was sagt man, wenn die Schönheit jeden Atem raubt, Momente der Zeit entreißt, Augenblicke nur dir, nur deinem Anmut gelten läßt?
Warum sollte ich nicht verstummen im Angesicht deiner Schönheit? Wie sollte ich nicht das Schweigen suchen, um deine erhabene Stille nicht zu verletzen? Wie sollte ich nicht mich lächelnd laben an dem, was mein Auge, was deine Gestalt mir schenkt?
Vielleicht bist du alles, mein Leben, mein Dasein, meine Zukunft, mein Weg. Vielleicht bist du meine Zärtlichkeit, Quell meiner Liebe, Ziel meiner Küsse. Vielleicht bist du alles.
Mein Schweigen erglimmt zum Lächeln. Kein Wort könnte dich halten. Ich wage es nicht, berühre nicht die gläserne Zerbrechlichkeit deiner zarten Schönheit mit meinen rauhen Stimme, beschmutze nicht deinen Zauber mit meiner Wörter Klang. verletze nicht deine Nähe durch die meine, verletze dich nicht, verletze mich nicht...
... bis du fortgehst und ich dich nicht zu halten vermag ...
morast - 31. Mai, 14:44 - Rubrik:
Geistgedanken