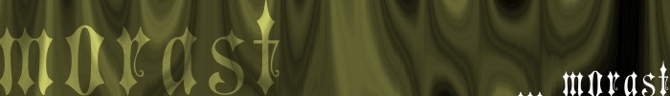Abseits der lärmenden Masse, des trunkenen Trubels sich einen Platz zu suchen, umrandet von Elbarmen und grünendem Geäst, inmitten wohlgesonnener Gemüter, in der Wärme glimmender Holzkohlebriketts, den Klängen der Klamphe, den tiefherzigen Falschtongesängen zu lauschend, einzustimmen, zu schweigen, zu betrachten, das eigene Lippenlächeln zu bewundern und eigene Gedanken auf fremden Lippen wiederzuentdecken, die harsche Geschwätzgewalt, die unwerten Rauschworte in den Hintersinn verschiebend, im Rausch der vereinzelter Augenblicke trauter Teil zu werden, im Schweigen einen Freund zu finden und trotzdem zu lachen, die munteren Masken der anderen zu sammeln und zu mögen, zu erwachen im geteilten Raum, Fremdatem erahnend, nicht fern, nicht nah, doch vertraut, für Momente gewünscht, mit Wonne beschenkt, als wäre der Tag ein guter.
morast - 6. Mai, 02:23 - Rubrik:
Wortwelten
"Ist da noch grüner Salat?"
"Nachts sind alle Salate grau!"
morast - 6. Mai, 02:06 - Rubrik:
Fetzen
Ich beschwere mich. Ich habe allen Grund, mich zu beschweren.
Seit November letzten Jahres sitze ich an meiner Studienarbeit und komme nicht voran. Sicherlich wäre es hochnäsig, meine Arbeitsweise als eifrig und zielorientiert zu bezeichnen; schließlich bin ich ein lahmer, fauler, sich selbst ablenkender Nichtswisser, wenn mich etwas nicht zu fesseln vermag. Doch anfangs war ich gefesselt, war eifrig dabei, suchte Fakten, fand keine, suchte weiter und weiter, drang tiefer in die Materie, sammelte Material, Informationen, fühlte mich stolz, etwas zu leisten.
Zwischendurch hatte ich Prüfungen zu absolvieren, Ferien zu ignorieren und immer wieder meinen "Mentor" zu besuchen, der jedesmal nach gleichem Prinzip agierte. Wollte ich mich mit ihm treffen, so hatte ich das telefonisch oder per Mail anzukündigen, erreichte ihn aber nur selten oder erhielt in den wenigsten Fällen eine Antwort. Falls doch, lag der Termin zumeist am Ende der nächstfolgenden Woche, und eine Menge Leere war bis dahin zu überbrücken.
Wenn ich zu dem vereinbarten Termin bei ihm eintrudelte, blieb ich meist nur drei bis fünf Minuten in seinem Zimmer; er bombadierte mich mit Aufgaben [allesamt im Stil von "Finden Sie heraus..." oder "Kümmern sich sich mal um..."], die ich im ersten Augenblick für sinnvoll erachtete.
Doch zu Hause, vor dem heimischen Rechner, wenn ich dann - da es keine Informationen zu meinem Thema in handelsüblichen Printmedien zu geben scheint - eifrig recherchierte, stellte ich entweder fest, das schon lange in Erfahrung gebracht und ihm teilweise sogar schon überreicht zu haben oder daß ich nciht verstanden hatte, was er nun eigentlich forderte, mit seiner wirren, undeutlichen Ausdrucksweise nicht klar zu kommen. Hinzu am, daß ich mich darüber ärgerte, daß er mir sämtliche Fragen auch schon anderthalb Wochen vorher hätte stellen können, daß ich also die Leere mit Sinnvollem befüllt haben könnte.
Wenn ich dann das Erforderliche darbot, ihm zur Ansicht vorlegte, beschaute er es kurz, ohne es zu bewerten [Es war tatsächlich egal, ob ich zwei oder zehn Seiten vorlegte.] und stellte dann eine neue Aufgabe, einer neuen Idee folgend, wieder mit dem nötigen Zwischenzeitraum und der allgemeinen Planlosigkeit der Situation bestückt.
Eines meiner Probleme jedoch ist, daß ich nur Theorie bearbeite, daß ich versuche, Anleitungen udn Hinweise zu finden, Gedanken vorantreibe, die auf keinen fruchtbaren Boden stoßen, weil sie nur theoretisch ins Nichts geschwafelt werden.
Schon im Dezember überreichte ich ihm eine Bestelliste, um auch die praktische Seite fördern zu können. Doch bis heute geschah nichts; ich halte nichts in den Händen, womit ich arbeiten kann, aus dem Erkenntnisse zu gewinnen wären, welche die Theorien bestätigen oder verwerfen. Vielleicht ist alles richtig, vielleicht alles falsch; wer weiß.
Mittlerweile weiß ich nicht mehr weiter. Ich bin nicht länger willens, seine zuletzt gestellte Aufgabe zu erfüllen, da ich nicht fühle, daß sie mich voranbringen wird, daß mich überhaupt irgendetwas voranbrachte. Ich fühle nicht, wie es weitergeht, fühle nicht, daß ich irgendwann die Studienarbeit abschließen werde. Ich sehe nicht den Tag, an dem ich das theoretisch Erforschte praktisch aufbauen werde, an dem ich mich mit den Fehlern und Tücken der Wirklichkeit herumzuschlagen habe.
Studienarbeiten sollten drei Monate dauern. Mehr nicht. Eine Verlängerung ist möglich - auf vier Monate. Mittlerweile jedoch befindet sie sich im siebten Monat - natürlich unangemeldet. Mein Dasein stagniert, weil ich nicht fähig bin weiterzudenken, weiterzuplanen. Die Stuienarbeit schwebt im Kopf und blockiert alles Denken.
Ich beschwere mich. Nicht unbedingt über diese Studienarbeit, nicht unbedingt über den "Mentor", nicht über das "Schicksal", das mich mit dieser Trägheit versah.
Nein, ich beschwere mich über mich selbst, über die vielen Vorhaben, die in meinem Kopf herumschwirren, ohne verwirklicht zu werden. Müde und ausgelaugt krieche ich durch die Tage, durch die Zeit, krieche ich voran, bastle ein wenig - einem Alibi gleich - an der Arbeit, doch bin nicht fähig, meinen Blick woandershin zu richten, nicht fähig aufzusehen.
Ich wollte mich um mein Praktium kümmern. Im Juni soll es losgehen. Doch wo? Bei wem? Ich habe keine Ahnung, regte mich nicht. Warum auch? Ich bin ja mit der Studienarbeit beschäftigt. Eigentlich sollte dioese bis dahin erledigt sein; doch wer weiß...
Ich wollte meine restlichen zwei Prüfungen absolvieren, wollte dafür lernen, mich anmelden, sie einigermaßen gut bestehen, endlich sämtliche Prüfungen meines Studiums abgeschlossen haben. Doch ich klebe an meiner Studienarbeit, nutze sie als Ausrede für meinen Stillstand.
Und so viel mehr wartet auf mich; kreative Wünsche, Gedanken, Vorhaben, Ideen, die nicht umegsetzt werden, weil ich vor dem Bildschirm hocke, auf nutzlose Seiten starre und nicht vorankomme, weil ich Zeit vertrödle, die nichts wert zu sein scheint, mit Dingen, die nichts beinhalten, nichts bedeuten.
Ich beschwere mich über mich selbst, über mein Leben, das keines ist, sondern nur eine lächerliche Nichtexistenz, ein Gedankensuchen und Traumweltenschaffen, ein Innenzauber, der den äußeren nicht zu beeinflussen vermag.
Ich beschwere mich über meine Willenlosigkeit, mein Kraftlosigkeit, meine Antriebslosigkeit, meine ewigen, nutzlosen Optimismus, meine Blindheit.
Ich beschwere mich über meine fehlenden Worte, meinen fehlenden Wunsch, mich zu beschweren, mein Umfeld zu verbessern, mich selbst zu verbessern.
Ich beschwere mich, weil ich mein Heil in der Flucht suche, im Nichts, im stillen Schweigen, im Nichtbegreifen, im Nicht-Sehen-Wollen, in der Ignoranz meiner Selbst.
Ich beschwere mich, weil ich mich ablenke, mich beschäftige, um Beschäftigung zu haben, um nicht denken, nicht wissen zu müssen.
Ich beschwere mich mich, weil ich nicht der bin, der ich zu sein glaube.
Ich beschwere mich!
morast - 5. Mai, 17:30 - Rubrik:
Wortwelten
Begegnet man anderen Menschen, zeigt man ihnen eine Maske, eine Oberfläche, die das subjekt bewertete, bestmögliche Bild von sich selbst repärsentiert. Nur selten hat man das Glück, Menschen zu kennen, bei denen man sich so fühlt, als bliebe das Selbst an der Oberfläche, nicht versteckt hinter einem falschen Lächeln, hinter einer Fassade, die zuweilen durchschaubar, zuweilen aber unerhört natürlich zu sein scheint.
Doch wenn man zu suchen beginnt, beginnt man sich zu fragen, ob die Person, die man für sich selber hält, jenes Wesen ohne Masken, nicht vielleicht auch nur eine Maskerade ist, nur eine weitere Schale, unter der sich irgend etwas verbirgt.
Was also ist dann das wahre Ich? Gibt es ein solches überhaupt, bedenkt man, daß die Masken in jeder Situation unverrückbar auf dem Eigengesicht kleben, vielleicht sogar, wenn das eigentlich, wirkliche Anlitz zum Vorschein kommt? Oder ist das wahre Ich ein Märchen, ersonnen, um uns zu beruhigen, um all die Lügeln, alle Masken erträglicher zu machen, das Wissen vorzugaukeln, man bräuchte nur alle Fassaden durchbrechen und fände dann die Wahrheit - hinter allen abgelegten Masken? Vielleicht gibt es kein wahres Ich.
Vielleicht aber doch. Vielleicht ist das wahre Ich auch ebenjene Ansammlung von Masken, mit der man sich bedeckt, mit der man der Welt begegnet. Vielleicht ist das wahre Ich tatsächlich das, was wir sind und nicht das, was wir unter der Oberfläche zu finden glauben.
Es ist einfach: Die Masken begleiten uns; ständig, überall. Es gibt Wege, sie loszuwerden, doch lebt es sich leichter mit einem falschen Lächeln auf den Lippen, mit einer Maske, die den anderen genehm ist. Das Leben besteht aus Masken. Warum sollten diese also nicht zum wahren Ich gehören?
Zudem sei erwähnt, daß die Wahl verbleibt. Die Maskierung ist nicht Pflicht. Und wo eine Alternative bleibt, für oder gegen die man sich entscheiden kann, birgt die gefällte Entscheidung das wahre Ich des Wählenden.
Sich selbst mit allen Masken als wahres Ich zu akzeptieren bedeutet demnach nicht, jeder Fassade, jeder Maskierung Zuspruch zu gewähren. Denn obgleich die Masken, die Wahl der Masken, dem wahren Ich angehört, ist dieses leichter zu erfassen, leichter zu begreifen, wenn nicht erst Umwege und Umleitungen begangen, Lügen erforscht und Falschgesichter hinterfragt und durchschaut werden müssen.
Die Masken verraten sich selbst. Doch nur der Suchende kann das Gesicht dahinter erblicken.
Danke an G.
morast - 5. Mai, 00:37 - Rubrik:
Geistgedanken
Ich bitte um Beachtung für das heutige, wunderschöne Datum.
05.05.05
Ich bin begeistert.
morast - 5. Mai, 00:36 - Rubrik:
Wortwelten
als wär der leib ein graugemäuer
stadtkernfern am scheideweg
insel stummer lichtgeburten
irgendwann vergangenheit
längst zersplittert alle scheiben
keine sonne glitzert stumm
tote augen suchen leben
stöhnen trauer mit dem wind
wege
wirre bröckeltreppen
gänge
hohl und menschenleer
doch kein anfang führt nach innen
doch kein echo schreit sich taub
in den rahmen welken bilder
sinnverwesung näht ein kleid
leben rieselt von den wänden
zeichnet träume in die furcht
"
reiß mich nieder!"
fahle stimme
spinnenbein zu klang verformt
"
reiß mich nieder!"
hauchgemäuer
"
staub soll sein, was schatten war..."
www.bluthand.de
[Im Hintergrund:
Grabnebelfürsten - "Von Schemen und Trugbildern"]
morast - 4. Mai, 19:55 - Rubrik:
Seelensplitter
Du kannst mich nicht halten. Niemand kann mich halten. Randlos stürzt der Abgrund auf mich hernieder. Fang mich nicht. Halt mich nicht. Find mich nicht.
Als der Boden mich berührt, zerbreche ich in Tausend Spiegelscherben.
Irgendwo könntest du mein Lächeln finden, alt, verwelkt, doch meines, doch für dich.
Halt mich nicht.
Wenn ich deinen Namen rufe, erklingt er ewig, schallt hernieder auf meine Seele, durch die Zeiten, in meinen Tränen, fängt sich in den glitzernden Scherben auf dem Boden, läßt sie verschwimmen, zerrinnen.
Halt mich nicht.
Halt nicht, was dich findet, halt nicht, was dich sucht.
Wohin der Weg mich führt, ich entfliehe, entweiche.
Wären meine Schwingen Flügel, könnte ich tanzen, könnte ich brennen, irgendwann, irgendwo.
Als ich Feuer fing, zersplitterten meine Gedanken zu Erinnerungen, zu Träumen in einsamen Dunkelheiten, zu Namen, die zu rufen ich vergaß.
Halt mich nicht, wenn ich unter deinem Anlitz schmelze, im Lächeln meiner Sehnsucht.
Halt mich nicht, wenn gläserne Kanten glänzend rotes Leiden wecken.
Halt mich nicht, wenn der Schmerz sich in meiner Hoffnung bricht.
Als ich den Boden berührte, gefror ich zu Vergangenheiten, gefror ich zu Gedanken, gefror ich zu Stille.
Eines einzigen Wortes hätte es bedurft, eines Windhauchs wilder Blüten, eines flackerwarmen Augenblicks.
Mein Antlitz zersplitterte, als zerbräche ein Leben.
Durch Sonnen schleiche ich, suche dein Bild, suche mich in Tausend glitzerkalten Scherben, suche dich inmitten vergessener Ewigkeiten.
Durch Tage krieche ich, als wären sie mein Leben, als wären sie ich.
Durch Küsse wandle ich, das Schmelzen begehrend, das Splittern findend.
Wohin, wenn nicht in die zarte Berührung lächelnder Gedanken?
Wohin, wenn nicht in das versehrte Antlitz einer samtenen Göttin?
Wohin, wenn nicht in die Flucht, die immerwährende, die sorglos glimmende, die unerreichbare?
Wohin, wenn nicht zu dir?
Halt mich nicht.
Halt mich.
Fest.
morast - 3. Mai, 22:05 - Rubrik:
Geistgedanken
schenk der innenwelt ein seufzen
spür mein herz im trippeltakt
trippelschritte
flüsterwege
folgend deiner wolkenspur
sehnsucht um dein herz gefaltet
schleich ich sternen hinterher
pflück dein lächeln aus der sonne
leb für dich
für leben nur.
www.bluthand.de
[Im Hintergrund:
Anathema - "A Natural Disaster"]
morast - 3. Mai, 14:11 - Rubrik:
Seelensplitter
Anglizismen sind out.
morast - 2. Mai, 22:18 - Rubrik:
Weise Worte
Ich hatte dich noch nicht erkannt, als ich schon von dir träumte.
Dein Herz sprach von Schmetterlingen, deine Blicke lächelten wie erwachende Sonnen. Wäre ich haltlos, hätte ich geflüstert, von Sternen gesungen. Wieviele Namen hat ein Leben?
Am Ende des Anfang erfand ich die Sehnsucht, entflammte ein Bilderfeuerwerk träumender Rauschbegierden. Was wäre gewesen, wenn? Kein Wort verläßt die Seele, doch mein Schweigen erzählt von dir.
Ein Märchen vielleicht.
morast - 2. Mai, 12:27 - Rubrik:
Geistgedanken
Eine Rentnerin auf einem Fahrrad, mit dem üblichen Fahrradkorb hinter sich, die sich eine Steigung hinaufquält und dabei vor Anstrengung das Gesicht verzieht, ihre schiefen Zähne zeigt. Als ich vorbeifahre, wird sie sich ihrer Grimasse bewußt und versteckt ihre entblößten Zähne wieder, normalisiert ihr Gesicht und schaut mich unschuldig an.
Der Fahrradweg ist schmal. Mir kommt eine junge Frau entgegen, auf der falschen Straßenseite fahrend. Das stört mich nicht weiter; ich halte mich so weit wie möglich rechts. Die junge Frau jedoch hat genau denselben Teil des Fahrradweges für sich erachtet. Im letzten Augenblick mache ich einen Schlenker und weiche ihr aus, verwundert darüber, daß sie nicht nur auf der [von ihr aus gesehen] linken Straßenseite fuhr, sondern sich auch noch auf dem Weg [von ihr aus gesehen] links orientierte.
Dann wird mir bewußt, daß das Rechts-Fahr-Gebot nur eine von unzähligen Regeln darstellt, die mir von kleinauf eingetrichtert wurden, daß ich vollgestopft bin mit Vorschriften, die jeder für normal erachtet, deren Beachtung aber nicht immer zwingend notwenig ist.
Heimlich lächle ich über die - vermutlich unbewußte - Anarchistin.
Auf der neugebauten Sternbrücke schlendern zwei Mittvierziger entlang, beide mit Bierbauch und Schnaubart verziert. Einer von ihnen bleibt stehen, mustert die blauen Stahlträger der Brücke argwöhnisch, klopft prüfend darauf und murmelt:
"Was das alles wieder gekostet hat..."
morast - 2. Mai, 11:45 - Rubrik:
Menschen
Nicht zu schlafen, nicht dem dämmrigen Begreifen des Jetzt, nicht den eigenen Gedanken, nicht dem Bewußtsein der Daseinslosigkiet gegenüberzutreten, nicht die Blicke der Gegenwart zu entreißen, die Augen zu schließen und in gleichem Morgen erneut öffnen zu müssen, nicht haltlos zu fallen aus dem Heute in die Fremde, nicht das Wissen, die Hoffnung um den Eigenwert zu verlieren, neu suchen zu müssen, nicht zu vergessen, im Traum, im Taumel, neu zu finden, neu zu erfinden, nicht zu fliehen, vergeblich, der Leere im Herzen ausgesetzt.
Laßt mich nicht schlafen, nicht ruhen, nicht wissen, nicht träumen. Laßt mich nicht weichen, nicht für die Neugeburt sterben, nichtdas flackernde Licht loslassen müssen. Laßt mich nicht begreifen, niemals begreifen, was ist, was ich bin.
morast - 1. Mai, 23:31 - Rubrik:
Geistgedanken
Punkt neun klingelte mein Wecker. Ich hatte noch nicht einmal die Möglichkeit, andere zu beschimpfen, weil meine eigene Idiotie verantwortlich dafür war, daß ich nach sechs Stunden Schlaf bereits wieder aus selbigem gerissen wurde. Allerdings kamen dann irgendwann noch Stimmen auf dem Hof und läutende Kirchenglocken hinzu, die mich endgültig aus den Federn vertrieben.
Die Sonne schien und lockte mich nach draußen. Ich entsann mich der Eröffnung der Sternbrücke, die gerade beginnen sollte und demensprechend Unmengen von Leuten anziehen würde. Trotzdem entschloß ich mich spontan dazu, mich selbst zu verkaspern doch noch joggen zu gehen. Schließlich wollte ich wach werden, wenn ich schon nicht in das Vergnügen kam weiterzuschlafen.
Also schnappte ich mein Rad und fuhr zum Stadtpark. Die Sternbrücke war noch nicht geöffnet wurden, doch Hunderte Ungeduldiger drängten sich davor zusammen, wollten allesamt die ersten Benutzer der neuen Brücke sein. Ringsum befanden sich die üblichen Freßbuden und natürlich eine wundervolle mdr-Gute-Laune-Bühne.
Allein der Name ließ mich flüchten, inmitten durch die Menschenmassen, die orientierungslos durch die Gegend irrten. Erstaunlich, wieviele Menschen sich um diese Uhrzeit hier tummelten. Erstaunlich, wieviele Fahrradfahrer [vorwiegend älteren Baujahres --- die Fahrer, nicht die Räder] die Wege verstopften.
Nun ja, die Kombination aus Sonntag, Feiertag, städtischer Großfestivität und Sonnenschein lockte wohl selbst den Unwilligsten hervor und auf sein bisher unbenutztes Rad.
An der Hubbrücke, der alten, kleinen Fußgängerbrücke, stauten sich die riesigen Menschenmassen zu enormen Schlangen, in die auch ich mich einzureihen hatte. Mitten auf der winzigen Brücke hatte ein gewiefter Geschäftsmann einen kleinen Getränkestand eröffnet und ein paar alberne Bänke hingestellt.
'Keine gute Idee.', dachte ich, war es doch jetzt, wo die Sternbrücke noch geschlossen war und alle Leute über die alternative Hubbrücke zu gehen hatten, zu früh, um sich bereits mit Getränken vollschütten zu wollen. Und nachher, nach Eröffnung der Sternbrücke, wollte bestimmt kaum noch jemand die winzige Hubbrücke nutzen.
Auf der anderen Seite der Brücke schwang ich mich auf das Rad und schlängelte mich zwischen den vielen Menschen hinduch, fand nur mit Mühe eine freie Stelle an einem Zaun, wo ich mein Gefährt anlehnen und anschließen konnte.
Ich hatte mich diesmal mit halblanger Hose und einem schlichten T-Shirt bekleidet, war also besser an das Wetter angepaßt. Auch besaß meine Hose heute verschließbare Taschen, in denen sich nicht nur mein Schlüssel, sondern auch ein Notfall-Geldschein verstauen ließen.
Ich rannte los, zu schnell, zügelte mein Tempo, fand mich rasch in eine annehmbare Geschwindigkeit. Je weiter ich mich von der Sternbrücke entfernte, desto weniger Menschen wuselten um mich herum.
'Vergiß die anderen. Vergiß die Strecke.', sagte ich mir und rannte.
Zwischenzeitlich gelang es mir tatsächlich zu vergessen, nur den Boden vor mir oder einen unnennbaren Punkt am Horizont zu sehen, die gesamte Welt auszuschließen, meinen Atem, das Gefühl in den Beinen zu vernachlässigen, einfach zu rennen, automatisch, ohne bewußte Kontrolle, mich gehen zu lassen, als wäre nichts weiter existent. Ein schönes Gefühl.
Mir kamen unzählige Radfahrer, Spaziergänger aber auch ein paar Jogger entgegen, die zuweilen mich aus meiner Konzentration rissen, doch nicht weiter störten. In meiner Richtung war weniger Betrieb, was mich durchaus erfreute.
Nachdem ich gestern schon am Wegesrand mehrere Vogeleierschalen entdeckt und diesen Bewies neuentstandenen Lebens als faszinierend und schön erachtet hatte, hatte ich heute größeren Grund zur Freude. Nur wenige Meter vor mir huschte ein Reh aus dem Gebüsch, lief ein paar Schritte auf dem Weg und versteckte sich dann wieder im Unterholz. Es hatte keine Angst gehabt, wollte nur nichts mit mir laut atmenden Wesen zu tun haben. Mich Stadtkind vermochte diese Begegnung natürlich zu bezaubern, und mir fiel es schwer, nicht hinterherzublicken, sondern mich auf auf meine Strecke zu konzentrieren.
Dann erreichte ich die Stelle, an der ich am Vortag aufgegeben hatte. Ich lächelte in mich hinein, spürte doch deutlich noch Reserven in mir, spürte, daß ich mich selbst überbieten konnte. Der Weg war zuende, ich drehte um, rannte weiter, stolz auf mich selbst.
Der Rückweg war beschwerlicher, nicht nur, weil mir allmählich die Kräfte zur Neige gingen, sondern auch weil nun unzählige Fußgänger und Radfahrer den Weg bevölkerten und Hindernisse bildeten. Als besonders schlimm erachtete ich es, wenn ich Radfahrer überholen mußte, weil die älteren Menschen so unendlich langsam vor sich hin zu rollen schienen, daß mir gar keine andere Wahl blieb, als vorbeizueilen. Mein Konzentration schwand; die innere Ruhe war verloren.
Doch an ihre Stelle war eine Art Kampfesgeist getreten, der Wille weiterzurennen, noch ein Stück, immer weiter, ja womöglich gar bis zu meinem Fahrrad zurück.
Ich lief. Immer wieder dachte ich darüber nach, daß es sinnvoll wäre aufzuhören, doch wollte nicht, wollte noch ein paar weitere Meter schaffen.
Die Sternbrücke kam in mein Blickfeld.
'Nicht mehr weit.', dachte ich.
'Los!', spornte ich mich an, spürte, daß ich nicht länger zu Höchstleistungen fähig sein würde. Weiter, weiter, immer weiter.
Die Menschmassen nahmen zu; ich ignorierte sie, huschte hindurch - und erreichte mein Fahrrad.
Keuchend und geschafft, doch glücklich und stolz versuchte ich erst einmal, meinen Atem wiederzufinden, ging ein paar Schritte und schüttete dann den Inhalt meiner Wasserflasche in mich hinein.
Ich war doppelt so weit gelaufen wie gestern.
Heldenhaft.
Nun hatte ich auch Augen für meine Umgebung.
Menschen, Menschen, Menschen. Überall. Unglaublich, wie viele Menschen zur Eröffnung der Sternbrücke erschienen waren. Von irgendwo tönte Santana; überall standen Freßbuden, Magdeburg-Souvenirläden und irgendwelche Hobbykünstler herum.
Die Sternbrücke war mittlerweile eröffnet worden. Auf ihr drängten sich die Massen aneinander vorbei, kamen kaum voran, mußten alles bestaunen, gut finden. Ein "Seemann" spielte Akkordeon, eine Dreiergruppe gab - mir unbekannte - Evergreens wie "Die Elbe fließt durch Machteburch" zum Besten.
Die Menschen glotzten, schauten, blieben stehen, versperrten mit ihren Fahrrädern sämtliche Wege. Nur allmählich kam ich voran, wollte eigntlich nur nach Hause, unter die Dusche.
Um mich herum tobte das Leben. Kleinkünstler stellte sich als starrre Figuren oder Magdeburger Stadtwappen in die Gegend und ließen sich betrachten. Luftballons, Eis, Bratwürste, Bier - überall.
Als ich die Brücke überquert hatte, atmete ich auf. Doch ich hatte es längst nicht überstanden. Auf der anderen Seite war die Menschenmasse, die Anzahl an Buden und Bühnen nicht geringer. Wolle Petry drang an mein Ohr. Die mdr-Gute-Laune-Bühne machte Stimmung.
Ich floh, schwang mich auf das Fahrrad, fuhh nach Hause - erschöpft, doch angefüllt mit Stolz.
[Im Hintergrund: Madrugada - "Industrial Science"]
morast - 1. Mai, 13:49 - Rubrik:
Wortwelten
Schon am zweiten Tag gebe ich auf.
Nein: Schon vor dem zweiten Tag.
Der heutige Abend war durchaus angenehm, wenngleich die musikalische Untermalung in dervon mir [nahezu unfreiwillig] besuchten Alternativdiskothek ein wenig "mainstreamiger" hätte sein können. Den Musikauflegern war es scheinbar egal, ob sich nun drei Tanzende [viel mehr waren es nie] oder eben kein einziger zu den gitarrenlastigen Klängen bewegten.
Den Höhepunkt bildete Slut mit "Easy To Love". Ich erkannte den Song als erster, stürmte auf die Tanzfläche, begleitet von zwei Kumpanen. Kaum begannen wir, unsere Leiber im Takt zu bewegen, begaben sich auch noch ein paar andere Tanzwütige auf die vorher leere Fläche.
War ich gar zum Trendsetter, zum positiven Vorbild geworden?
Nein, natürlich nicht. Das nachfolgende Lied - mir völlig unbekannt - vertrieb alle wieder, von mir und meinen Kumpanen abgesehen. WIr hielten tapfer durch, gaben sozusagen eine freundliche Tanzzugabe, bis auch wir abdankten und an unserem Tisch sitzend darauf hofften, daß irgendwann mal wieder etwas Bekanntes zu hören sein würde.
Die Dialoge waren nett, wenngleich auch zuweilen mühsam, tilgte doch der fremde Lärm große Teile der eigenen Laute. Ich trank an der dritten Cola, als wieder ein bekanntes Lied ertönte. Ich weiß nicht, woher ich es kannte und von wem es war; doch ich kannte es. Die anderen scheinbar auch; doch keiner war mehr tanzwillig.
Ich deklarierte diesen Song zum abschließenden Höhepunkt des Abends und radelte heimwärts, in ständiger Obhut, ob nicht irgendwo ein hintertückisches Polizeiauto lauern würde.
Schließlich waren sowohl meine Klamotten als auch mein Fahrrad in grellem Neonschwarz gehalten und ersetzten die fehlende Beleuchtung optimal.
Der Stundenzeiger nähert sich der Zwei. Es ist nicht damit zu rechnen, daß ich morgen - also heute - um sieben [wie geplant] aufstehen werde, um durch die Gegend zu hampeln.
Das Vorhaben auf eine spätere Stunde zu verlagern, mißfällt mir, da am morgigen - also heutigen - Tag dort, wo ich zu joggen wünschen würde, eine aufwendig gefeierte Brückeneröffnung stattfinden wird, so daß sich dort Menschen und Leute tummeln und mein sportliches Vorhaben behindern werden.
Einen Vorteil jedoch hat diese Brückeneröffnung: Sie kürzt mehrere Minuten Radweg zum Joggingstreckenstart ab. Das freut mich und läßt in mir den Entschluß reifen, doch noch nicht aufzugeben.
Heldenhaft.
morast - 1. Mai, 02:02 - Rubrik:
Wortwelten
Heute Abend bemerkt:
In einer geselligen Runde beeindruckt es tatsächlich, einen Satz mit
"Es gibt Situationen, in denen..."
zu beginnen.
morast - 1. Mai, 01:45 - Rubrik:
Krimskrams
Die Erinnerung läßt Tränen glänzen. Nur kurz. Ein Schmerz schmettert mich nieder. Findet meine Tiefe. Ich folge den Bildern in die Stille, atme den Augenblick, als würde er nie vergehen. Klänge tosen durch meine Sinne, glätten Wogen, berühren mein Lächeln. Wirklichkeiten drehen sich im Kreis, als Hektik in meine Ruhe platzt, Worte tönt, die Fremdem gelten. Blind, die Klänge verzerrend, das Flüstern ausgereizt zu grellem Lachen. Vergangenheiten entgleiten und lassen mich zurück - meine Kümmerlichkeit begreifend, erfassend, die neuerliche Flucht ersehnend...
morast - 30. Apr, 15:52 - Rubrik:
Geistgedanken
Nachdem ich gestern erstmalig etwas in einem Bioladen erwarb, wollte ich heute eine weitere Premiere zelebrieren: Joggen.
Vor drei Jahren hatte ich es mit meiner damaligen Freundin schon einmal gewagt, um den nahegelegenen Teich zu joggen. Sie war konditionell auf dem Tiefpunkt und schlich mehr oder weniger vor sich hin, während ich mich bemühte, durch winzigste Trippelschritte mit ihr mitzuhalten. Das war derart anstrengend, daß ich es ihr gegenüber zu Worten formulierte und mir dadurch einigen Ärger einheimste. Nicht zuletzt aus diesem Grund wagte ich es nie wieder, mit ihr zusammen joggen zu gehen.
Danach versteckte ich mich, wenn mal wieder der Gedanke ans Joggen mein Gehirn bepflanzte, hinter fadenscheinigen Ausreden. Meine liebste war, daß mir das geeignete Musikaspielgerät fehlen würden. Das war tatsächlich so, denn mein Discman-Imitat war nicht nur zu groß und zu klobig, sondern hielt auch die andauernden Erschütterungen nicht aus, so daß der Musiksalat in meinem Ohr zu einer Qual wurde. Außerdem fehlte mir eine geeignete Haltevorrichtung für das Gerät.
Eine andere Lieblingsausrede ergab sich nach meinem Umzug. Hier gab es nur wenig Grünes in der Nähe, und wenn, dann war es nicht ausreichend, um stundenlang hindurchzurennen. Als nächsten größeren Park kannte ich nur den Stadtpark, wobei übertrieben war zu behaupten, er wäre "nah" gewesen - ich benötigte mit dem Rad schließlich mindestens 15 Minuten, um dorthin zu gelangen. Ein Auto besaß ich nicht, hätte ich aber auch nicht benutzen wollen. Dementsprechend erachtete ich die Entfernung zur nächstbesten Joggingumgebung als zu weit, um ernsthaft mich mit dem Gedanken ans Joggen auseinandersetzen zu wollen.
Gestern Abend jedoch entschloß ich mich spontan dazu, es heute wagen zu wollen. Zum ersten Mal [Das wirkliche erste Mal zähle ich nicht.]. Allein. Im Stadtpark. Ohne Musikabspielgerät.
Zurückblickend stelle ich fest, von mir selbst, von meiner Leistung enttäuscht zu sein. Das Joggen diente schlichtweg einer Verbesserung meiner Kondition. Doch diese schien gar nicht vorhanden zu sein, obwohl ich noch gestern Abend das Gegenteil behauptet hätte.
Zugleich jedoch bin ich ermutigt, will es unbedingt morgen noch einmal probieren.
Trotzdem machte ich mir während des Laufens bereits Gedanken zu Optimierung und über das Joggen an sich.
1) Rase niemals wie ein Irrer zum Jogging.
Ich hatte tatsächlich die einfachste Variante für mich gewählt, um zum Stadtpark zu gelangen: Mein Fahrrad. Leider neige ich dazu, auf einem Fahrradsattel sitzend mir immer alles abzuverlangen, selten langsam zu fahren, selten Ruhe walten zu lassen.
Zwar klingt es selbst in meinen Ohren wie eine Ausrede zu behaupten, ich hätte einen Teil meiner Leistungsfähigkeit schon vor dem Start verschossen, doch werde ich in Zukunft gemächlich in den Stadtpark radeln.
2) Beginne bereits in aller Frühe.
Für einen Samstagmorgen ist 9 Uhr eigentlich nicht zu früh. Doch zum einen tummelten sich innerhalb des Parkes und in dessen Nähe schon zahlreiche andere Läufer, zum anderen bekam bereits ich erste Heuschnupfenandeutungen zu spüren. Davon ausgehend, daß derlei Unannehmlichkeiten zu früherer Stunde verringert werden, plane ich, morgen zeitiger aufzustehen, um anschließend ein wenig zu joggen, danach heimzukehren, zu duschen [eine wahre Wohltat!] und in aller Ruhe ein leckeres Frühstück zu verspeisen.
Heute unter Dusche überraschte ich mich selbst, indem ich tapfer vorerst nur kaltes Wasser benutzte. Als ich jedoch mir damit die Haare waschen wollte, erwies ich mir gegenüber die Großzügigkeit, heißes Wasser zu verwenden. Denn eigentlich liebe ich es eher zu heiß als zu kalt...
Auch das Frühstück war eine Überraschung. Zu einer riesigen Tasse ausreichend gesüßtem Pfefferminztee servierte ich mir drei Scheiben erwähnenswert guten Biobrots und den gestern gekauften Bioquark, in den ich Unmengen von Omas selbstgemachter Erdbeermarmelade einrührte. Ich befürchte fast, in Zukunft mit Birkenstocksandalen rumzulaufen und zum vegetarischen Müslimampfer zu mutieren...
3) Grüße andere Jogger.
Erstaunlicherweise wurde ich heute zwei Mal gegrüßt. Ich kann mich nicht entsinnen, den Personen, ein Mann und eine Frau, beide jeweils mit nichtgrüßender männlicher Begleitung, jemals zuvor begegnet zu sein. Doch empfand ich das Grüßen zwar als verwunderlich, aber nicht als unangnehm. Eher im Gegenteil. Diejenigen, die mit gesenktem Kopf an mir vorbeiliefen, waren mir wesentlich unsympathischer.
4) Löse das Schlüsselproblem.
Meine Jogginghose hat drei Taschen. Doch ich vertraue ihnen nicht, denn keine von ihnen ist verschließbar. Leicht kann es geschehen, daß mein Schlüsselbund Freude daran findet, mal eben hinauszuhüpfen und auf dem Kiesweg ein Sonnenbad zu nehmen, ohne daß ich es merke.
Dabei hatte ich das Schlüsselbund schon auf das Nötigste reduziert: Auf meinen Wohnungsschlüssel und meinen Fahrradschlüssel - beide sind keineswegs vernachlässigbar und störten mich trotzdem. Schließlich hatte ich mir den Schlüsselring wie einen echten auf den Mittelfinger gesteckt und die beiden Schlüssel in der rechten Hand verwahrt.
Mir mißfällt jedoch der Gedanke, irgendeine - sich nicht derzeit in meinen Besitz befindliche - Gürteltasche oder ähnliches mitführen zu müssen, bloß um den albernen Schlüssel nicht verlorengehen zu lassen.
Ich war immerhin schon so clever, meine mit Wasser gefüllte Plastikflasche am Fahrrad zurückzulassen und nicht während des Laufens bei mir haben zu wollen.
5) Vergiß die Strecke.
Ich hatte mir vor dem Lauf keinerlei Strecke ausgesucht, dachte mir, ich könne einfach durch den Park an der Elbe entlanglaufen, bis mir die Puste ausging. Das funktionierte tatsächlich, doch war ich ständig versucht, anhand irgendwelcher Bauten auf der anderen Elbseite ausmachen zu wollen, auf welcher Höhe ich mich mittlerweile befinde, ob es nicht an der Zeit wäre umzukehren usw. Derartiges lenkt ab und stört.
Ich führte auch keine Uhr mit mir, keinen Schrittzähler oder anderen Schnickschnack, wollte es nicht auf Leistung und Zahlen ankommen lassen. Doch war ich ständig versucht herauszufinden, wie weit ich schon gekommen war. Immerhin kenne ich jetzt zumindest diese Strecke und brauche mir in Zukunft keine Gedanken mehr darüber zu machen.
6) Vergiß die anderen.
Andere Jogger stören mich. Nicht wirklich. Aber ein bißchen. Die Entgegenkommenden sind mir eigentlich egal. Doch diejenigen, die vor oder hinter mir laufen, können durchaus zur Plage werden.
Ich mag es nicht zu überholen, mag es nicht, so zu tun, als wäre ich besser in Form oder ähnliches, bloß weil ich größere Schritte mache. Noch schlimmer ist vielleicht das Überholtwerden. Das geschah aber erst, nachdem ich aufgegeben hatte. Ein Mann in viel zu kurzer Hose rannte an mir vorbei. Als ich mich dann dazu entschlossen hatte, auch noch ein paar Meter laufen zu wollen, hatte ich ihn schnell eingeholt. Ich merkte aber, daß ich nicht viel weiter kommen würde, ohne mich völlig zu verausgaben, was bedeutete, daß ich ihn zwar überholen könnte, aber in wenigen Minuten endgültig aufhören, dementsrepchend zurücküberholt werden würde. Darauf hatte ich keine Lust, weswegen ich das Joggen für den heutigen Tag komplett abbrach.
7) Laß es ruhig angehen.
Ich war einst Leichtathlet, spezialisiert auf Mittel- und Langstrecken. So sah auch mein Jogging-Start aus: Viel zu schnell, überhastet. Ich brauchte ziemlich lange, bis ich mich soweit zurückgenommen hatte, um mich nicht zu überfordern und ein Tempo zu laufen, bei dem das Joggen auch Spaß machte. Natürlich hatte dieser Startspurt einiges an Kraft gekostet, weswegen ich schon bald merkte, daß der heutige Jogging-Tag kein glorreicher werden würde.
Tortzdem kämpfte ich eine geraume Weile mit mir, bis ich zu der Feststellung gelangte, daß ich nichts erzwingen, mich nicht völlig niederzumachen brauchte. Ich habe keine Pfunde zu vernichten, keinen Ehrgeiz, irgendwelche Muskelpartien aufzubauen, sondern einzig und allein den Wunsch, mir etwas Kondition zu verschaffen und daran Gefallen zu finden.
8) Besorg dir Musik.
Ich glaube, daß meine oben genannte Ausrede nur partiell eine war und daß es sich mit angenehmen Klängen im Ohr auch besser läuft. Leider ergibt sich auch hier die Frage nach der Verstaumöglichkeit für das Musikabspielgerät.
9) Kleide dich passend.
Diese Forderung ist zugleich leicht und schwer zu erfüllen. Meine Schuhe, das merkte ich heute, sind zum Joggen ungeeignet. Es ist das einzige Sportschuhpaar, das ich besitze, doch habe ich keine große Lust, unzählige Euros in neue zu investieren. Ich werde sehen, was die nächsten Versuche bringen.
Meine Kleidung war heute eindeutig zu warm, zu dick. Die lange Jogginghose sollte gegen eine kurze oder halblange ausgetauscht werden [Mal sehen, ob ich derartiges im Kleiderschrank finde.]. Auch reicht ein T-Shirt als Oberteil. Sich mit extrasuperfetzigen Joggerklamotten aus synthetischem Megaactionmaterial auszustatten, halte ich für einigermaßen albern, auch wenn diese [die Oberteile zumindest] vermutlich über verschließbare Taschen verfügen.
Ich fragte mich sowieso, wie die anderen Jogger es mit ihrer Bekleidung handhabten, waren sie doch teilweise recht luftig angezogen. Das ist für das Laufen sicherlich angebracht, doch anschließend der beste Weg, sich eine Erkältung einzufangen, zumindest, wenn man mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist.
Doch sah ich genug Jogger, die nach dem Lauf an ihren Autos standen, Flüssigkeit in sich hineinschütten und mit watteweichen Frotteehandtüchern den Eigenschweiß entfernten. Das empfand ich als etwas befremdlich, wirkte es doch auf mich wie ein Fitneßstudio im Obergeschoß, zu der eine Rolltreppe hinaufführt.
Erstaunlicherweise bin ich motiviert genug, um es morgen in aller Frühe noch einmal zu wagen. Ich weiß nicht, wie ich morgen nach dem Aufstehen darüber denken werde oder wie lange diese Euphorie anhält; doch das ist vorerst bedeutungslos, kann ich mich doch heute eines gelungenen Tagesanfangs erfreuen.
Die Dusche danach war belebend, das Frühstück doppelt lecker und das Gefühl in den Beinen, das mir mitteilt, tatsächlich etwas geleistet zu haben, gefällt mir durchaus.
Ich könnte mich daran gewöhnen.
morast - 30. Apr, 12:57 - Rubrik:
Wortwelten
Gestern besuchte ich einen Bioladen. Das war nicht das erste Mal in meinem Leben, daß ich diesen Laden aufsuchte [sondern das zweite], aber das erste Mal, daß ich plante, mir tatsächlich etwas zu kaufen.
Mein Kühlschrank war leer und das Portemonaie einigermaßen gefüllt, so daß ich mir derartigen Luxus mal erlauben konnte. Ich hatte es mir schließlich verdient. Womit auch immer.
Schon die Anordnung der Fahrräder vor dem Laden zeugte von alternativem Lebenswandel. Die für Ordnung sorgenden Fahrradständer existierten, doch wurden ignoriert. Wildes Parken verwehrte sogar den Zugang zu ihnen. Ich kämpfte mich durch, schloß mein Rad trotzdem dort an. Nicht aus Ordnungsliebe oder Gesetzesergebenheit oder gar aus Protest gegen die Protestler. Nein, in Ermangelung eines eigenen ausklappbaren Fahrradständers an meinem Rad benötigte ich einfach nur irgend etwas, um mein Gefährt anzulehnen.
Der Laden war klein. Zwei Verkäuferinnen und eine Handvoll Kunden hielten sich in ihm auf. Erstaunlicherweise war das Angebot trotzdem immens. Ich glaube, wenn man die traditionellen Supermärkte um ihre "Non-Food-Abteilung" [so heißt das tatsächlich] berauben würde, stünde der Bioladen gar nicht mehr so mickrig da.
Ich sah mich um. Mein erster Besuch hatte mich einigermaßen auf die Preise vorbereitet. Doch nicht genug. Eine Flasche Apfelsaft für drei Euro. Camembert für zwei Euro. Cherry-Tomaten für 7,49 Euro das Kilogramm.
Der übliche Einkaufswagen war durch einen schönen Bastkorb ersetzt worden. Die Flaschenrücknahme funktionierte nach einem kreativen, mit eigenen, erläuternden Zeichnungen versehenen Prinzip.
Manches war Schwachsinn. Manches überraschte mich.
Beispielsweise bin ich ein genereller Tofu-In-Frage-Steller. Nichts gegen Tofu an sich. Doch der Versuch, Fleisch mit Nichtfleischlichem zu imitieren [Es gab tatsächlich Geschnetzeltes, Bratwürste usw.], wirkte auf mich recht albern. Auch brauchte ich keine Maschine [Ich konnte nicht genau erkennen, wozu sie diente.], die mit Holz verkleidet wurde, um so das mechanische Innere ökostylisch zu verpacken.
Schön fand ich es, Erdnußbutter zu entdecken. Oder Badewannenwasserfarben.
Ich traute mich aber nicht, etwas zu kaufen, war zu geizig, wollte mir dann doch nicht so viel "Gutes" gönnen, von dem ich nicht vollends überzeugt war.
Letztendlich entschied ich mich für ein paar Cherry-Tomaten [Erstaunlicherweise packt man im Bioladen sein Gemüse und Obst auch nur in durchsichtige Platiktüten.], für Öko-Quark und Brot.
Brot und ich sind zwei Todfeinde. Selten schaffe ich es, ein halbes Standardbrot zu verzehren, bevor es unangenehm aushärtet. Das hat weniger mit mangelnder Nahrungsaufnahme zu tun als mit dem Gedanken, daß es unzählige Dinge gibt, die leckerer, "spannender" sind als Brot.
Deswegen war ich angenehm überrascht, wie klein die agebotenen Brote im Bioladen waren. Dafür waren sie auch preisintensiv. Ich wählte ein niedliches Exemplar [Ich habe leider vergessen, welche Körner dort den Hauptanteil bildeten, welchen Namen das Brötchen - hihi - trug.], das mich ansprach, und bezahlte.
Das Bezahlen dauerte erstaunlich lange. Vermutlich muß man als Alternativer auch gelernt haben, keine Hektik zu verbreiten. Erst hatte ich zu warten, dann wurde das Brot umständlich eingepackt, dann noch auf irgendeiner Liste ein paar Notizen gemacht.
Das Brot selbst kostete zwei Euro, weswegen ich verdutzt aufblickte, als ich nicht mehr als drei Euro zu bezahlen hatte. Na gut, ich konnte meinen Einkauf in einer Hand halten - er war also nicht sehr umfangreich gewesen; trotzdem hatte ich das Gefühl, eigentlich recht wenig gelöhnt zu haben.
Mir selbst im Geiste ein paar Pluspunkte auf mein Gutmenschenkonto schreibend verabschiedete ich mich und radelte nach Hause.
morast - 30. Apr, 11:15 - Rubrik:
Wortwelten
"Bist du morgen da? Beim traditionellen Erster-Mai-Chili?"
Als Antwort hätte ich ein "Ja." erwartet. Oder auch ein "Nein. Da bin ich bei ...".
Vielleicht auch eine Frage:
"Ach, morgen ist der erste Mai?", "Wer kommt denn alles?" oder "Was fürn Chili?".
Ich hätte mich auch zufriedengeben mit "Was gibts denn da zu essen?"
Doch die einzige Antwort, die ich erhielt, war:
"Nö.", ein Blick in den Spiegel, "Warum ist meine Haut nur so trocken?"
morast - 30. Apr, 10:47 - Rubrik:
Wortwelten
Vielleicht ist heute Vatertag. Für mich.
Im Herbst vorigen Jahres verstarb mein Vater mehr oder weniger plötzlich an den Folgen von Alkoholismus. Zu diesem Zeitpunkt verweilte ich gerade auf Kreta, nahezu unerreichbar. Ich erfuhr vom Tode meines Vaters durch meinen Bruder, per Telefon.
Der Kreta-Urlaub war eigentlich ein sehr schöner gewesen. Und wie es meine Art ist, schrieb ich jedes bedeutungslose Detail nieder, auf daß man sich später bei der Lektüre lächelnd erinnern möge.
In den letzten Tagen habe ich mich mal wieder daran gemacht, die 50 einzeilig bekritzelten A5-Blätter abzutippen. Angenehm berührt gab ich mich den in Worte gepreßten Erinnerungen hin, genoß die Bilder, die sie in mir erweckten.
Dann las ich vom Tod meines Vaters, von dem Anruf meine Bruders, von der Möglichkeit heimzukehren, um einen letzten Blick auf einen kalten, zurechtgemachten Leib zu werfen, in dem ich nicht das finden würde, was ich liebte.
Ich hatte mich bemüht, meine persönlichen Gedanken, meinen Schmerz, meine Trauer aus dem Reisebericht rauszuhalten, doch spürte, während ich meine eigenen Zeilen abtippte, wieviele Tränen und Zweifel dahinter steckten. Ich mußte innehalten, mit jemandem reden, der mich verstand.
Heute war der letzte Termin zur Abgabe meiner BaföG-Unterlagen. Wie immer hatte ich alles auf den letzten Drücker ausgefüllt und kopiert. Eine Angabe beinhaltete das Sterbedatum meines Vater und die Kopie der Todesurkunde.
Wieder hielt ich inne, atmete tief durch.
Ein Gedanke schoß mir durch den Kopf: Meine Kinder, so ich denn jemals welche haben werde, werden niemals die Gelegenheit bekommen, meinen Vater kennenzulernen. Das betrübte mich.
Als ich zum BaföG-Amt radelte, hatte ich eine Straßenkreuzung zu überqueren. Die Ampel war längst auf Rot geschaltet; die Autos hätten durchsausen können - doch stockten, blieben stehen. Mitten auf der Straßen ging ein Mann, langsam, unsicher.
Er trug einen wilden Bart und eine Lederjacke, die ihm zu groß war. 'Ein Trinker', dachte ich. So dachten wohl auch andere, warteten an der Ampel und schauten der traurigen Gestalt neugierig zu, wie sie sich über die Straße quälte.
Ein Polizeiauto wollte durchfahren, bemerkte den bärtigen Mann, hielt an. Die Insassen glotzen, schauten nur. Die an der Ampel Stehenden glotzten, schauten nur.
Keiner bewegte sich. Jeder schien den Augenblick abzuwarten, bis etwas passierte, bis der Mann stürzte oder ihn ein nahendes Auto anfuhr.
Der Mann ging weiter, langsam, bedächtig, in kleinen Schritten, stürzte nicht, erinnerte mich an meinen Vater, der mit Stolz die Gehhilfen verweigert hatte - und immer wieder hingefallen war.
Ich schwang mich vom Rad, lehnte es an die Ampel, eilte auf die Straße. Die anderen glotzten noch immer.
"Kann ich irgendwie helfen?", fragte ich den Trinker, stand schon bereit, ihn abzustützen, ihm Halt zu geben, und wußte zugleich, daß er meine Hilfe verweigern würde.
"Nein, danke. Es geht schon."
Die Stimme, die unter dem wilden Bart hervorquoll, war erstaunlich klar.
Ich zog mich zurück, nur ein paar Meter, beobachtete ihn, um notfalls schnell eingreifen zu können.
Doch der Mann fiel nicht, kam langsam voran, überquerte die Straße und erreichte schließlich die sichere Fußgängerzone.
Die Menge glotzte noch immer, als wäre das Leben eine Fernsehsendung.
Ich schaute dem Mann hinterher, wünschte, ich könnte ihm doch irgendwie helfen, schwang mich auf mein Rad und fuhr davon.
Vor dem BaföG-Amt kam mir jemand entgegen.
'So hätte Vati ausgesehen, wenn der Alkohol nicht gewesen wäre.', durchfuhr es mich.
Ich setzte mich in eine unbeobachtete Ecke und weinte.
morast - 29. Apr, 13:41 - Rubrik:
Wortwelten
Nennt man eigentlich die Kleidungsstücke einer Person, die schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat, sich aber trotzdem - ihrem Alter entsprechend - modisch kleidet, auch
"altmodisch"?
morast - 29. Apr, 13:10 - Rubrik:
Krimskrams
In Ermangelung "echten" Brotes entschloß ich mich heute morgen, Toast verspeisen zu wollen. Zwei Spiegeleier sollten die Mahlzeit kulinarisch aufwerten.
Ich entsann mich, daß in der Vergangenheit die letzten Toastscheiben stets fast noch "roh" gewesen waren, als der Toaster sie auswarf. Selbiges schien auch einer meiner Mitbewohner festgestellt zu haben, hatte er doch den Toaster auf "So-Lange-Wie-Irgend-Möglich" eingestellt.
Ich brutzelte also nebenbei an den Spiegeleiern herum, als ich mich wunderte, warum das Toasten denn heute so viel Zeit in Anspruch nahm. Mit einem fachmännischen Kennerblick durchschaute ich die Situation: Jemand hatte die Toastdauer maximiert.
Allerdings, das wußte ich, bedeutete die Maximaltoastdauer auch eine Maximalschwarzverfärbung, eine Maximalacyrlamidisierung meines Toasts.
Ohne zu zögern betätigte ich den "Stop"-Knopf. Der Toast kam rausgesprungen, gesellte sich zu den mittlerweile fertigen Spiegeleiern.
Hungrig biß ich in die gerösteten Brotscheibe.
'Lecker!', dachte ich.
Tatsächlich kann ich mich nicht entsinnen, jemals eine so angenehm geröstete Scheibe Toast verspeist zu haben.
'Der Zufall ist ein Meisterkoch.', beschloß ich beglückt.
[Im Hintergrund: Halloween - "Master Of The Rings"]
morast - 29. Apr, 09:45 - Rubrik:
Wortwelten
Die von mir bewohnte WG ist verhältnismäßig groß. Das muß sie auch sein, beherbergt sie doch schließlich fünf Studenten zuzüglich diverser spontan oder regelmäßig auftauchender Gäste. Die Größe und die WG-gerechte Anorndung der Zimmer bringt es mit sich, daß der Korridor, von dem die einzelnen Zimmer abzweigen, wie ein Schlauch durch die gesamte Wohnung führt. Das wiederum hat zur Folge, daß die Wohnungstürklingel nur für die Bewohner der ersten zwei, drei Räumlichkeiten hörbar ist - natürlich unter der Voraussetzung, daß keiner von ihnen sich gerade dezibelintensiven Klängen widmet, was aber durchaus zuweilen geschieht.
Um arglose Klingler nicht stundenlang ungehört vor der Außentür stehen zu lassen, installierten wir eine Art Klingelverlängerung, eine lautstarke Hupe, die kraftvoll in den Flurgang dröhnt, sobald die Klingel betätigt wird. Das System funktioniert erstaunlich gut und besitzt nur einen einzigen Haken: Es ist laut, immens laut, zumindest, wenn man sich gerade neben der Hupe befindet, wenn diese losgeht - oder wenn man durch sie aus dem Schlaf gerissen wird.
6.23 Uhr. Es klingelt. Es hupt. Noch einmal. Nochmal. Wieder und wieder.
Durch den Krach aus der Tiefschlafphase herausgezerrt, stehe ich auf, mürrisch, werfe mir ein paar Kleidungsstücke über und eile verdrossen zur Gegensprechanlage, um den sadistischen Dauerklingler zur Rede zu stellen.
Auf dem Gang begegnet mir meien Mitbewohnerin, die der Lärm ebenfalls aus den Federn gerissen hatte.
"Ich glaub', es hackt!", meint sie.
Neben der Klingel steht schon Mitbewohner 1, der Bewohner des eingangstürnächsten Zimmers, ratlos, aber scheinbar schon eine Weile wach:
"Ich habe schon versucht ranzugehen..."
Ich hebe den Hörer der Gegensprechnanlage ab, vernehme nichts.
"Ja!", rufe ich hinein, hörbar schlechtgelaunt.
Keine Reaktion.
Ich stapfe in mein Zimmer zurück, suche meine Brille, werfe mir ein weiteres Kleidungsstück über und stürme dann die 103 Stufen nach unten, um dem bösartigen, vermutlich fliehenden Klingler noch zu begegnen.
Ich reiße die Haustür auf, doch draußen ist niemand.
Auch als ich mich umsehe, entdecke ich niemanden Verdächtiges. Kein Notfall, keine alarmierende Feuerwehr, auch keine wegrennenden Schulkinder, kein befreundeter Spontanbesucher. Nichts.
Mit Runzelfalten auf der Stirn steige ich die 103 Stufen wieder hinauf, schließe die Tür und verkrieche mich ins Bett.
An tiefen Schlaf ist jedoch nicht mehr zu denken - ich schlummere dahin. 9 Uhr wollte ich spätestens aufstehen.
Doch kurz nach 7 Uhr vernehme ich ein erneutes, lautes Tröten, langanhaltend diesmal. Keine Klingel, begreife ich sofort. Das kommt von draußen. Nach etwa einer halben Minute ist es vorbei.
Aber ich bin wach. In der Küche höre ich meinen Mitbewohner rumoren und frage mich, ob man denn wirklich morgens um sieben abwaschen muß. Von draußen dringt Baulärm herein, rückwärtsfahrende und stetig brummende und piepende Kieslaster, Bodenbeben verursachende Wegplättungsmaschinen, die Rufe unbeschäftigter Bauarbeiter. Irgendwo im Haus bohrt jemand. Unaufhörlich.
'Ich sollte wohl aufstehen.', denke ich müde und schleppe mich unter die Dusche.
In meinem Kopf jedoch erkingt ein angenehmes Lied, ein morgendlicher Wurm im Ohr, der meine Laune immerhin zu retten vermag:
Samsas Traum - "Der Wald Der Vergessenen Puppen"
Wieso drang über Nacht die Angst in unsere Geschichte ein?
Wie konnte ein Mensch, schön wie Du,
Innerlich nur so hässlich sein?
...
Guten Morgen.
morast - 29. Apr, 08:45 - Rubrik:
Morgenwurm
Nicht häufig kann ich mich an meine Träume erinnern. Jedoch die von letzter Nacht sind mir noch immer im Gedächnis.
Der erste handelte von einer Art Prüfung. Die Prüflinge mußten anstehen, um irgendwann geprüft werden zu können. Unglaublich, wieviele Studenten neben, vor und hinter mir anstanden. Es bildeten sich riesige Menschenschlangen. Diese wurden abgefertigt wie auf einem Flughafen. Mit Schaltern, Drehtüren und so weiter...
Der zweite Traum war recht wunderlich. Ich träumte von
Frau Kokolores, besser gesagt: von ihrem
Weblog.
Ich entsinne mich noch genau des Headerbildes: Ein Leuchtturm auf blauem Grund. Eine simple, comicartige Zeichnung.
Der neueste Eintrag des Weblogs beinhaltete eine endlose Auflistung von Fotos, auf denen Tassen zu sehen waren. Allesamt mit verschiedenen Leuchtturmmotiven [Ich erinnere mich auch an beigefarbene...]. Frau Kokolores hatte diese vielen Leuchtturmmotivkaffeetassen zum Geburtstag bekommen, freute sich nun darüber wie ein kariertes Honigkuchenpferd und bedankte sich recht artig bei allen Schenkenden.
Scheinbar war sie versessen auf Kaffeetassen mit Leuchtturmmotiv.
Was hatte das nur zu bedeuten...?
morast - 28. Apr, 22:46 - Rubrik:
Wortwelten
"
Liebe ist kein Triumphzug
Sie ist nur ein schwaches
Halleluja." [
Janus]
Ein Faktor innerhalb der Liebe, dem ich bisher wenig Beachtung schenkte, ist die Abhängigkeit. Ich meine nicht die Liebe als Sucht, sondern die Abhängigkeit vom Objekt der eigenen Liebe.
Die Freundin meines Mitbewohners war unlängst in Irland - für acht Monate. Im Herbst wird Sie für weitere acht Monate nach Wales reisen. Diese Ferne würde mich vermutlich zerfetzen. Ich bin der Ansicht, daß Liebe jedes Hindernis zu überwinden vermag [wie romantisch...], und glaube, daß auch hier nach den Monaten der Trennung die Liebe in neualten Blüten erstrahlen wird. Acht Monate sind ein kurzer Zeitraum im Angesicht einer ewig währenden gemeinsamen Zukunft [woran Liebende nunmal zu glauben pflegen]...
Warum aber fährt Sie fort? Warum läßt Sie einen Wartenden zurück, der vermutlich nicht anderes kann, als wegen Seiner Studien hier zu bleiben? Warum verharrt Sie nicht im Alltäglichen?
Ich kenne die beiden, ihre Beziehung, und freue mich für Sie, die Fortfahrende, leide zugleich mit ihnen beiden ob ihrer anstehenden Trennung. Doch Er neigt zu Gewohnheiten, zur Stagnation, zu Prinzipien in jeder Lebenslage, neigt dazu, Sie vergessen zu lassen, wie wichtig Sie für Ihn ist. Und das ist Sie zweifelsohne. Zwar wagt Er selten eine zärtliche Berührung, einen Kuß, eine Umarmung, doch bemüht Er sich, Ihr jeden Weg zu erleichtern, Ihr mit allen, einer Öffentlichkeit aussetzbaren Mitteln zu zeigen, wieviel Sie Ihm bedeutet.
Ich bin mir nicht im Klaren über ihre Zweisamkeiten, doch sicher darüber, daß viele Gewohnheiten in das Leben der beiden eingezogen sind, aus denen auszubrechen sich zuweilen lohnen würde.
Vielleicht flieht Sie tatsächlich, nicht für immer, nur für ein paar Momente, um Ihre Beziehung anschließend noch höher schätzen gelernt zu haben, um die Alltäglichkeiten wieder zu lieben.
Alltäglichkeiten werden in jeder Beziehung auftreten, werden zwei Menschen unbewußt aneinander fesseln. Davor fürchte ich mich nicht. Doch Furcht überkommt mich in dem Augenblick, in dem sich herausstellt, daß außer Alltag nichts verblieb.
Für Ihn, den Zurückbleibenden, stellt sich noch ein weiteres Problem dar: Ein fester Teil Seines Hier und Jetzt nimmt Abstand, verweilt in der Ferne [und ist dort mit Interessantem, Neuem konfrontiert und voerst abgelenkt...]. Sein Verlorensein ist unabdingbar, ein Verlorensein in einer Welt, die nur noch aus Ihm selbst besteht.
Und das ist es, was ich mit Abhängigkeit meine. Hat man einmal tiefe, innige Liebe im eigenen Herzen entdeckt, so ist das Fehlen dieser einer Unvollständigkeit gleichzusetzen, die zwangsläufig zu Unbehagen führt. Erfahren zu haben, was Liebe bewirkt, was sie bedeutet, läßt ihre Abwesenheit schmerzen, als hätte das eigene Leben eine Bereicherung erfahren, deren anschließendes Fehlen aber ein Loch, eine namenlose Leere bedeutet.
Liebe ist ein Luxus, den man nach dessen Gewinn nicht mehr missen möchte.
Dazu gehören auch die Alltäglichkeiten.
Diese erwecken das Bewußtsein der Gegenwart der Liebe, werden schließlich untrennbar mit ihr verbunden. Die gemeinsamen Gewöhnlichkeiten stellen also trotz ihrer Profanität etwas Besonderes dar, da sie zum Symbol der Liebe und deren Tiefe geworden sind.
Fehlt nun durch Trennung auch jene unbedeutende Alltäglichkeit, bekommt der Liebende die Abhängigkeit von Liebe, von mit Liebe verbundenen Gewohnheiten zu spüren, führt die gleiche Leere wie jener, dessen Existenz der Liebe völlig beraubt wurde.
Liebe, selbst wenn sie noch nicht in gemeinsame Alltäglichkeiten ausarten konnte, bedeutet Abhängigkeit. Denn selbst der frisch Verliebte sehnt sich nach Zeichen, nach Bestätigung und vermag sich ohne Symbole, welche die Gegenwart der Liebe verifizieren, nicht wirklich glücklich zu fühlen.
Jeodch bin ich nicht so vermessen, diese Abhängigkeit als etwas grundlegend Negatives zu erachten, ist es auch sie nur ein Symbol für eine Schönheit, die jeglicher Beschreibung trotzt, für ein Empfinden, dem wohl die höchste aller Bedeutungen zukommt.
[Im Hintergrund:
Nine Inch Nails - "With Teeth"]
morast - 28. Apr, 21:53 - Rubrik:
Geistgedanken
Da mir die Vorstellung gefiel, inmitten von Vogelgezwitscher und Sonnenschein den eigenen Gedanken hinterherzuhorchen, hatte ich mir ein wunderschönes Plätzchen am Elbufer ausgesucht, an dem ich es mir gemütlich machte. Ich zückte mein kleines Notizbuch, einen funktionsfähigen Kugelschreiber und schrieb munter drauflos, sinnierte
über Liebe, über Abhängig- und Unvollständigkeit. Hin und wieder klackerten hinter mir ein paar Nordic Walker den Kiesweg entlang, unterhielten sich zu laut, übertönten sogar das Dröhnen des tschechischen Lastschiffs, das langsam vorbeikroch. Ich schrieb, hielt inne, schrieb weiter, hörte mich im Kopf die eigenen Worte dozierend verlesen, lächelte bei diesem Gedanken, lächelte ob meiner guten Laune und der angenehmen Umgebung.
Dann hörte ich Stimmen.
Die Zeit war wie im Flug vergangen; eine Stunde lang hatte ich nur dagesessen, geschrieben und zuweilen selig auf die Elbe gestarrt. Doch nun hörte ich Stimmen. Sie kamen rasch näher.
'Die werden doch nicht...', dachte ich.
"Da sind schon Leute.", hörte ich.
'Leute?', dachte ich und erwiderte das begrüßende Kopfnicken der Neuankömmlinge so freundlich, wie es jemand vermochte, der soeben aus tiefsten Gedanken gerissen worden war und nun keine Möglichkeit mehr sah, dorthin zurückzukehren.
Die beiden Störenden hielten sich an den Händen, tauschten intensive Blicke. Ich hatte wohl ihren romantischen Stammplatz belegt. Das jedoch störte sie nicht; sie entfalten eine karierte Kuscheldecke, ließen sich darauf nieder und kuschelten sich eng aneinander, begannen, sich zu küssen, zu streicheln.
Ich sah weg, wollte nicht länger hier sein, versuchte vergeblich, mich unsichtbar zu machen. Noch ein paar abschließende Worte träufelten aus meinem Geist aufs Papier, bis ich es nicht mehr aushielt.
Ich habe nichts gegen Liebe, gönnen jedem Liebenden das persönliche Glück, freue mich gar, wenn Paare ihre tiefe Zuneigung zueinander zum Ausdruck bringen. Doch mich stört es, wenn mir derartige Liebesbekenntnisse aufgedrängt werden, ohne daß ich ihnen angehöre, wenn ich meiner kleinen Eigenwelt entrissen werde, um in den Strudel einer fremden zu geraten, deren Teil ich nicht sein möchte, nicht sein sollte. Mich stört es, wenn ich mich an scheinbar wohligem Platz plötzlich überflüssig fühle, wenn mir deutlich gemacht wird, daß ich, in dessen heimliches Reich andere eingebrochen waren, auf einmal als Eindringling gelte, obwohl ich nichts weiter gesucht hatte als stille Abgeschiedenheit und die Stimme meiner eigenen Gedanken.
Die Stimme war verstummt, durch fremde ersetzt worden.
Ich klappte mein Notizbuch zu, zog die Schuhe an, stieg auf mein Rad und raste von dannen...
morast - 28. Apr, 20:07 - Rubrik:
Wortwelten
"Du lügst den ganzen Tag."
"Stimmt."
morast - 28. Apr, 14:33 - Rubrik:
Fetzen
"
To Be Continued..." mit "
TBC" abzukürzen, halte ich für unpassend.
morast - 28. Apr, 11:09 - Rubrik:
Wortwelten
Mitten in der Nacht erwachte ich, von abstrusen Gedanken geplagt. Einer davon lautete derart:
Da es im allgemeinen üblich ist, Dinge und Personen bestimmten Schubladen zuzuordnen, sollte das doch ebenso mit Personengruppen funktionieren, die nichts weiter verbindet als die zufällige Gleichheit des Geburtszeitraumes.
Es wurden bereits mehrfach Versuche unternommen, Generationen zu benennen, albernen Überschriften unterzuordnen, als wären alle im selben Zeitraum Geborenen unverwechselbar gleich, mit den gleichen politischen und sozialen Umständen aufgewachsen und hätten demnach allesamt dasselbe erlebt und zu erzählen.
'Generation Golf' und 'Generation iPod' stellen solche Versuche dar.
Doch das ist noch steigerbar.
Auch muß man sich nicht die Mühe machen, kreative Ideen fließen zu lassen und alle einer Generation Angehörigen bestimmten Produkten oder Werten zuzuordnen.
Einfacher wäre es doch, durchzunumerieren oder besser: durchzualphabetisieren.
Irgendwann beginnt man mit "A", bezeichnet wahllos eine Generation als "Generation A" und nennt die danach folgende "B", die darauffolgende "C" usw.
Bleibt die Frage, wo man beginnen sollte, da es irgendwie vor jeder Generation schon einmal eine gegeben haben muß. Das alte Huhn-oder-Ei-Problem.
DIe Lösung ist einfach:
Ich möchte, daß meine Generation mit "D" klassifiziert wird.
Ich bin ein Teil der D-Generation.
...
[Im Hintergrund: Tool - "Aenima"]
morast - 28. Apr, 11:06 - Rubrik:
Wortwelten
Als Reaktion auf einen Weblogeintrag bei Irgend Link kamen mir folgende Worte in den Sinn:
Ich urlaubte schon dreimal auf der Insel Kreta. Ich würde gern behaupten, ich verweilte abseits touristischer Einflüsse, aber das wäre eine Lüge. Aber ich war in einem Dorf, wo keine Monsterhotels standen und nur zwei Souvenirläden existierten.
Ich bewunderte in diesen Urlauben immer wieder die griechische Gelassenheit, die Ruhe, mit der sie alle ihre Tätigkeiten angehen. Das färbte sich ab.
Zumeist hielt die Abfärbung nicht lange. Kaum war ich in heimtliche Lande zurückkehrt und ein paar Tage der Hektik anderer ausgesetzt gewesen, verlor ich alle aufersehnte Gelassenheit, alle Ruhe.
Nun aber, nachdem ich drei Mal dort verweilte, nachdem ich mein Grundstudium längst hinter mir ließ und mich immer wieder frage, ob mein Weg denn der richtige sei und beruhigt feststelle, zu keiner Lösung kommen zu können, bemerke ich die Gelassenheit in mir.
Ich trage keine Uhr. Zu terminlichen Verpflichtungen versuche ich selbstverständlich pünktlich zu sein, doch lasse es mir nich nehmen, vorher in Ruhe zu lesen oder zu frühstücken. Es gibt keinen Grund, sich über einen verpaßten Bus zu ärgern oder mit dem Auto waghalsig durch die Innenstadt zu düsen - nur um fünf Minuten eher vor dem heimischen Fernseher sitzen und Sendungen wie "Die Burg" schauen zu können.
Es ist das Wissen, daß alles seinen Weg gehen wird, daß es keinen falschen Weg geben kann, einfach weil das eigene Leben nur über einen Weg verfügt und keine Möglichkeit besteht, zurückzugehen und anders zu wählen oder zu schauen, was bei anderen Daseinsvarianten herausgekommen wäre.
Ich will nicht behaupten, daß deswegen alles prinzipiell richtig ist; aber ich habe aufgehört, mich um vieles zu grämen.
Beispielsweise studiere ich ein Fach, das zwar interessant ist, aber mich zuweilen nervt und zweifeln läßt, ob ich in späterer Berufswelt mich mit derartigem auseinandersetzen möchte. Ich beschäftige mich mit anderem, nebenbei, und freue mich darüber, in Zukunft, wenn ich mein Studium abgeschlossen haben werde, nicht nur einen [den geradlinigen], sondern unzählige Wege vor meinen Füßen liegen zu sehen. Und jeder ist irgendwie der Richtige.
Das nimmt mir zuweilen viele Ängste und schenkt eine Ruhe, die mir das Gefühl gibt, von der Welt um mich herum abgeschottet zu sein, in Eigenzeit eingeschlossen, die langsamer verläuft, doch mehr Platz hat für mich selbst...
Und noch während ich das schreibe, rennt meine Mitbewohnerin mehrmals hektisch an meinem Zimmer vorbei. 'Keine Zeit!', murmelt sie, als ich sie verwundert anblicke...
morast - 28. Apr, 09:23 - Rubrik:
Wortwelten
Ich stieg aus.
In Indien ist es nicht üblich, den eigenen Kindern beizubringen, daß man zuerst die Leute aus der Bahn herauszulassen habe, bevor man selbst einsteigt. In Deutschland schon. Ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht.
Festzustellen war jedoch, daß sich, als ich versuchte, aus der Straßenbahn auszusteigen, mich mit einer vielköpfigen Menschenmasse konfrontiert sah, die in kompletter Form in die Bahn hineinzugelangen versuchte. Dabei war wichtig, dem Nebenmann keinen Zentimeter Platz zu gönnen; vielleicht wäre er sonst derjenige, der den letzten freien, guten Sitzplatz vor der eigenen Nase wegschnappte.
Die Masse drängte hinein; ich wollte hinaus, stand schon der Tür, doch gleichzeitig auch vor einem nahezu undurchdringlichen Hindernis. Der Menschenleiberpulk wurde angeführt von einer ganz in Schwarz gekleideten, beleibten jungen Dame, die ihre Handtasche wie einen Schild vor sich hielt. Auch die Handtasche war schwarz. Allerdings hatte sich der Designer der Tasche wohl gedacht, daß Schwarz allein wenig Stil mit sich bringe und etwas Buntes, Glitzerndes, Witziges, Frisches, Peppiges hinzugefügt werden müßte. Und so funkelten auf der Tasche in riesigen pinkfarbenen Glitzerbuchstaben die Worte "PINK BAG". Ich schaute hin, wunderte mich, schaute nochmal. Tatsächlich; die Tasche war noch immer schwarz, tiefschwarz, und einzig die alberne Glitzerbuchstaben verfügte über eine Pinkfärbung.
'Haha!', wollte ich denken, als die Menschenmasse über mich hereinbrach, mich überrollte, mich in die Bahn zurückdrängte, auf die freien Sitzgelegenheiten quoll, hastete, als gäbe es nichts Wichtigeres.
Ich floh, eilte durch den Wagon nach hinten, zur letzten Tür, stieg aus, frei, unbelästigt, unbehelligt, ohne Platznot, mit dem Bild einer schwarzen Handtasche im Kopf, die von sich behauptete, pink zu sein.
Mit mir zusammen stieg eine ältere Frau aus, welche die Sechzig schon überschritten hatte. Ihre letzten Worte an den gerade verabschiedeten, scheinbar befreundeten Fahrgast waren:
"Ich schreib dir ne Mail."
Verdutzt blieb ich stehen, sah der grauhaarigen Dame nach und bemerkte nicht, wie sich hinter mir die Türen schlossen und die Straßenbahn davonfuhr.
morast - 27. Apr, 20:00 - Rubrik:
Bahnbegegnungen
Das Wort des heutigen Tages sei
Geifer.
Bevor ich die geifernden Stimmen aus dem imaginären Publikum vernehme, die sich darüber auslassen, wie eklig dieses Wort doch sei, biete ich eine kleine Erklärung an:
Ich wohne im Dachgeschoß. Dächer verfügen über die zuweilen unerfreuliche Eigenschaft, sich in den oberen Regionen eines Bauwerkes aufhalten zu wollen, weswegen meine Etage nur über inexistente Fahrstühle oder unzählige Treppenstufen erreichbar ist.
Einhundertunddrei. 103. Das ist die Zahl der Stufen, die ich täglich mehrfach begehe. Hoch und runter. Runter und hoch.
Wenn ich mich beeile, schaffe ich es, in weniger als zwei Minuten den Müll runterzubringen. Wenn ich aber einen schlechten Tag erwische, benötige ich deutlich länger, krieche die einzelnen Stufen herauf, schleiche mühevoll an von der Putzfrau übersehenen Einkaufszettelfetzen und unter das Geländer geklebten, durchgekauten Hubbabubba-Kaugummis vorbei, ärgere mich über den gehässigen Feuermelder, der mir anzeigt, daß ich noch zwei weitere Etagen, also vierzig unüberwindbare Stufen, zu erklimmen habe.
Heute war kein schlechter Tag, doch meine Mitbewohnerin begleitete mich, vom Mensaessen gesättigt und mit innerer Trägheit überflutet. Den Wohnungstürschlüssel in der rechten Hand haltend [Ich hatte meinen versehentlich vergessen.] schlich sie die Stufen hinauf, bei jedem Treppenabsatz aufstöhnend.
Ich hatte genug Zeit, nebenbei den prozentualen Anteil bereits hinter uns gebrachter Stufen zu dem noch zu besteigender im Kopf ins Verhältnis zu setzen und mit allerlei Zahlen zu jonglieren, die Namensschilder der unter uns Wohnenden intensiv zu betrachten, den orangfarbenen Kaugummi einer gründlichen Musterung zu unterziehen und die Dreckkrümel auf dem Boden zu zählen.
"Was ist DAS!?", fragte meine Mitbewohnerin angewidert und deutete auf einen schwarzen Fleck am Boden.
Im ersten Augenblick hielt ich es für Schmutz, für irgendeine organische Flüssigkeit, die sich nach mehreren Tagen in eine feste, schwarze Substanz verwandelt hatte.
"Ein Brandfleck?", mutmaßte meine Mitbewohnerin.
Ich gab ihr recht, denn tatsächlich sah der schwarze Fleck aus, als wäre er eingebrannt worden. Nun ja, nicht ganz, eher, als wäre das Linoleum der Treppenstufe kurz Zeit großer Hitze ausgesetzt gewesen - allerdings nur an dieser einen Stelle, deren Durchmesser vielleicht drei Zentimeter betrug.
'Säure!', dachte ich plötzlich, stellte mir vor, wie ein verrückter Wissenschaftler mittels einer Pinzette ein paar Tropfen hochkonzentrierter Schwefelsäure auf den Boden träufelte und wohlig sabbernd die vom verkohlten Linoleum aufsteigenden Dämpfe inhalierte.
Moment. Sabber? Säure? Da war doch was!?
Na klar: Aliens!
Und nun war alles klar.
Kein Brand, keine verderbliche Flüssigkeit, kein verrückter Wissenschaftler hatte zur Entstehung des mysteriösen schwarzen Flecks beigetragen. Nur ein riesiges, häßliches, von Sigourney Weaver verschontes Alienmonstrum, das im Treppenhaus heimlich arglosen Mietern aufgelauert und dabei seinen ätzenden Geifer auf irgendeiner der 103 Stufen verteilt hatte...
Und schon setzte sich das Wort Geifer in meinen Schädel und verleitete mich zu der Feststellung, daß es nicht nur einen interessanten und ungewohnten Klang besaß, sondern unbedingt zum Wort des Tages gekürt werden sollte.
Allerdings werde ich wohl in der nächsten Zeit nicht mehr Rad fahren. Wer weiß, was sich im Fahrradkeller versteckt...
morast - 27. Apr, 15:05 - Rubrik:
Tageswort
Eine meiner Aufgaben als Zivildienstleistender im Krankenhaus war es, Patienten zu Röntgen, Computertomographie, Ultraschall etc zu begleiten. In den meisten Fällen war das nötig, wenn der Patient sich alleine nur mühsam oder unsicher [oder gar nicht] fortbewegen konnte oder die Gefahr einer Irrwanderung inerhalb des riesigen Krankenhauskomplexes bestand.
Diese bestand immer. Meine ersten Wochen als Zivildienstleistender waren ein navigatorischen Greuel. Auf meine Orientierungsfähigkeiten war noch nie sonderlich Verlaß gewesen, doch die Ratschläge der wegweisenden Schwestern taten ihr Übriges, um mich komplett zu verwirren. Schließlich waren die meisten genannten Wegziele seit Jahren schon nicht mehr nicht dort anzutreffen, wo sie nach Meinung der Wegweisenden hätten sein sollen. Unterwegs irgendeine weißbekittelte Gestalt zu fragen, war zum einen einigermaßen respektlos [Ich war nur Drecks-Zivi, und bei meinem Gegegnüber konnte sich womöglich gar um einen Chefarzt oder Professor - oder beides - handeln...] zum anderen aber auch erstaunlich erfolglos.
Die wenigsten Krankenhausangestellten wußten tatsächlich wo das Röntgen war, wo ich neue weiße Wäsche bekam, wohin man sich wenden mußte, wenn man diesem oder jenem Arzt etwas zu überreichen hatte.
Ich fragte mich durch - andere Zivis halfen weiter -, suchte, probierte, riet. So viel hatte ich nicht zu tun, als daß ich nicht das ganze Gebäude allmählich durchstöbern konnte. Tatsächlich schlenderte ich eines Tages gelassen den Hauptgang entlang, als mir meine vorgesetzte Oberschwester über den Weg lief, mich herumschlendern sah und verbissen fragte:
"Sie haben wohl nichts zu tun, oder wie?"
Ich hatte tatsächlich nichts zu tun, wenn man von einem Gang zur Apotheke absah, nach dessen Rückkehr mir Langweile drohte. Doch ich schwieg, zeigte auf die Apotheke. Zuzugeben, daß man nichts zu tun habe, konnte desaströs enden.
"Naja, denn...", giftete die Oberschwester und eilte von dannen. Sie hatte es immer eilig. War immer gestreßt. Und sie konnte mich nicht leiden.
Dazu gab es auch allen Grund; schließlich neigt ein gelangweilter 18Jähriger in einem zehngeschössigen Bauwerk schon einmal dazu, sämtliche Knöpfe im Fahrstuhl zu drücken, bevor er hastig aussteigt - und gerade noch sieht, wie die Oberschwester diesen Fahrstuhl betritt und ihm einen mißtrauischen Blick zuwirft, der später in eine unangenehme Unterredung münden sollte...
Einer der unangenehmsten Wege, die ich innerhalb des Krankenhauskomplexes zu erledigen hatte, war der Auftrag, eine beleibte Frau aus arabischen Landen zum Röntgen zu bringen. Diese verstand zwar kein einziges Wort Deutsch, war aber immer sehr freundlich gewesen und hatte ständig versucht, allen Krankenschwestern, Ärzten und Zivis ihre nicht unbedingt wohlschmeckenden Kekse anzudrehen.
Der Weg zum Röntgen dauerte seine Zeit. Ging ich alleine, konnte ich mit etwa drei bis fünf Minuten Fußmarsch rechnen - ohne Berücksichtigung der Auf-Den-Fahrstuhl-Wartedauer. Mit Patienten dauerte der Weg natürlich wesentlich länger; denn diejenigen, die ihn in gleicher Geschwindigkeit wie ich zurücklegen konnten [und davon gab es glücklichereise genug], waren auf meine Begleitung nicht angewiesen. Der Rest brauchte eben eine Weile.
Die Araberin ging langsam, gemächlich. Das hätte mich nicht weiter gestört, wäre sie nicht in ihren Traditionen und Bräuchen verhangen gewesen, die ihr befahlen, aufzwangen, hinter einem Mann [und sei er noch so jung] hinterherlaufen zu müssen, Abstand zu wahren.
Zuerst begriff ich nicht. Ich ging los, doch sie rührte sich nicht, kam erst allmählich nach. Sie bewegte sich langsam; doch wenn ich anhielt, um sie aufholen zu lassen, blieb auch sie stehen.
Wir kamen kaum voran. Schließlich war es meine Aufgabe, die Frau zum Röntgen zu begleiten, nicht wie ein albernes, berädertes hölzernes Kinderspielzeug hinter mir her dackeln zu lassen. Ich hatte den Auftrag, sie zu führen, ihr, wenn nötig, behilflich zu sein.
Doch sie lief hinter mir, langsam. Immer wieder sah ich mich um, lächelte ihr aufmunternd zu. Doch sie sah mich nicht an, ging weiter und weiter, achtete immer auf den Abstand zwischen uns.
Wenn ich um eine Ecke bog, kam sie mir erst nach, wenn sie sicher sein konnte, daß ich weitergegangen war und nicht auf der anderen Seite wartete. Wenn ich jemanden traf, den ich kannte und mit ihm ein paar Worte wechselte, blieb sie stehen, als gehörte sie nicht zu mir, und ich mußte immer wieder zurückschauen, um mich zu vergewissern, daß sei noch hinter mir war.
Ich glaube, daß ich - noch nicht einmal, wenn ich [gegen die Arbeitsauflangen verstoßend] allein ein gefülltes Krankenbett durch die Gänge karrte - noch nie derart lange für den Weg von der Station zum Röntgen gebraucht habe.
Zum Glück sollte ich die Frau nur abliefern, nicht auf sie warten und sie - vorerst - nicht abholen.
Ich hatte mehr als eine halbe Stunde sinnlos vertrödelt, einzig mit Warten, Schauen und langsamem Gehen.
'Gute Leistung.', dachte ich, meldete mich auf Station ab, ging mit meinem Zivi-Kumpel erst einmal eine geschlagene Stunde lang Essen, wohnte dann noch dem ausgiebigen Kaffekränzchen der Schwestern bei und durfte mich dann umziehen, durfte nach Hause gehen.
Auf dem Heimweg jedoch fühlte ich immer wieder den Drang in mir, mich umzudrehen, glaubte einen Schatten hinter mir gesehen zu haben, der mir unaufhörlich, in stetig gleichem Abstand folgte...
morast - 27. Apr, 12:25 - Rubrik:
Wortwelten