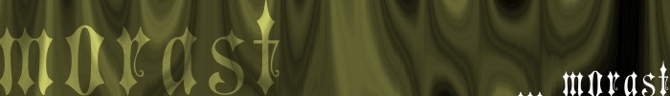Ich liebe dich.
Es gibt Momente der Stille, in denen ich - von meiner Liebe erfüllt, ausgefüllt, überflutet - mich nicht länger zurückzuhalten vermag, in denen ich jene bedeutsamen drei Worte in die leere, frühlingswarme Luft posaune, lache, flüstere, in denen ich mich mittels weniger Laute aus den Fängen meiner Gedanken befreie.
Ich liebe dich, rufe ich, zuweilen lautlos, zuweilen voll inniger Inbrunst, verkünde ich der Welt, die sich verwundert umdreht und getuschelte Worte wechselt. Ich liebe dich, ich weiß es, weiß es tief, weiß es mit grenzenloser Sicherheit.
Mein Lächeln, getragen von der aus meinem Herzen entweichenden Sehnsucht, glimmt auf, malt ein kindliches Glitzern in meine Augen und scheint diesen Augenblick mit einem Gedanken zu befüllen, der alles bewegt, alles bedeutet.
Ich liebe dich.
In solchen Momenten bin ich zu Heldentaten bereit, harre der blutrünstigen Drachen, die es zu besiegen gilt, der finsteren Riesen, deren Lachen zu finden ist. Ich bin bereit zu fliegen, mich selbst zu verlieren und im Sonnenrot wiederzufinden, bin bereit zu leben, als gäbe es kein Morgen. In solchen Momenten erkenne ich die unfaßbare Schönheit, die den Dingen innewohnt, den namenlosen Glanz, den ich immer wieder ersuche. In solchen Momenten entdecke ich mich als denjenigen, der ich bin, als denjenigen, der mich träumt, als denjenigen, der leuchtenden Herzens lächelt, als denjenigen, der liebt.
Ich liebe dich.
Und es ist wahr, denn ich bin bewegt, gerührt, entfesselt, atme mit jedem Seufzer einen Schwall güldener Sterne aus meiner Brust.
Als der Moment verweht, stehe ich ratlos, haltlos in der Stille, den stumpfen Blicken der anderen ausgesetzt, höre noch leise im Herzen meine eigenen Worte verschallen - und frage mich traurig, wer du bist.
-----
morast - 15. Apr, 22:51 - Rubrik:
Geistgedanken
Des Frühlings Farbe ist Rot.
Nein, ich versuche nicht, einen Farbwandel des bekannten blauen Bands des Frühlings zu erwirken, sondern rede einzig und allein von meinen Augen. Diese, mit wunderschöner blaugrauer Regenbogenhaut versehen, nahmen in den letzten Tagen eine ungesund rote Färbung an. Es ist Frühling, denke ich, wenn ich in den Spiegel blicke, wenn ich den unangenehmen Juckreiz in den Augen verspüre. Es ist Frühling, denke ich, wenn ich mich vom Sonnenschein geblendet mit netten Freunden oder weniger netten Lernutensilien auf bläulichen blühenden Wiesen niederlasse und hin und wieder herzhaft zu niesen beginne. Es ist Frühling. Mein Indikatorheuschnupfen weiß es genau. Ängstlich harre ich des Tages, da ein nerviges und unauslöschbares Kribbeln zwischen Gehörgang und Mundhöhle einsetzen wird, das kein Kratzen, kein Schnalzen, kein Ignorieren zu vertreiben vermag.
'Noch ist es nicht soweit.'. denke ich vergnügt und reibe mir mit schmutzigen Fingern die juckenden Augen.
-----
morast - 15. Apr, 19:05 - Rubrik:
Wortwelten
Ich liebe es aufzuwachen. Zumindest manchmal.
Schon häufig kam mir der Gedanke, wie toll es sein muß, sich einfach mal den Wecker zwei Stunden zu früh zu stellen, mitten in der Nacht aus den schönsten Träumen gerissen zu werden, verärgert die ersten Laute des Tages zu murmeln ["Och nö..."], mit verklebten Augen einen Blick auf das vermaledeite Klingelding zu werfen - und dann erfreut festzustellen, daß man noch zwei Stunden Schlaf übrig hat, sich fröhlich grinsend wieder in die Kissen zu kuscheln und erneut ins Traumland zu entschwinden.
Denn das Schönste am Aufwachen ist eindeutig das Weiterschlafen.
Ähnlich agierte ich heute morgen. 8 Uhr klingelte der Wecker. Zeitiger durfte er nicht, denn da ich es auf diversen Gründne niemals schaffe, vor Mitternacht zu Bett zu gehen, verblieben mir so immerhin acht Stunden wahrlich nötigen Schönheitsschlafs.
Der Wecker klingelte, pentetrant, nervig, viel zu laut. Ich stellte ihn ab, drehte mich um. Nur noch ein paar Minuten. Nichts drängte, kein Termin, zumindest kein echter. Es gab genug Arbeit, die auf mich wartete, doch all das konnte ich vorerst vergessen, ignorieren und mich mit geschlossenen Augen der Tatsache erfreuen, daß mein Bett vor allem in den Morgenstunden unglaublich bequem ist.
Der Nachteil am Weiterschlafen ist das Aufwachen. Besser: Das Aufstehen-Müssen. Kein zweiter Wecker erinnerte mich daran, daß ich schon wieder eingeschlafen war, daß ich im Begriff war, den Vormittag unnütz verstreichen zu lassen.
Halb zehn öffnete ich die Augen, war plötzlich wach - und kreativ. Ideen für meine Studienarbeit schossen durch meinen Kopf, wollten niedergeschrieben werden. Neuer Tag, ich komme!
Irgendwo in den Tiefen meines Geistes erklang Edguy mit "Tears Of A Mandrake", und ich wippte den Kopf ein wenig im Takt, bis ich mich endgültig erhob und unter der Dusche verschwand.
Guten Morgen, Welt.
-----
morast - 15. Apr, 16:39 - Rubrik:
Morgenwurm
... wie eine zärtliche Umarmung, die kein Ende nimmt.
-----
morast - 14. Apr, 22:51 - Rubrik:
Geistgedanken
Mein Vermieter ist ein geiziges, arrogantes Arschloch.
Glücklicherweise verstehe ich mich mit ihm recht gut, nenne ihm beim Vornamen und benutze das vertrauliche "du". Ich glaube, darauf besteht er, will er doch jung und dynamisch wirken.
Tortzdem ist er geizig. Seitdem ich hier wohne, wird das Haus saniert. Zwei Bauarbeiter schuften Tag für Tag an einem fünfstöckigen Gebäude, daß drei offizielle und zwei inoffzielle Eingänge [Rechtsanwaltkanzlei, Brasserie] besitzt und zudem noch um einen Innenhof angeordnet ist. Zwar kann man ihnen nicht absprechen, allmählich voranzukommen, doch sind vier Hände bei einem Altbau dieser Größe zu keinen blitzschnellen Überleistungen imstande. Glücklicherweise machen zwei Leute auch wesentlich weniger Baulärm als zehn.
Warum nur zwei?, fragte ich einst. Ist billiger, vernahm ich. Toll.
Seine langjährige Freundin will er auch nicht heiraten. Nicht, weil er sie nicht mögen würde, sondern einzig und allein weil er dazu einen detaillierten Ehevertrag aufsetzen müßte - und ihr trotzdem unterstellte, sie liefe nach der Hochzeit einfach mit allem Hab und Gut davon.
Mittagessen gibt es zumeist in der Uni-Mensa. Schließlich ist er selbst noch irgendwo eingeschriebener Student. Und Mutti, der das Gebäude eigentlich gehört, kommt gleich mit. Zu Studentenpreisen natürlich.
Irgendwann soltle der Innenhof verschönert werden. Ein albernes Unterfangen, findet man doch dort ein wildes Chaos aus überquellenden Mülltonnen, wirr angeordneten Fahrrädern und Unmengen von Bauschutt. Doch ein paar Pflänzchen sollen ja Wunder bewirken können - vermutlich auch winzige Nadelbäumchen, die man normalerweise auf Friedhöfen pflanzt: Koniferen. Sechs Stück leistete er sich, ließ sie vom Hausmeister eingraben.
Zwei Tage später waren sie fort. Ich wunderte mich ein wenig. Doch nicht sehr, hatte ich doch längst aufgehört, nach den Beweggründen für derartiges zu fragen. Vermutlich war ihre Pflege zu kostenintensiv. Wasser ist ja auch nicht mehr so billig wie früher...
Doch ich irrte mich. Die sechs Koniferen gab es noch. Nur standen sie jetzt vor Hauseingang 1, dort, wo der Vermieter selbst tagtäglich ein- und auszugehen pflegte. In einem Anflug von Größenwahn war ihm wohl die Idee gekommen, das Gebäude nach außen hin dekorativer zu gestalten. Auf dem Innenhof sah niemand die teuren Pflänzchen. Doch draußen...
Die sechs Koniferen säumten den Weg zum Eingang. Drei links. Drei rechts. Sie sahen erbärmlich aus. Inmitten einer kahlen graubraunen Fläche standen sie und überlegten, ob es besser wäre zu wachsen oder einzugehen. Ich glaube, sie haben sich bis heute nicht entschieden.
Der Vermieter jedoch hatte sich entschieden. Nämlich für die Verschönerung des Außenbereichs. Weitere Pflanzen mußten her. Das Beet durfte nicht länger als Parkplatz mißbraucht werden.
Und tatsächlich: Wenige Tage später schmückten auch unseren Eingang divere Pflänzchen. Sie waren grün, soviel sei zu sagen. Vermutlich ein preiswertes Sonderangebot immergrüner unverwüstlicher Superpflanzen, noch widerstandfähiger als jede Kunstblume.
Es waren nicht viele. Sechs oder sieben. Jede einzelne von ihnen bildete den Mittelpunkt eines Kreises mit drei Metern Durchmesser, in dessen Inneren außer der einen keine weitere Pflanze stehen durfte. Das Beet wirkte leerer als zuvor.
Doch wie um allen Mietern zu beweisen, was für ein feiner Kerl er gewesen war, in welche Kosten er sich gestürzt hatte, als er die Pflanzen erwarb, waren alle Schilder an den einzelnen grünen Büscheln verblieben. Jeder Interessent konnte also nicht nur erfahren, wie das dekorative Element zu betiteln war, sondern auch, wie man es zu pflegen hatte. Ich wette, selbst die Preisschilder [natürlich die originalen, vor der Preissenkung] klebten auch auch noch dran, zeugten vom Großmut des Vermieters.
Jeden Tag, wenn ich heimkehre, betrachte ich nun unser Beet, sehe auf die spärliche Anzahl an Pflanzen herab und stelle fest, daß ihnen jeder dekorativer Effekt, jede Schönheit verlorengeht, so traurig und einsam, wie sie auf dem kargen Boden herumvegetieren.
Doch eine gute Sache hat dieser halbherzige Verschönerungsversuch. Nun, da es wärmer wird und die Pflänzchen um Wasser betteln, das ihnen aufgrund des angestiegenen Kaltwasserpreises verwehrt wird, entbehrt es nicht einer gewissen fesselnden Spannung, täglich den Pflanzen beim allmählichen Sterben zuzusehen.
Eine hat es schon geschafft; der Rest ist auf bestem Weg.
-----
morast - 14. Apr, 19:04 - Rubrik:
Wortwelten
... als Fußgänger an einer roten Ampel zu warten, obgleich weit und breit weder ein Auto noch ein Kind [dem man ein schlechtes Vorbild sein könnte] zu sehen ist.
Das zumindest behauptet das übliche Klischee.
Gestern jedoch erlebte ich etwas, das in die gleiche staubige Schublade paßt und mir gewisse Verwunderung verschaffte:
Ich saß mit zwei Freundinnen im Kino. 15-Uhr-Vorstellungen haben die Angewohnheit, nicht unbedingt mit unüberschaubaren Scharen filmfreudigem Publikums vollgestopft zu sein. Kurz: Der Saal war verhältnismäßig leer, außer uns befanden sich in ihm vielleicht zehn, fünfzehn Leute, die meisten davon Kinder. Es hätten aber noch bestimmt zwehundert reingepaßt. Oder mehr.
Wir waren zu früh, lümmelten uns in den rotplüschigen Kinosesseln herum, futterten Popcorn und unterhielten uns unpassenderweise über riesengroße Männerpuller. Nebenbei beobachteten wir die Umgebung.
Die meisten Hereinkommenden agierten ähnlich wie wir, bemerkten den Kinosaal und dessen Leere und plazierten sich irgendwo, von wo sie glaubten, gut sehen zu können - ohne die riesengroßen Goldletter "LOGE" auf den Lehnen überhaupt eines Blickes zu würdigen.
Dann jedoch trat eine Omi ein, ihr Enkelkind wie ein an der Leine geführtes Spielzeug hinter sich her ziehend, ja fast schleifend. Sie ging nach oben, und wieder hinab, holte ihre Eintrittskarte heraus, warf einen unsicheren Blick darauf [Brille vergessen?], wählte eine Reihe im Logenbereich aus, suchte die Sitzplatznumerierungen ab, entfernte sich wieder aus der Reihe, nahm die nächste.
So ging das eine Weile. Der kleine Junge ließ sich das Herumgezerre wortlos gefallen. Die Omi jedoch wollte sich partout nicht setzen, gab sich nicht zufrieden, schaute immer wieder auf die Sitzplatzbezeichnung ihrer Eintrittskarten, suchte, doch fand nicht.
"Setzen Sie sich doch einfach irgendwohin.", sagte A freundlich.
Sie schaute auf, antworte nicht, suchte weiter, betrat irgendeine Reihe hinter uns.
Das Lichtg ging aus, und während die lästigen und kinderuntauglichen Werbespots auf der Leinwand herumflimmerten, fragte ich mich, ob die Omi und ihr Engkelkind denn mittlerweile säßen und wie normal es ist, in einem leeren Kinosaal eintrittskartenorientiert nach dem "richtigen" Sitzplatz zu suchen.
Ist das typisch deutsch?, wunderte ich mich.
-----
morast - 14. Apr, 19:03 - Rubrik:
Wortwelten
Der gestrige Vormittag gehörte der 89.
Besser: Dem Jahr 1989. Schließlich versuchte ständig das bereits 16 Jahre Zurückliegende mit schwacher Stimme seine Existenz in meinem Kopf zu behaupten, mit diversen Zeichen auf sich aufmerksam zu machen. Was war 1989? Ja, sicherlich, die Wende. Doch ich war acht und wenig am politischen Geschehen interessiert.
1989 war ich in der zweiten Klasse und wechselte in die dritte. Das war ein enormer Einschnitt in meinem Dasein, hatte ich mich doch dazu entschlossen, eine Russischschule zu besuchen, in der ab der dritten Klasse Russisch gelehrt werden würde. Tatsächlich waren derartige Russischschüler damals etwas Besonderes, und ich war stolz darauf, die Schule wechseln zu dürfen.
Naja, der Wechsel war nicht immens; schließlich befand sich die Russischschule N.K. Krupskaja direkt neben meiner alten. Trotzdem kam ich in eine neue Klasse, kannte nur ein einziges Mädchen und konnte dieses noch nicht einmal sonderlich leiden.
Wesentlich bedeutsamer aber ist vielleicht das Ereignis am letzten bzw vorletzten Schultag der zweiten Klasse. Denn am Nachmittag des vorletzten Schultages war es endlich soweit, auch wenn ich nicht sagen konnte, davon begeistert gewesen zu sein: Ich sollte eine Brille bekommen.
Das klingt wenig bedeutsam, war es aber. Zum einen, weil ich an jenem vorletzten Tag die Brille, ein nicht unbedingt außergewöhnlich hübsches Modell, erhielt und verpflichtet war, sie ständig zu tragen. Also auch am nächsten Tag. Also auch vor meinen Noch-Mitschülern.
Mich ärgerte das ein bißchen. Hätte ich nicht noch einen Tag warten können? Meine Mitschüler hätten mich dann nur ohne Brille gekannt und keine Gelegenheit erhalten, sich über mich lustig zu machen. Und meine neuen Mitschüler an der neuen Schule würden gar nicht wissen, daß ich vorher keine Brille trug.
Aber so sollte es nicht sein. Ich ging zur Schule, war auf das Schlimmste gefaßt. Doch das kam nicht. Ein paar nette Bemerkungen; das wars. Die Zeugnisse wurden verteilt, und ich war nicht länger Schüler dieser Schule, nicht länger Bestandteil dieser Klasse.
Bedeutsam war das Brillenereignis auch aus einem anderen Grund: Bis heute trage ich eine Brille; meine Augen haben sich stetig verschlechtert (auch wenn sie in den letzten Jahren einigerma0en konstant schlecht blieben). Meine erste Handbewegung nach dem Aufwachen geht zur Brille. Ohne sie wäre alles schwammig und verwaschen. Ohne sie wäre ich blind. Ohne sie könnte ich problemlos headbangen. Ohne sie sähe ich nicht halb so intelligent aus.
Das war 1989.
Gestern, am Vormittag des 13. April 2005, wurde ich daran erinnert.
Es fing harmlos an. Ich las. "Herr Lehmann" von Sven Regener. Ein schönes Werk. Spielt im Jahr 1989. Plötzlich lauschte ich der zufällig ausgewählten Musik genauer: Janus. "Neunundachtzig". Ich wunderte mich. Und dann, als ich eine Überweisung tätigte, bestand die TAN aus einer Zahl, die gut und gerne ein Datum hätte sein können: 29.08.1989.
Was war an diesem Tag?, überlegte ich. Ich weiß es nicht, weiß es wirklich nicht.
Doch die Erinnerung an das Jahr, in dem ich meine Brille bekam, ließ mich nicht los.
Vielleicht sollte ich mal wieder zum Augenarzt gehen, dachte ich.
-----
morast - 14. Apr, 19:02 - Rubrik:
Wortwelten
G hat, wie viele Deutsche heutzutage, einen Computer, nicht sonderlich alt, aber auch nicht sonderlich neu. Da Windows ein Betriebssystem ist, das mit allerhand Kokolores ausgestattet ist, nahm ich mir einst die Frechheit heraus, mittels des an den Rechner angeschlossenen Mikrophons neben Gitarrenklängen und Gesangversuchen ein lächerliches "Hallo." aufzunehmen, das klang, als würde ein kastrierter Zehnjähriger mit hoher Stimme sehr schnell und vor allem undeutlich irgendeine beliebige Begrüßungsformel murmeln. Man erkannte mich nicht, glaube ich. Um G zu
ärgern erfreuen, initiierte ich in einem Moment seiner körperlichen Abwesenheit, daß eben jenes "Hallo."-Geräusch die zukünftige akustische Startsequenz seines Rechners werden sollte. Als Herunterfahrklang wählte ich ein "Chrrrrrrr" [mit gerolltem R] aus, das zwar aus Gs Mund stammte, aber klang, als hätte es der Sänger/Grunzer/Schreihals
Dani Filth von der Musikgruppe
Cradle of Filth ausgestoßen. Wahrlich genial. Und so erfreute ich mich jedesmal, wenn der Rechner hoch- oder runterfuhr, der genannten Geräuschkulisse.
Neulich gestand mir G, daß sein Kumpel das Runterfahrgeräusch verändert habe. Nun ertönt ein "(Gähn), müüüde.". Kein Ersatz für ein ordentliches "Chrrrrrrr", dachte ich und erkundigte mich besorgt nach meinem geliebten "Hallo.". Das existiere noch, versicherte mir G. Ich war besänftigt, mußte sogar lachen, als mir G gestand, er würde jedesmal, wenn er das "Hallo." hörte, also bei jedem Anschalten des Rechners, zurückgrüßen.
Eines Tages verweilte ich bei G, fuhr den Rechner hoch.
Ich lächelte, als ich mich selbst erkannte: "Hallo."
Doch aus der Küche, zwei Zimmer weiter, vernahm ich G, rufend: "Hi!"
Ich war verblüfft.
-----
morast - 14. Apr, 16:07 - Rubrik:
G
Es bedarf keiner tieferen Gedanken, keiner eingehender Überlegungen, um immer wieder zum gleichen Ergebnis zu kommen, um das zu entdecken, was ich schon tausendfach entdeckte, ohne daraus Nutzen beziehen, ohne das Unabwendbare abwenden zu können. Schließe ich die Augen, träume ich. Öffne ich die Augen, träume ich. Mein Dasein perlt vor sich hin, eine endlose Verkettung von Wünschen und Gedanken, immer wieder der Realität entfliehend, dem Wirklichen entkommend, zurückkehrend, um neue Eindrücke zu sammeln, neue Phantastereien zu erdenken, neue Träume zu malen. Atme ich, träume ich. In jedem Flüstern, in jedem Lächeln, in jeder Berührung sehe ich Leben, sehe ich Dinge, deren einzige Bestimmung es sein könnte, mein Wünschen zu heilen, zu verwirklichen, mir nahezubringen, einen Augenblick aus Ewigkeit zu schenken. Ich singe: Halt mich, schreie: Sieh mich, hoffe: Küss mich, träume: Lieb mich, schreite voran und falle in meine altbekannte Unwirklichkeit zurück. Gleiche Gesichter, andere Gesichter, andere Namen, gleiche Namen. Bedenke ich mich selbst, sehe ich nur Angst - und Hoffnung. Die Hoffnung, daß die Hoffnung niemals vergehe. DIe Hoffnung, daß es bald - endlich - keiner Hoffnung mehr bedarf. Die Angst vor einem Ende der Hoffnung. Die Angst vor einer Ewigkeit des sehnsüchtige, ergebnislosen Hoffens. Ich lächle in die Ungewißheit hinein, und meine Gedanken sehen in wirren Formen bezaubernde Muster, verführende Zusammenhänge, nicht wirklich, nicht wahr, aber vielleicht doch, vielleicht ja doch, bauen ein glitzerndes Schloß aus Licht, Hoffnung. Ich sehe mich träumen, sehe mein Lächeln und weiß, daß es vergebens sein wird, weiß, daß in wenigen Augenblicken Welten kollabieren werden, daß ich erneut auf staubigem Grund stehend versuchen werde, den Blick zum Himmel zu richten, die alte Sonne, die alte Hoffnung, die neuen Sterne, die neuen Hoffnungen, wiederzufinden, neuzuentdecken. Ich kann mich nicht halten, will mich nicht halten; schon schwebe ich nach oben, durch Wolken, durch Wirklichkeiten, denke nicht länger, was möglich, was wahr, rette mich in eine Flucht hin zum Traum. Für einen Augenblick bin ich frei. Der erneute Sturz ist unausweichlich, das Zerbrechen, das Auferstehen. Ich sehe mich, sehe, wie ich mich betrachte, wie ich einst mich selbst beobachtete, steigend, fallend, wissend, daß all dies schon tausendfach geschah - und immer wieder geschehen wird. Atme ich, träume ich. Ich schenke der Zukunft ein Lächeln, ein Lächeln aus Liebe, vermisse ihre Schönheit schon jetzt.
-----
morast - 12. Apr, 22:50 - Rubrik:
Geistgedanken
Nachdem ich mich 1999 erstmalig als Betreuer in einem wahrlich unspektakulären Kinderferienlager unweit Dessau betätigt und erstaunliche brave und freundliche Jungs im Alter von 8 bis 14 Jahren beaufsichtigt und unterhalten hatte, hielt ich mich 2003 für bereit, zusammen mit meinem Freund M eine Spanienreise anzutreten: als Betreuer und Entertainer von insgesamt 15 Jugendlichen.
Das vorbereitende und einweisende Treffen hielt nur wenig Nützliches bereit; wir ahnten kaum, was auf uns zukam: Zehn Mädchen und fünf Jungen, allesamt im wenig kontrollierbaren Alter von 15 oder 16 Jahren, die mit der, vom Reiseveranstalter bewußt angedeuteten Absicht nach Spanien gefahren waren, sich täglich besinnungslos zu trinken und zwischendurch in sämtlichen verfügbaren Diskotheken bis in die Morgenstunden rumzuzappeln und zu treibenden Beats und poppigem Liedgut abzuhängen.
Ständig mußten wir verbieten, erlauben, Diskoeintritte erwirken, kreativ die Abende und Nachmittage füllen, die Kinder beschäftigen, auf ihr Geld achten, trösten, heilen, retten, helfen, unterhalten usw.
Am Ende der zehn Tage, denn viel mehr waren es wirklich nicht, obgleich wir anderes hätten beschwören können, initiierten wir ein Neptunfest. Ich hatte in meinem Ferienlagerleben genug Erfahrungen gesammelt, um kluge und weniger kluge Ratschläge geben zu können, und auch M wußte Bescheid, was zu tun war.
Wir wählten drei Kinder aus, die getauft werden sollten, zwei Mädels und einen Jungen, ein mathematisch exakt ausgewogenes Verhältnis. Mit der mir eigenen Liebe zu detaillierter Feinarbeit erstellte ich Taufurkunden, die ich niemals hätte weggeben sollen - so toll fand ich sie. Wir erfanden amüsante Taufnamen, zwei böse, einen netteren, erdachten uns den Ablaufplan.
Es fehlte an allem. Wir hatten kein Geld, kein Boot, keine Leute. Zuerst rekrutierten wir also den stärksten und größten der Jungs als zweiten Häscher. Auf Nixen wurde verzichtet, M sollte der erste Häscher sein. Und ich - ich war Neptun.
Als das feststand, war das Grinsen auf meinem Gesicht nicht mehr zu entfernen.
Das Grinsen wuchs, als wir die Zutaten für den Ekeltrank einkauften. Kakao, Brause und Wasser für die Flüssigkeit, Mehl für das ekelhafte Aussehen, Ketchup, Zahnpasta und Marmelade für den perversen Geschmack, ... M hatte extra einen riesigen Metalleimer und eine nicht minder riesige, eindrucksvolle Metallkelle besorgt, die uns gute Dienste leisten sollten.
Die Brühe stank erbärmlich. Wir hatten sie nach der Zubereitung im Bad aufzubewahren. Ich wagte es, sie zu kosten: Erträglich - aber nur anfangs. Der Nachgeschmack war nahezu tödlich.
Ich hatte mir eine Art Fischernetz geknüpft, das ich mir um die Hüften band. In ihm zappelten ein Fisch und eine Krake - aus Pappe natürlich. Mein grünes Badehandtuch sollte als Umhang dienen. Wir fanden noch Kreppapier, das uns als Stirn- und Armbänder nützte. Ich trug zusätzlich, um meiner Bösartigkeit Ausdruck zu verleihen, ein Nietenarmband und meine Sonnenbrille. Unsere Oberkörper waren nackt, doch abstruse Malereien verunstalteten, verzierten unsere Leiber. Ich wurde mit einem Dreizack bemalt, M und der andere Häscher erhielten finstere Totenkopfzeichnungen auf Bauch und Rücken. Gruselig.
In meiner rechten Hand hielt ich meinen Dreizack, aus Holz und Pappe angefertigt, mit Kreppapier bestückt. An meiner Hüfte baumelte eine kleine, ebenfalls bemalte Baumwolltasche, beinhaltete die wichtigen Urkunden - und meine Rede.
Alles war vorbereitet. Es konnte losgehen.
Zunächst begleitete M die Kinder zum Strand, brachte sie dorthin, befahl ihnen, sich nicht von der Stelle zu rühren, nicht baden zu gehen, nicht zu entweichen. Sie plazierten sich nahe dem Wasser, inmitten von Holländern. Underdessen verzierte ich den zweiten Häscher und verwandelte mich zum Neptun. M kam zurück, wurde bemalt, bekleidet. Nun sollte es sein.
Wir hatten kein Boot, konnten nicht vom Meer aus an den Strand gelangen, hatten also beschlossen, ein Stück an der Strandpromenade entlangzuwandern, dann zum Strand herüberzuschwenken und das Stück Weg zurückzugehen, direkt am Wasser, wo wir dann auf unsere Kinder stoßen würden.
Es war ein Bild für die (Meeres)Götter. Ich lief voraus, barfuß, mit stolz geschwellter, grünbemalter Hühnerbrust, mit grünem Gesicht, Dreizack und flatternden Haaren. Hinter mir gingen die beiden Häscher, nicht minder schrecklich anzusehen, mühsam den Brühe-Eimer tragend.
Ich grinste, grinste wie noch nie: Ich war Neptun, ich war der Gott des Wassers, der Meere, war der Herr. Die Passanten schauten verdutzt, belustigt, verständnislos. Doch niemand hielt uns auf.
Der Weg am Strand war mühsam und beschwerlich. Der Sand hinderte uns am Gehen. Ständig liefen Kinder und Badende in den Weg, blickten uns an, als hätten sie Geister gesehen. Ich sah nicht herab, meine Nase zeigte zum Himmel. Ich war Neptun.
Unsere Kinder entdeckten uns bald, erkannten uns nicht, erkannten uns doch, jubelten, wunderten sich. Westdeutschen Jugendlichen scheint Neptunfest kein Begriff zu sein.
Ich bezog Position. Das Gelände war leicht abschüssig, unter mir lagen und saßen die verdutzten Opfer, gespannt, unsicher. M und der andere Häscher setzten den Eimer ab, verschränkten die Arme, versuchten, bedrohlich zu wirken.
Ich spreizte die Beine, stand sicher, in machtvoller Pose, den Dreizack haltend, setzte an zu meiner Rede. Meine Stimme schallte über den Strand, war voller Wut, voller Herrlichkeit. Ich war Neptun, Gott, Herrscher, König, Erhabener, Richter, hatte den langen Weg vom Grund der Meere, aus den versunkenen Trümmern von Atlantis, gemacht, um Rache zu üben, um Recht zu sprechen, um Unheil auszumerzen, um zu bestrafen. Alle anderen waren Opfer, Sündige, Schuldige, waren niederes Gewürm, nichtig und klein, sollten vernichtet werden, zertreten.
Ich verkündete, was geschehen sollte: Stellvertretend für alle sollten einige besonders garstige Bösewicht die Strafe erhalten, die ich ihnen zugedacht hatte. Hinterhältig grinsend rührte M in der Ekelbrühe herum, ließ sie plätschernd von der Kelle in den Eimer träufeln.
Als ich den ersten Namen verlas, geschah nichts. Das Mädchen wußte nicht, daß es besser war für sie, zu rennen, zu fliehen, hinfortzueilen, wußte nicht, was ihr bevorstand. Die Häscher hatten keine Mühen, fingen sie, hielten sie fest, legten sie auf den Sand.
Ekelbrühe füllte eine Kelle, fand ihr Gesicht, ihre Lippen. Sie wehrte sich, doch vergebens. Der zweite Häscher hielt sie, M schüttete, immer wieder. Irgendwann erreichte die Ekelbrühe ihren Mund, ihre Zunge. Angewidert verzog sie das Gesicht, spuckte aus, schluckte noch mehr.
Ich zückte die Taufurkunde, verlas ihren Taufnamen, wies die Häscher an, sie ins Meer zu stürzen, auf daß sie sich dort ihrer Sünden bereinigte. Die Häscher legten sie vorsichtig ins Wasser, vermieden jede Verletzungsgefahr. Wütend, angeekelt verzog sie das Gesicht, nahm ihre Urkunde in Empfang, war sprachlos. Doch es mußte weitergehen.
Ein weiterer Name sollte verlesen werden. Die Jugendlichen starrten mich an, gespannt, ängstlich vielleicht. Ich konnte das Grinsen nicht unterdrücken. Der Nächste war der Junge, ein dicklicher, überheblicher Fratz, eigentlich sympathisch, aber stetig den Mittelpunkt suchend, ein stachliger Kugelfisch. Er hatte begriffen, was ihn erwartete, hatte begriffen, daß eine Flucht sinnvoll wäre - und sobald ich seinen Namen aufgerufen hatte, rannte er, rannte er zum Wasser, am Meer entlang.
Er kam nicht weit. Sein Kumpel, Häscher 2, war schneller, fing ihn, ergriff ihn, hielt ihn. M trat hinzu, und der Kugelfisch wurde zu seiner Taufe getragen. Das gleiche, schreckliche Spiel.
Das letzte Mädchen rannte auch, doch nur kurz, war nicht schnell genug, nicht wirklich willens zu fliehen, wußte bereits um die Vergeblichkeit ihre Bemühungen. Die Häscher hatten sie bald. Wir tauften auch sie.
Dann war es vorbei. Der vorletzte Tag ging zur Neige. M, der Häscher und ich, entledigten uns unserer Kostüme, gingen baden, versuchten vergeblich, die Farbe zu entfernen. Ich war erleichtert. Beglückt. Nicht alles war perfekt, doch es hätte tausendfach schlimmer werden können.
Die Jugendliche gesellten sich zu uns, stellten neugierige Fragen. Was war in der Brühe [wir verrieten nichts - außer "Rattenkadaver und Plumskloablagerungen"]? Warum war Häscher 2 gewählt worden? Warum war der-und-der nicht getauft worden? etc.
Die Stimmung schwenkte um - in unsere Richtung. Plötzlich waren wir nicht mehr die Bösewichte, sondern Helden, hatten ein Erlebnis verschafft, das einmalig war. Die Taufurkunden wurden gewürdigt; und schließlich wollte jeder getauft werden - ohne Ekelbrühe natürlich.
M und ich grinsten uns an.
Neptun und seine Mannen hatten Geschichte geschrieben.
-----
morast - 12. Apr, 19:01 - Rubrik:
Wortwelten
was, wenn ich nicht träumte
dich nicht sähe
schmerzend spürte
als wär ein teil von mir
verloren
was, wenn ich nicht träumte
mit blassem wort
dein antlitz malte
in meinem kopf
in deinem licht
nicht hoffte
nicht begehrte
was, wenn ich nicht träumte
dein leben
licht
verlör
nicht wüßte
deine träume
nicht sehnte
spürte
dich
was, wenn ich nicht träumte
wenn fern des lebens
leben wär
ein leuchten
dort
auf anderer seite
unerreicht
doch
ungesucht
was, wenn ich nicht träumte
mein lächeln nicht
in dir
verlör
wenn strahlend mir der himmel bliebe
die sonne jedoch
stets
verwehrt
www.bluthand.de
-----
morast - 12. Apr, 10:05 - Rubrik:
Seelensplitter
Mit dem Fahrrad hektisch, eilig, angetrieben von der Wut auf die eigene Unfähigkeit, auf die Unfähigkeit aller, durch die Stadt rasend, düsend, rücksichtslos, riskant, mir alles abverlangend, kraftvoll in die Pedalen tretend, nicht sitzend, immer stehend, tretend, trampelnd, schneller, schneller. Menschen zischen vorbei, ihre Gesichter unförmige Schemen. Kein Ausdruck, keine Mienen. Knappe Gesten, ungesehen, unbemerkt. Ich höre empörte Worte, irgendwo hinter mir, weit hinter mir. Schneller, schneller, keinen Atem findend, keuchend, Ampeln ignorierend, durch Menschenmassen schlängelnd, im letzten Moment ausweichend, vorbeizischend, haltlos, entfesselt, jagend, ein Sturm auf Metall.
Irgendwo am Straßenrand stehen Polizisten, sehen mich zu spät, rufen mich zu spät, ich bin vorbei, längst vorbei, enteilt, dem Gesetz entflohen, meinem Stillstand entflohen, meiner Ruhe. Haltet mich nicht, fangt mich nicht, ich bin der Orkan...
-----
morast - 11. Apr, 19:00 - Rubrik:
Wortwelten
Phobophobie - die Angst vor der Angst.
-----
morast - 11. Apr, 19:00 - Rubrik:
Wortwelten
Aus der Drogerie tritt ein Mann, achtet nicht auf den Weg, nicht auf die Umgebung. Seine ganze Konzentration gilt dem Päckchen, das er in der Hand trägt, das er nun sorgsam öffnet: Entwickelte Fotos. Vorsichtig holt er die Bilder aus ihrer Verpackung, betrachtet sie, nimmt sich Zeit für jedes einzelne, beschaut die Motive, beschaut scheinbar jedes Detail. Dann fängt er an zu schmunzeln, zu grinsen. Zu lachen.
Ich gehe vorbei, er sieht auf und lacht mir ins Gesicht, ausgelassen, fröhlich.
Ich lache auch, innerlich, wünsche mir einen Photoapparat, um diesen Augenblick festzuhalten und immer wieder neu in stilles Gelächter ausbrechen zu können.
Abgehetzt und grimmig betrete ich die Apotheke. Es ist kurz vor acht am Samstag Abend, kurz vor Ladenschluß. Bevor ich den Atem für Worte finde, lächelt mich die Apothekerin freundlich an:
"Wollen Sie ein Glas Wasser?"
Ich schaue erstaunt, vergesse meinen Unmut, schüttle zögernd mit dem Kopf:
"Bin ... nur ... recht schnell ... gefahren ... Danke ...", keuche ich.
"Sie hätten sich doch Zeit lassen können. Wir haben doch noch zehn Minuten auf."
Ihr Lächeln steckt an.
"Ich wußte ja nicht ... wollte noch ... brauchte noch was Eßbares ... für morgen."
Sie läßt nicht locker.
"Ich kann Ihnen ein paar Bonbons anbieten."
Dankend lehne ich ab, grinse von einem Ohr zu anderen.
'Warum', frage ich mich, als ich die Apotheke wieder verlasse, 'sind Menschen viel freundlicher, wenn ich schlechte Laune habe...?'
-----
morast - 11. Apr, 15:45 - Rubrik:
Menschen
Das Wort des heutigen Tages [egal, ob damit der vergangene oder der kommende gemeint ist] sei:
Honigkuchenpferd.
Ich denke, es gibt kaum ein niedlicheres Wort, so süß und knuffig. Gern grinse ich wie ein solches oder betitle es mit dem unpassenden, aber amüsanten Attribut "kariert"...
-----
morast - 11. Apr, 10:53 - Rubrik:
Tageswort
1996 war ich in Spanien, wieder in einem Kinder- und Jugendferienlager.
Ich war mit meinem besten Freund gereist, mit meinem Bruder und dessen bestem Freund. Das Zeltlager war toll, die Betreuer "cool", das Essen schmeckte, die Sonne schien. Das Zeltlager hatte uns große Freiheiten erlaubt; täglich konnte man sich entscheiden, ob man sich den Unternehmungen diverser Betreuer anschloß, ob man bei den Zelten blieb, an den Pool oder ans Meer ging. Ich war glücklich.
Am vorletzten Tag stand das unvermeidliche Neptunfest an. Ich hatte nichts zu befürchten, war ich doch weder besonders auffällig, noch besonders unauffällig gewesen. Ich setzte mich an den Strand, ohne mich zu entkleiden, harrte fröhlich der Dinge, die da kommen mochten.
Vom Meer her kam ein Schlauchboot mit Außenborder. Ich kannte das Boot; wir hatten selbst diverse Fahrten darauf unternommen. Ich kannte auch Neptun, die Nixen und die Häscher. Letztere waren diesmals allerdings keine Betreuer, sondern kräftige Jugendliche, die Ältesten von uns.
Alles lief ab wie gewohnt. Die Opfer waren schnell, doch die Häscher waren schneller. Jedesmal. Nur einer floh ins Meer, doch hatte keine Chance. Wohin wollte er auch schwimmen? Afrika?
Ein Nescafé-Wagen kam vorbei, verteilte Probedosen. Der Eiskaffee schmeckte mir nicht, doch war kostenlos - und kühl.
Dann hörte ich meinen Namen. Ich konnte es nicht glauben. Die konnten nicht mich meinen, meinten jemanden anderes mit ähnlichem Namen, hatten mich sicherlich verwechselt! Doch die Häscher rannten auf mich zu, ohne Rücksicht auf die Sitzenden, ohne Rücksicht auf Handtücher und Rucksäcke.
Ich sprang auf, rannte los, vom Meer weg, durch den Sand. Schnell, schneller. Noch immer trug ich meine Schuhe. Das war mein Vorteil. Bald war ich auf einem betonierten weg. Ich lief nach Norden parallel zu Meer. Immer weiter. Ich lief so schnell ich konnte. Die Häscher blieben zurück. Ihre nackten Füße klatschen auf den heißen Asphalt. Ich hatte Schuhe, ich rannte, gab alles. Kühler Wind wehte mir entgegen, Passanten schauten mich vberwundert an. Ich rannte.
Irgendwann hatte ich die Häscher abgehängt. Sie waren zurückgefallen, würden mich nicht mehr einholen. Ich triumphierte innerlich.
Doch was nun? Ich konnte zum Zeltlager zurückkehren, doch meine Sachen lagen noch am Strand. Ich konnte einfach im Zeltlager warten, bis alles vorbei war. Ich konnte in die Stadt fliehen. Ich hatte kein Geld, doch das machte nichts, würde mich nicht verlaufen. Die Häscher würden mich nie finden, nie fangen. Niemals.
Doch all das hielt ich für feige, für sinnlos. Ich hatte gewonnen. Das wußte ich. Das mußten auch die Häscher wissen. Ich hatte gewonnen, war entkommen, sah keinen Sinn mehr darin weiterzufliehen. Ich konnte mich nicht ewig verstecken, nicht ewig wegrennen.
Ich kehrte um. Langsam, die nackten Handflächen zeigend, ging ich auf die Häscher zu. Ich lächelte, hatte gewonnen. Nichts konnte mir noch schaden.
Als die Häscher sahen, daß ich mich ergab, sprinteten sie zu mir, faßen mich grob an Beinen und Armen, schleiften mich durch den Sand. Ich wehrte mich nicht. Mein Lächeln blieb. Sie packten mich härter, zerrten mich den langen Weg zurück. Ich wäre auch allein gelaufen, doch sie wollten nicht, glaubten mir nicht, befürchteten wohl, ich könnte wieder fliehen.
Ich wäre nicht geflohen. Wozu? Wohin? Ich hatte längst gesiegt.
Die Häscher brachten mich zu Neptun. Die Antrengung war auf ihren Gesichtern zu lesen. Sie hielten mich fest, dudelten keine Bewegung. Ich bat darum, daß mir die Brille abgenommen, meine Schuhe ausgezogen würden; mein letzter Wunsch wurde mir gewährt.
Neptun tat, als wäre er wütend; die Häscher waren wütend. Meine Welt war nur noch ein verschwommener Buntbrei. Geduldig lauschte ich den Worten Neptuns, sah die Kelle mit der Brühe auf mich zukommen, preßte die Lippen zusammen. Ich würde das Ekelzeug nicht trinken. Eine Hand umfaßte meinen Unterkiefer, Finger bohrten sich in meine Wangen. Der Schmerz riß mir den Mund auf; die ekelhafte Flüssigkeit schwappte hinein. Immer wieder. Ich konnte nicht mehr atmen, hustete, spuckte, versuchte, Luft zu holen, fiel auf die Knie, keuchte. Ein Hand klopfte mir auf den Rücken. Dann wurde ich gepackt und ins Meer geworfen.
Dort blieb ich, holte Luft, wusch mir das Gesicht, die Arme, spülte den unappetitlichen Geschmack in meiner Mundhöhle mit Salzwasser aus. Als ich das Wasser verlies, wurde mir eine Urkunde in die Hand gedrückt:
"Dr.h.c. Fisch"
Ich grinste. Ich war als einziger entkommen, war freiwillig zurückkehrt und bekam nun nichts Schlimmeres als einen fischigen Doktortitel, ehrenhalber?
Meine Augen brannten vom Salzwaser. Auf meiner Zunge schmeckte ich noch immer die ekelhafte Brühe. Ich zitterte vor Kälte; das nasse T-Shirt klebte an meinem Leib. Die Welt war noch immer verschwommen; und ich rang um Atem.
Doch ich grinste:
Ich hatte gesiegt.
-----
morast - 10. Apr, 18:59 - Rubrik:
Wortwelten
Ein für mich bedeutsamer Bestandteil meines ersten Ferienlagers war das Neptunfest.
Diese Festivität war typisch für ostdeutsche Ferienlager: Am vorletzten Tag versammelten sich dabei alle Ferienlagerkinder am nahegelegenen Strand, vorsorglich mit Badesachen bekleidet. Sinnlos standen wir in der Gegend herum und harrten der Dinge, die kommen würden. Ich wußte nicht, was mich, was uns erwartete und war gespannt.
Dann vernahmen wir Motorenlärm, entdeckten auf dem See ein reichlich mit Keppapier bestücktes Boot, das langsam auf uns zukam. In ihm saßen Neptun, Nixen und Häscher - allesamt eigentlich Ferienlagerbetreuer, die mit Farbe, Kreppapier und allerhand Krimskram ausstaffiert worden waren. Sie boten einen durchaus beeindruckenden, ja beängstigenden Anblick. Die Häscher schleppten einen riesigen Kessel, in dem eine undefinierte Flüssigkeit hin- und herschwappte.
Das Meeresvolk plazierte sich am Strand. Neptun verlas mit lauter Stimme eine Rede, an deren Inhalt ich mich nicht mehr entsinne. Ich denke, es ging um unsere "Sünden", die bestraft werden müßten.
Dann wurde der erste Name verkündet. Inmitten der Kinder entdeckte ich ein erschrecktes Gesicht, das sofort verschwunden war. Der Junge floh, rannte wie der Wind.
Es gab nicht viele Möglichkeiten zu fliehen. Entweder man rannte links um den See, rechts um den See, zurück ins Bungalowlager oder man wagte es, sich in den See zu stürzen und schwimmend die Flucht zu ergreifen. Der Junge rannte nach rechts.
Die Häscher, allesamt groß, kräftig und wesentlich älter als wir, warteten gedudlig einen Augenblick, gaben dem Jungen Vorsprung. Dann spurteten sie los. Sie brauchten sich nicht anzustrengen. Der Junge hatte keine Chance zu entkommen. Im Nu hatten sie ihn erhascht, trugen ihn zurück zu Neptun.
Dieser beschuldigte den verängstigt blickenden Jungen diverser Tätigkeiten und Untätigkeiten und gab den Befehl zur Taufe. Ich weiß nicht genau, was in der ekelhaft aussehenden Flüssigkeit enthalten war, aber glaube, daß der übliche Tee und Zahnpasta entscheidende Anteile bildete. Mit einer großen Kelle wurde dem Jungen das Zeug ins Gesicht, in den Mund geschüttet. Er schluckte angewidert, während sein neuer Name verlesen wurde. Dann trugen die Häscher den besudelten Jungen zum See, warfen ihn hinein, damit er sich bereinigen konnte und die Taufe rechtskräftig wurde.
Zurückgekehrt nahm er eine Taufurkunde in Empfang - und hatte es überstanden.
Wir anderen jedoch warteten, aufgeregt und ängstlich. Wer würde der nächste sein?
Nacheinander wurden zwei weitere Namen verlesen, zwei weitere Kindern rannten weg, wurden gefangen, bekamen Brühe ins Gesicht, wurden ins Wasser geworfen, erhielten die Taufurkunde mt ihrem Namen. Ich war erstaunt, mit welcher Mühelosigkeit die Häscher die Kinder fingen, stellte fest, wie sinnlos jeder Fluchtversuch war.
Dann hörte ich meinen Namen. Ich begriff nicht, konnte es nicht glauben, war doch das erste Mal in einem Ferienlager. Mein Gedanke war: Renn weg! Renn weit weg! Doch ich wollte nicht rennen, wußte mittlerweile um die Vergeblichkeit solcher Bemühungen. Die Häscher jedoch rannten los, glaubten mich gesehen zu haben, rannten in verschiedenen Richtung um den See herum, unglaublich schnell und kräftig.
Ich stand in der Masse, unter all den anderen Kindern, und wartete. Sie würden mich fangen, das wußte ich, doch ich selbst entschied, wann. Nach einer Weile trat ich in die Mitte des Kreises, trat ich zu Neptun. Erstaunt blickte er mich an, erkannte mich, rief seine Häscher zurück.
Sie packten mich, grob, wohl verärgert, weil sie sinnloserweise losgerannt waren, weil sie mich nicht erhascht hatten, weil sie noch nie so lange gebraucht hatten, um jemanden zu fangen. Während Neptun seine Worte sprach schütteten sie mir die Ekelbrühe ins Gesicht. Eine Kelle, zwei Kellen. Doch mein Grinsen verschwand nicht. Irgendwie hatte ich gewonnen.
Als ich aus dem See wieder herauskam, las ich meinen Taufnamen:
"Schleichender Wasserfloh" - weil ich ständig zu spät kam.
Bis heute frage ich mich, ob die Neptunfigur nicht vielleicht doch ein bißchen Göttlichkeit in sich gehabt hatte, ob sie wußte, daß der Taufname bestimmend für mein späteres Leben sein würde, ob ich schon damals Züge meines heutigen Ichs zeigte.
Denn noch immer komme ich zu spät. Ständig.
Wie ein schleichender Wasserfloh.
-----
morast - 10. Apr, 18:58 - Rubrik:
Wortwelten
Ich war gerade 8 oder 9 Jahre alt, als mich meine Eltern in mein erstes Ferienlager schickten. Das war nichts Ungewöhnliches, denn die schulischen Sommerferien reichten aus, um sowohl ins Ferienlager zu fahren als auch zusammen mit meinen Eltern ihren schwer verdienten Urlaub zu genießen.
Mein Bruder, der mich in späteren Ferienlagern stets begleitete, war noch zu jung, um mitzukommen. Mein erstes Ferienlager. Unzählige unbekannte Menschen. Und ich war allein.
Ich kann mich an einen schlichten, dunkelbraun gestrichenen Holzbungalow erinnern, den ich mit sechs oder acht anderen Jungs teilte. Die für uns zuständige Betreuerin schlief mit uns in einem Raum. Immer blieben ein paar von uns auf, um zu warten, bis sie sich auszog und ins Bett legte. Man sah nichts; es war zappenduster, aber allein die Vorstellung einer unbekleideten Frau schien einige meiner Kumpanen irre zu machen.
Einen wesentlichen Bestandteil dieses Ferienlagers bilden in meiner Erinnerung Pfirsiche. Jeden Tag gab es Pfirsiche, zum Mittagessen, zum Abendbrot, riesige, saftige Dinger, von denen ich gar nicht genug bekommen konnte. Ich nahm die Früchte der anderen entgegen, als diese sie nicht mehr sehen konnten, bunkerte sie unter meinem Bett. Ich werde niemals den Geruch am letzten Tag vergessen, als wir gezwungen waren, den Bungalow zu bereinigen, als ich gewzungen war, den süßlich stinkenden, schimmelnden Matschhaufen aus dem Dunkel hervorzuholen und zu beseitigen.
Vielleicht trug das dazu bei, daß wir in einer abschließenden Preisverleihung für den saubersten Bungalow den allerletzten Platz belegten. Der erste Platz erhielt eine schlichte Urkunde, wir jedoch jeder einen großen Scheuerlappen. Ich war stolz, stolz auf mich, stolz auf uns.
Zu Hause packte ich den Scheuerlappen aus und zeigte ihn meiner Mami:
"Die anderen Bungalows haben nichts bekommen. Aber ich gewann das.
Für dich."
-----
morast - 10. Apr, 18:57 - Rubrik:
Wortwelten
Ich liebe es aufzuwachen und nicht zu wissen, wie spät es ist.
Zwar verfüge ich über eine durchaus ästhetische Armbanduhr, doch deren Batterie hat schon vor einem Jahr beschlossen, in Ruhestand zu gehen. Das hat natürlich den Vorteil, daß die Uhr täglich zwei Mal die korrekte Zeit darstellt, wenn auch nur für einen Augenblick. Normal funktionstüchtige Uhren dagegen haben die schlechte Angewohnheit, niemals richtig zu gehen, da sie der "echten" Zeit immer ein paar Minuten voraus sind oder nachhängen. In diesem Fall kann also der Stillstand gelobt und gepriesen werden.
Habe es ich also am Vorabend versäumt, dem in meinem Handy integrierten Wecker mitzuteilen, wann ich mit nervigen Piep- und Klingeltönen dem Schlaf entrissen werden sollte, erwache ich planlos, ohne ein Wissen um die Tageszeit.
Und erstaunlicherweise, obwohl man meinen könnte, dadurch eine Art Verlorensein in zeitlicher Unkenntnis empfinden zu müssen, ist das ein schönes Gefühl.
Es könnte jetzt um acht sein - oder schon um eins. Es ist egal.
Noch einmal schließe ich die Augen, kuschle mich in meine Bettdecke und lausche dem Wurm in meinem Ohr: Tool ist es heute, doch ich erkenne das Lied nicht. "The Grudge" vielleicht. Es ist egal.
Ein paar Minuten später erhebe ich mich, langsam, allmählich, suche das Bad - finde den Tag...
-----
morast - 10. Apr, 16:38 - Rubrik:
Morgenwurm
1997 war ich in Italien, in einem Ferienlager.
Es war ein schrecklicher Urlaub. Der Reiseveranstalter, Rainbow-Tours, war äußerst unsympathisch, die Betreuer ["Animateure"] faul, desinteressiert und versoffen, das Hotel mies, das Essen schlecht. Die Italiener belaberten alles, was einigermaßen weiblich aussah. Die Mädels, die mit uns mitgereist waren, interessierten sich nur für die überteuerten Diskotheken. Der Strand war langweilig, die Stadt nur für Touristen errichtet.
Ich war neugierig, wollte etwas sehen, hatte wenig Begeisterung übrig für lautstärkeintensive Massentanzveranstaltungen, tendierte schon damals in eher gitarrenorientierte Musikrichtungen, streifte in abendlichen Stunden durch das städtische Kunterbunt, ließ mich von dem Menschengewühl, von Che Guevara Postkarten und Grasverkäufern beeindrucken.
Der erste unserer Ausflüge ging nach San Marino. Ich kann mich an San Marino selbst kaum noch erinnern. Ziemlich burgig, viele Mauern, kleine Gassen, ständig ging es bergauf. Und überall gab es Waffenläden und solche, in denen zuhauf Raubkopien angesagter Musikstücke verkauft wurden. Ich erwarb zwei Souvenire, die sich auch heute noch in meinem Besitz befinden:
Zum einen das Nirvana-Album "Nevermind". Natürlich auf Kassette, gab es doch in San Marino nichts anderes. Außerdem bekam ich so neue Nahrung für meinen Walkman, Abwechslung von dem Italo-Diskopop-Einerlei.
Zum anderen kaufte ich in einem Waffenladen einen Ninja-Stern. Waffenläden üben auf Jugendliche einen eigenartigen Reiz aus, protzen mit Macht und Gefahr, mit silbernen Klingen und verzierten Pistolenläufen. Ich war begeistert, fasziniert, wollte mir selbst unbedingt irgend etwas kaufen. Doch mangelte es mir sowohl an äußerlich sichtbarer Reife als auch an finanziellem Potential.
Dann sah ich den Ninja-Stern. Dessen scharfe Kanten waren weitaus weniger scharf als sie sein sollten und seine asiatische Inschrift zeugte von äußerst geringer San-Marino-Verbundenheit. Aber er war billig. Umgerechnet 1,50 DM. Ich kaufte den Stern, verwahrte ihn sicher in meinem Portemonaie.
In unserem Hotelzimmer probierte ich ihn aus, Nirvana im Ohr. Er ließ sich gut werfen, flog weit, doch blieb nirgendwo stecken. Nicht scharf genug, mutmaßte ich. Ich überlegte, ob ich ihn auf eine Kette fädeln und umhängen sollte - ein entsprechendes Loch war vorhanden. Doch der Ninjastern war zu groß, zu protzig, zu albern. Ich ließ es sein, verstaute ihn wieder und freute mich, ein derart praktisches Souvenir erworben zu haben.
Der zweite Ausflug brachte uns nach Venedig. Zu keinem Zeitpunkt meines Lebens habe ich jemals Venedig mit "Romantik" in Verbindung gebracht. Ich war nicht sonderlich interessiert. Für mich war Venedig nur eine ausländische Stadt, die viel Unbekanntes beinhaltete, das auf seine Art und Weise schön war.
Auf der Rialtobrücke wurde vor Taschendieben gewarnt; ich schoß ein Photo von unseren Mädels, beobachtete begeistert ein Krankenboot, das mit jaulender Sirene durch die Kanäle düste. Ich interessierte mich nicht für die albernen Masken, nicht für die dargebotenen Kleidungsstücke und Schuhe. Die Bauwerke waren beeindruckend, oder hätten es sein können - ohne all den Dreck und den Taubenkot.
Auf dem Markusplatz fand unser Stadtbummel ein Ende. Mein Kumpel und ich streiften zwischen den Säulen hin und her; ich trat nach den Tauben, die trotz ihrer Behäbigkeit noch schnell genug waren, um ein paar Meter von mir wegzuflattern und sich in Sicherheit zu bringen.
Wir suchten Chinesen oder Japaner. Ich wollte unbedingt wissen, was auf meinem Ninjastern stand. Die Anzahl an Asiaten war für eine Touristenmetropole erstaunlich gering. Wir brauchten eine Weile, bis wir einen entdeckten. Freundlich sprach ich ihn an:
"Sorry. Do you know what that means?"
Ich zeigte ihm den Metallstern.
Er lächelte, besah sich die Inschrift, überlegte, schaute erneut.
"These are very old characters.", meinte er, doch hatte keine Ahnung, was sie bedeuteten, konnte mir nicht weiterhelfen.
Ich war betrübt, doch nicht sehr. Denn eigentlich war egal, was auf dem Stern stand; bis heute weiß ich nicht, ob es sich nun um Japanisch oder Chinesisch oder gar um eine völlig andere Sprache handelt.
Erschöpft ließen wir uns auf den Stufen am Markusplatz nieder, so wie alle Touristen. Wir fanden ein nettes Plätzchen, hatten eine schöne Sicht auf den Dogenpalast, vor dem Touristen in langer Schlange anstanden. Überall waren Tauben, in der Luft, vor uns, hinter uns.
Direkt neben mir saß eine Italienerin. Sie trug ein ärmelloses, beigefarbenes Oberteil und filmte mit einer Kamera die Sehenswürdigkeiten, die Tauben und ihre Familie. Sie redete. Unablässig quoll ein kommentierender Wortschwall aus ihrem Mund, ununterbrochen formte sie für mich unverständliche Laute.
Mit einem Klatsch landete ein riesiger Haufen Taubenkot auf ihrer linken, nackten Schulter. Angewidert, erschrocken, entsetzt sprang ich auf, untersuchte angegekelt mein T-Shirt, meine kurzen Hosen, ob ich nicht eventuell ein paar Spritzer abbekommen hatte, fand nichts, war erleichtert. Die Italienerin filmte weiter, redete weiter, hielt nicht inne, hatte nichts mitbekommen, nichts bemerkt. Auf ihrer Schulter klebte ein grau-weißer Fleck stinkender Taubenfäkalien, doch sie wußte es nicht.
"Was für ein Urlaub.", dachte ich, "Alles Scheiße, doch keiner merkt's."
-----
morast - 9. Apr, 18:56 - Rubrik:
Wortwelten
Was genau ist eigentlich ein Buch? Es gibt eine Definition der UNESCO: "Ein Buch ist eine nicht-periodische Veröffentlichung von mindestens 49 Seiten Umfang exklusive des Einbands." Es ist sicher nett, was sich die UNESCO so an lauen Sommerabenden zusammendefiniert, aber daß ein Buch generell etwas Bewahrenswertes ist, sagt auch diese Definition nicht. Auch eine Publikation, wo auf der ersten Seite ein Rezept für Serviettenknödel ist, auf der zweiten ein Lob der altchinesischen Frauenfußverstümmelung und auf der dritten eine Anleitung zum Tottrampeln von Zeisigen ist ein Buch, Hauptsache, es folgen noch 46 weitere Seiten. Ein solches Buch kann man m. E. kühlen Gewissens verbrennen. Doch was riefen die Menschen dann? "Wo man Bücher verbrennt, da verbrennt man am Ende auch Menschen!" würde es tönen, und daß man vor einem Buch wahnsinnigen Respekt haben muß.
Diese, von
Max Goldt in seinem Essay "Eine Wolke, auf der man keinen Husten bekommt" geschriebenen Worte kamen mir heute in Erinnerung, als ich mich in das Zimmer meiner Mitbewohnerin begab und mich in Ermangelung einer Sitzgelegenheit auf ihre Liege und somit beinahe auf ein dickes, fettes Buch plazierte, das dort herumlag. Fast schon panisch schrie sie auf, als mein Allerwertester auch nur in die Nähe des Wälzers kam, so daß mir nichts übrig blieb, als mich erneut zu erheben, das Buch beiseite zu schieben, um mich dann ruhigen Gewissen setzen zu können und die Stimmbänder meiner Mitbewohnerin zu schonen.
Verwundert blickte ich sie an:
"Es ist doch nur ein Buch..."
Demonstrativ wollte ich mich nun auf dem Buch plazieren, doch meine Mitbewoherin ahnte mein Vorhaben und öffnete schon einmal präventiv den Mund. Sie verfügt über eine recht markante und vor allem dezibelintensive Stimme, weswegen ich schnell von meinem albernen Vorhaben abkam.
"Es ist doch nur ein Buch.", wiederholte ich.
Es handelte sich um Ken Folletts "Die Säulen der Erde", sicherlich nicht schlechteste Buch aller Zeiten, doch war es auf keinen Fall unersetzbar. Für sie schon.
"Ich behandle Bücher mit Respekt."
Ich lachte innerlich. Meine Mitbewohnerin wollte mir erzählen, wie ich "Die Säulen der Erde" zu behandeln habe - dabei war es mein eigenes Buch.
"Aber es ist meins.", sagte ich, "Und es ist nur ein Buch."
"Trotzdem. Bücher verdienen Respekt.
'Warum?', wunderte ich mich und entsann mich oben erwähnter Worte von Max Goldt. Bloß weil eine Zeilensammlung mindestens als 49 Seiten [exklusive des Einbands] umfaßt, verdienen Bücher mehr Respekt als beispielsweise Hausschuhe oder Kartoffelsalatplastikverpackungen? Bloß weil es sein könnte, daß der Inhalt aus Bedeutsamem besteht [das ist in den seltensten Fällen gegeben - zumindest wenn man die Anzahl existierender Bücher mit der gehaltvoller vergleicht], darf man ein Buch nicht genauso behandeln wie den Rest seines Besitzes?
Noch einmal warf ich einen Blick auf das Buch. Es war abgenutzt und schäbig. Eine alte Taschenbuchausgabe, die ich auf irgendeinem Flohmarkt erworben hatte. Schon damals hatte sie abgenutzt und schäbig ausgesehen, was nicht zuletzt der Grund gewesen war, das Werk zu kaufen, senkte doch das ramponierte Aussehen den Preis erheblich.
Ich hatte ein abgegriffenes Buch erworben, dessen Inhalt, nicht dessen Unversehrtheit mich interessierte. Kaum war ich zu Hause angekommen, fletzte ich mich auf mein Bett und las. Ich neige nicht dazu, Bücher bei der Lektüre zu schonen. Bücher sind dazu da, gelesen zu werden, nicht um schön auszusehen.
Beispielsweise vermeide ich den Kauf von Hardcovern. Der einzige Vorteil, den ich den Werken in hartem Einband abgewinnen kann, ist nicht dessen potentielle Bücherregalästhetik, sondern die von den Verlagen preispolitisch clever erdachte Tatsache, daß neue Werke zuerst als Hardcover erscheinen, sodaß man als Taschenbuchbevorzieher gezwungen ist zu warten - oder eben doch mehr Geld auszugeben.
Meinen Büchern sieht man an, daß sie gelesen wurden. Sicherlich werde ich sie nicht bewußt als Tellerersatz für mein fettiges, tomatensoßengetränktes Abendessen in Benutzung ziehen, doch werde ich mich auch nicht bemühen, jede Seite nur mit Pinzette anzufassen, um keinerlei Abdrücke unsauberer Fingerspitzen oder gar unschöne Eselsohren zu hinterlassen.
Ich lese, wo ich bin. Im Zug, in der Bahn, im Park, in der Uni, in der Mensa, zu Hause, auf dem Klo. Überall. Dementsprechend müssen die leblosen Opfer meines Wortwahns mich überall hinbegleiten. Natürlich bleibt das nicht ohne Folgen.
Ken Folletts Roman umfaßt mehr als 1150 Seiten. Die Lektüre dieses Werkse braucht also seine Zeit. Und ich muß zugeben, von ihm gefesselt gewesen zu sein. Ich wollte ständig weiterlesen, nahm das Buch stets dorthin, wo ich mich aufzuhalten gedachte, ohne mich darum zu kümmern, ob der Einband Kratzer oder Knicke erhielt oder den Seiten minimaler Schaden zugefügt wurde. Ich weiß nicht, wie oft ich das Buch in meinem unsortierten, mit allerhand Kram bestückten Ruckstack verstaute, es wieder herausholte, fallenließ, aufhob, weiterlas, knickte, mit Lesezeichenzettelchen bestückte, irgendwo vergaß und doch wiederfand.
Es war egal, nur ein Buch. Der Inhalt wußte mich zu begeistern, doch um das Äußere sorgte ich mich nicht.
Und nun schrie meine liebe Mitbewohnerin schon bei der Vorstellung auf, ich könnte mich versehentlich auf diesem Buch, das von mir bisher mit wenig Rücksicht bedacht worden war, plazieren, ich könnte ihm irgendwie Schaden zufügen, den nötigen Respekt verwehren.
Gerade wollte ich mich rechtfertigen, wollte Max Goldt zitieren, wollte von den schrecklichen Dingen berichten, die dieses Werk schon mit mir zu erdulden hatte, als ich mich eines Besseren besann, mich in mein Zimmer verzog und las:
Salman Rushdie. "Der Boden unter ihren Füßen". Preisreduziertes Mängelexemplar. 860 Seiten. Zwei Eselsohren und ein großer Kratzer auf dem Einband.
Trotzdem genial.
-----
morast - 8. Apr, 18:54 - Rubrik:
Wortwelten
Ich sitze allein an einem Tisch für acht Personen. Eine junge Frau gesellt sich hinzu. Ich bin in meine Nahrungsaufnahme vertieft, hebe kaum den Kopf. Zu der jungen Frau gehören aber scheinbar noch mehr, lauter Universitätsmitarbeiter. Ich schränkte meinen Platzverbrauch ein. Der Tisch wird voll besetzt. Obwohl ich allein sein wollte, ist mir die plötzliche Anwesenheit der anderen nicht unangenehm.
Mit gegenüber sitzt eine Asiatin, eine Chinesin, wie sich herausstellt. Sie redet Englisch mit ihren Kollegen. Dann schaut sie mich an, betrachtet mein Shirt. In Ermangelung sauberer schwarzer Shirts hatte ich mich für ein olivgrünes entschieden, mit einem Drachen und diversen Schriftzeichen bedruckt. Sie zeigt auf die Schrift, als wüßte sie etwas.
"Was bedeutet das?", frage ich, neugierig geworden.
Sie hat mich verstanden, will antworten, doch ihr Deutsch reicht nicht aus.
"Ich verstehe auch Englisch."
Ich komme mir dumm vor, den Satz auf Deutsch gesagt zu haben. Sie scheint es nicht zu stören, gibt in fließendem Englisch eine Erklärung.
Das von ihr aus am weitesten rechts befindliche Zeichen heiße "Sonne", doch in Verbindung mit den anderen beiden ergäbe es das Wort "Zeit". Es handle sich wohl um ziemlich alte chinesische Schriftzeichen, ergänzt sie.
Ich bin fasziniert.
"Ist das jetzt fashion?", fragt sie, meint die vielen Mädels (und Jungs), die sich chinesische Schriftzeichen eintättowieren lassen. Ich zucke mit den Schultern. Ich habe das Shirt bestimmt nicht angezogen, um einer Mode nachzugehen. Ich wollte nur nicht frieren.
Als ich mit dem Essen fertig bin, packe ich meine Sachen zusammen und gehe.
"Tschüß.", sage ich.
"Tschüß."
Sie lächelt.
-----
morast - 8. Apr, 18:53 - Rubrik:
Wortwelten
Bloggen ist schwierig.
Niemand schreibt einem vor, was ein Blog zu beinhalten hat, wieviele Wörter, Zeilen, Zeichen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Bilder, Zitate, Links etc zu einem Eintrag gehören. Das Ergebnis solcher Regellosigkeit sind unzählige Weblogs, deren stündliche Neuerungen aus einzeiligen, inhaltslosen Fetzen bestehen, mit denen maximal der Autor selbst etwas anfangen kann und will.
Ich habe nichts dagegen, doch richte an mich selbst den Anspruch, Inhalte vermitteln zu wollen. Wenn man diesen Anspruch mit dem Wissen kombiniert, daß ich es mag, Wörter aneinanderzureihen, steht umfangreicheren Blogs nichts im Wege.
Doch über irgendetwas muß geschrieben werden.
Sicherlich gelänge es mir, mehrere Bildschirmseiten mit der Tatsache zu füllen, daß mir nichts einfällt, was ich denn schriftlich artikulieren könnte. Aber wenn mir nichts einfällt, ziehe ich es vor zu schweigen, schreibe nicht noch darüber.
Lieber schreibe ich über das Leben, über mein Leben. Das ist nicht allzu schwer, begegne ich ihm doch täglich. Ein kleines Notizbuch sammelt wirre Gedanken und erwähnenswerte Ereignisse, die ich dann zu späterem Zeitpunkt ausführlicher formuliere.
Der Spagat zwischen Ehrlichkeit und dem Weglassen scheinbar überflüssiger Dinge ist nicht einfach zu bewältigen. Theoretisch müßte jede Anekdote, die ich verfasse, mit dem ersten Augenblick beginnen, an den ich mich erinnern kann - oder noch eher. Denn wenn man einen Moment lang über ein Ereignis nachdenkt, stellt man fest, daß mehrere andere Ereignisse dazu beitrugen, daß geschehen konnte, was geschah. Diese jedoch haben wiederum ihre eigenen Ursachen...
Vielleicht fällt es mir deswegen zuweilen so schwer, zum Punkt zu kommen, zu erzählen, was ich eigentlich erzählen wollte: Mich drängt das Bedürfnis, alle Hintergründe aufzudecken, alles zur Erzählung Gehörige aufzuzählen, trägt es doch zum besseren Verständnis, zu einer begründeten Meinungsbildung bei.
Doch nicht nur die einleitenden, zum Ereignis hinführenden Worte gestalten sich zuweilen recht schwierig, sondern auch die abschließenden.
Ein Blog sollte eine Pointe besitzen, einen Knaller, ganz zum Schluß, in der letzten oder vorletzten Zeile, etwas, worauf der gesamte zuvor gelesene Text hinarbeitet, etwas, das ihn schließt, vielleicht zum Anfang zurückkehrt, vielleicht eine Frage in den Raum stellt, vielleicht den Lesenden zu weiterführenden Gedanken bewegt.
Doch berichtet man über das "wirkliche Leben", erweist sich dieser besondere Abschluß als schwierig. Ich selbst stellte schon fest, irgendeinen Text nicht veröffentlichen zu wollen, bloß weil ein ordentliches Ende fehlte, weil ich zwar über eine skurrile Sache berichtete, doch den abschließenden Knaller nicht fand.
Denn das Leben hört nicht auf. Es gibt keinen pointierten Satz zum Schluß, keinen Witz, keine offene Frage. Es geht immer weiter, neue Geschichten, die sich an die alten anreihen, ohne daß irgendwer zwischendurch so freundlich war, "ENDE" zu schreiben. Neues gründet sich auf Altem, und selbst wenn das eigene Dasein verblich, wird doch die eigene Geschichte in anderen fortgeführt...
Bloggen ist schwierig.
ENDE
-----
morast - 8. Apr, 18:52 - Rubrik:
Wortwelten
Gestern Abend belästigte ich meine Mitbewohnerin ein wenig und sah mit ihr fern. Es kam nichts Besonderes, irgendeine Sendung über verhunzte Schönheitsoperationen. Doch in mein Zimmer zurückzukehren hätte bedeutet, mich der Pflicht widmen zu müssen. Und das wollte ich wirklich nicht.
1999/2000 war ich Zivildienstleistender in einem Krankenhaus. Stationen Dermatologie I-III, beziehungsweise: Haut I-III. Eine recht angenehme Arbeit, wenngleich ich bis heute nicht begreifen kann, wie ich es schaffte, morgens um fünf aufzustehen. Ich glaube, ich haßte es.
Aber ich war der Liebling der Patienten, wurde von älteren Damen mit Vorliebe mit "mein Schatz" oder "mein Engel" betitelt, mußte schuften, hatte aber auch Tage, an denen ich nur sinnlos rumhing und mit irgendwelchen Patienten quatschte, bis die Zeit rum war.
In dieser Zeit habe ich allerhand Erschreckendes gesehen und kennengelernt. Ich durfte alte Männer duschen [selten], alte Frauen duschen [ein Mal], sah offene, nässende Wunden [haufenweise]. Ich durfte einer OP beiwohnen, in der einer Frau vom Oberschenkel mit einem rasierapparatähnlichen Gerät Haut vom Oberschenkel entfernt wurde. Dieser Hautlappen wurde dann auf die doppelte Größe gedehnt, um ihn anschließend auf eine vorher operierte Stelle zu nähen. Ich sah [und roch], was passiert, wenn der Plastikbeutel eines künstlichen Darmausganges wegen Überfüllung platzt und sein Inhalt sich im gesamten Zimmer verteilt. Ich sah riesige Nähte, schimmlige Füße. Ich durfte braune Kleckerspuren auf dem Stationsgang aufwischen, durfte schwitzende Menschen berühren, schuppige Haut eincremen.
In wenigen Fällen war der Anblick angenehm, zuweilen fühlte ich mich unwohl, doch alles war erträglich, akzeptabel. Ich konnte damit leben, arbeitete eigentlich sogar gern im Krankenhaus.
Gestern Abend jedoch sah ich diese Sendung im Fersehen, sah, wie Brüste aufgeschnippelt wurden, um irgendeinen Kram unter die Haut zu schieben, sah, wie Menschen während ihrer Narkose behandelt wurden als wären sie totes Vieh. Ich sah, wie einer Frau irgendeine fettlösende Flüssigkeit in die Beine gespritzt wurden, die diese dann aufquellen ließ, sah, wie mit einem Sauger unter der Haut hantiert wurde, wie sich die bewegenden Konturen des Saugers außen abzeichneten, fragte mich, was wohl mit dem abgesaugten Fett geschehen würde [Mettwurst?] - und ekelte mich, wollte nicht länger hinsehen.
13 Monate Zivildienst hatten mich abgehärtet, glaubte ich.
"Schalt bitte um.", bat ich meine Mitbewohnerin.
-----
morast - 8. Apr, 18:11 - Rubrik:
Wortwelten
Es regnet. Vor dem Magdeburger Allee-Center entdecke ich ein blindes Mädchen. Sie trägt einen Blindenstock in der Hand, benutzt ihn aber nicht, erhält Führung von einem anderen Mädchen, einer Freundin vielleicht. Die beiden meiden die automatische Drehtür, betreten das Einkaufscenter durch den "normalen" Seiteneingang.
Im Inneren sehe ich eine Rollstuhlfahrerin. Sie steht vor der Drehtür und rührt sich nicht. Bevor ich einen Gedanken fassen kann, begibt sich das führende Mädchen zusammen mit ihrer blinden Begleiterin zu der Frau im Rollstuhl:
"Brauchen Sie Hilfe mit der Tür?"
"Ach nein, ich komme schon klar.", antwortet sie, dankbar für die Aufmerksamkeit, "Nur meine Kapuze...".
Während die hilfbereite Blindenführerin vorsichtig die Kapuze über den Kopf der Dame stülpt, frage ich mich, ob einer von uns "normalen" Menschen auf den Gedanken gekommen wäre, der Rollstuhlfahrerin Unterstützung anzubieten.
'Die wenigsten.', denke ich und seufze leise.
-----
morast - 8. Apr, 15:44 - Rubrik:
Menschen
In Gedanken versunken nähere ich mich der Ampel. Rot. Ich bleibe stehen, grüble. Weitere Wartende gesellen sich zu mir.
Nach einer Weile sehe ich auf. Kein Auto weit und breit. Wie auch? Die Ampel steht inmitten einer Baustelle.
Warum also warte ich? Weil ich unbewußt einem Automatismus frönte? Weil ich gut erzogen bin?
Warum warten die anderen? Weil sie nicht sehen, daß hier keine Autos fahren? Weil sie einer Art Herdentrieb folgen und stehenbleiben, wenn andere auch stehenbleiben? Weil sie als gesetzestreue Deutsche rote Ampeln auch respektieren, wenn sie sinnlos sind?
Ich schüttle die Gedanken ab. Die Ampel leuchtet noch immer in warnendem Rot. Egal. Ich gehe. Die Herdentriebler bleiben stehen.
Als ich die Kreuzung längst hinter mir gelassen habe, drehe ich mich neugierig noch einmal um, sehe, daß sich nun endlich auch die anderen in Bewegung setzen.
Die Ampel leuchtet grün.
-----
morast - 8. Apr, 15:44 - Rubrik:
Menschen
Als ich eines späten Abends durch die Dunkelheit mit dem Fahrrad nach Hause fuhr, sah ich einen Streifenwagen von der Sorte, die im Volksmund auch als "Sixpack" bezeichnet werden, am Straßenrand stehen. Die Polizisten waren ausgestiegen und beschäftigten sich mit einem Radfahrer, den sie augescheinlich angehalten hatten, weil dieser ohne ordnungsgemäße Beleuchtung durch die Gegend zu fahren gewagt hatte.
Ich selbst radelte auch lichtlos und trug zudem noch, in Ermangelung von Taschen oder eines Gepäckträgers, zwei gebrannte CDs in der Hand, deren Inhalte nicht auf "rechtem" Wege zu mir gelangt waren. Die Aussicht auf ein Strafgeld wegen meines verkehrsunsicheren Gefährts und auf einen Besuch diverser Raubkopiefahnder in meiner Wohnung veranlaßten mich, vorsichtshalber die Straßenseite zu wechseln.
Schon wollte ich mir gratulieren, die Polizisten, welche sowieso durch ihr bisheriges Opfer abgelenkt gewesen waren, clever umfahren zu haben, als ich mich plötzlich inmitten einer Meute aus dreißig grünbetuchten Gesetzesvertretern befand.
Diese hatten mein Ausweichmanöver beobachtet und forderten mich mit bedrohlichen Gesten auf abzusteigen. Ich fuhr nicht nur ohne Licht und war vor einer möglichen Kontrolle geflohen, sondern befand mich nun auch noch auf der falschen Straßenseite. Die CDs hatten sie noch gar nicht bemerkt.
Von allen Seiten vernahm ich nun kritische Kommentare. Was dieses Fluchtmanöver sollte, wollte jemand wissen, wohin ich radelte, warum ich ohne Licht fuhr. Eingeschüchtert behauptete ich, mein Dynamo sei vor wenigen Hundert Metern abgefallen. Tastächlich war meine Beleuchtung voll funktionstüchtig - wenn man vom fehlenden Dynamo absah.
"Warum haben Sie den Dynamo dann nicht dabei?"
"Ich fand ihn nicht - ohne Licht."
Kritisch beäugten vier oder fünf Uniformierte mein Rad, prüften gewissenhaft jede Kleinigkeit, leuchteten mit Taschenlampen jedes Detail ab, sahen die Lampen, sahen den fehlenden Dynamo, übersahen die defekte Vorderbremse.
Was machten überhaupt 30 Polizisten mitten in der Nacht an diesem Ort? Sicherlich hatten sie Wichtigeres zu tun, als Radfahrer zu belästigen. Und tatsächlich, sie waren abgelenkt, nicht ganz bei der Sache.
Denn noch während sie miteinander diskutierten, bemerkte ich, daß ich nicht mehr beachtet wurde und begann, mich langsam, allmählich, das Fahrrad schiebend, von ihnen weg zu bewegen. Sie hielten mich nicht auf, redeten weiter.
Ich lief, das Fahrrad am Lenker haltend, einhundert, zweihundert Meter. Ständig wollte ich zurücksehen, ob die Polizisten mir hinterherschauten, ob sie gar hinter mir hereilten. Doch ich hielt mich zurück, starrte stur geradeaus, nach vorn - und schob.
Kaum trennte mich eine Kurve von der Polizistenmeute, sprang ich aufs Rad.
"Fickt euch.", murmelte ich und fuhr eilig davon.
-----
morast - 7. Apr, 18:11 - Rubrik:
Wortwelten
Nachdem ich bei der vorangestellten Informationseinholung äußerst zuvorkommend und freundlich mit nützlichen Auskünften versehen worden war, freute ich mich nahezu auf meinen Besuch beim Einwohnermeldeamt. Doch vor den Pforten des ehemaligen Einwohnermeldeamtes stehend geriet ich in leichte Verwirrung:
Wo war das Amt? Hier befand sich nur ein "Bürgerbüro", was auch immer sich hinter diesem alles- und nichtssagenden Namen verbergen mochte. Ich lugte hinein und entdeckte eine Tafel mit der Aufschrift "Bitte fragen Sie zuerst an der Information."
Das zu tun, war ich gewillt. Ich stieg die wenigen Stufen hinauf, um der jungen und einigermaßen attraktiven Informationsdame mein Anliegen vorzutragen. Scheinbar war ich richtig, scheinbar hieß das Einwohnermeldeamt jetzt ganz zwanglos Bürgerbüro - denn die junge Dame reagierte prompt, riß eine Nummer von einer Rolle ab und reichte sie mir: 38.
Ich begab mich in den Warteraum und fand einen freien Platz. Auf der Anzeigetafel leuchtete eine rote 18.
Obwohl ich bei Ämtern prinzipiell grenzenlosem Optimismus fröne und vor Betreten des meist übervollen Wartesaals die stets unpassende Ansicht vertrete, nur wenige Augenblicke mit Warten verbringen zu müssen, fühlte ich weder Enttäuschung noch Überraschung, als ich feststellte, daß ich noch 20 vor mir Aufgerufene abwarten mußte.
Ich hatte ja mein Buch.
Und den Kassenautomaten.
Die früher "menschliche" Kasse war gegen einen Automaten ausgetauscht worden. Wenn man also aufgerufen wurde und sich zu einem Schalter begab, um irgendetwas zu beantragen, bekam man dort eine Plastikkarte mit integriertem Chip gereicht. Dann hatte man sich zurück in den Warteraum zum Kassenautomaten zu begeben, um dort die Karte einzuführen und den auf dem Display erscheinenden Betrag zu bezahlen. Als Dank dafür bekam man Wechselgeld in Münzen und zwei Quittungen - eine für den Eigenbedarf und eine, die man der Sachbeabeiterin am Schalter reichen sollte, die dann den gestellten Antrag komplettierte und versandfertig machte.
Gerade stellte ich mir die Frage, was wohl passieren würde, wenn der Automat seinen Dienst verweigerte, als eine korpulente Frau mit erstaunlich fröhlichem Lächeln auf dem Gesicht an den Metallkasten herantrat und die Karte einführte. Jedoch spuckte der Automat diese sofort wieder aus. Verdutzt, aber ohne ihr Lächeln zu verlieren, stellte die Frau ihre Handtasche auf einen leeren Stuhl und kramte darin nach ihrer Brille. Mit stärkerer Sehkraft bewaffnet wagte sie einen zweiten Versuch und schob die Karte wieder in den dafür vorgesehenen Schlitz. Einen Augenblick später war die Karte schon wieder draußen.
Noch immer lächelnd begab sie sich zur Information, befragte die schon erwähnte Informationsdame:
"Was muß ich tun, wenn der Automat die Karte nicht will?"
"Rubbeln.", war die Antwort.
Die Informationsdame nahm ihre Karte, rieb sie eine Weile am rechten Hosenbein ihrer Jeans, trat an den Automaten, schob sie hinein - und wunderte sich, daß sie wieder hinausglitt. Ein zweiter Versuch lieferte das gleiche Ergebnis. Doch wenn die Informationsdame "Rubbeln" sagt, meint sie es scheinbar ernst: Eine geraume Weile rieb sie die Karte an den Ärmeln ihres Wollpullover. Jetzt aber.
Karte rein. Karte raus. Karte rein. Karte wieder raus. Mist.
Eine zweite Kartenbesitzerin trat herbei, wünschte ebenfalls zu zahlen. Die Informationsdame hatte einen Geistesblitz: Sollte doch die andere ihr Glück versuchen. Sie versuchte. Karte rein. Karte raus.
Ratlos holte die Informationsdame Hilfe, ließ die beiden Kartenbesitzerinnen planlos zurück. Die neu Hinzugetretene probierte es erneut, hatte die vergeblichen Vorversuche nicht mitbekommen. Karte rein. Karte raus. Sinnlos.
Ein Mann trat herbei. Scheinbar hatte er die technisch hochwertigen Worte der Informationsdame vernommen, denn er rieb seine Karte emsig am Hosenbein. Auch er versuchte sein Glück, steckte die Karte in den Automatenschlitz - und sah sie wieder herauskommen. Doch er gab nicht auf. Fast schon wahnhaft rieb er nun seine Karte auf seinem Bauch herum, besser: an seinem gelben Poloshirt. Das mußte doch gehen!
Ein erneuter Versuch. Wer wagt, verliert. Alles Rubbeln nützte nichts, die Karte kam zurück. Der Mann resignierte.
Hilfe eilte herbei. In Form einer Dame mittleren Alters, mit einem Schlüssel bestückt. Diese öffnete den Automaten, friemelte ein wenig in den Innereien herum, zerrte eine Tastatur heraus, startete ihn neu. Ihr Bemühen wirkte ziellos, planlos.
Sie schloß den Kassenautomaten, griff sich die nächstbeste Karte, schob sie ein. Sie kam zurück. Wer hätte das gedacht.
Mittlerweile hatte sich um den Automaten eine Menschentraube zahlungswilliger Kartenbesitzer gebildet. Doch der Automat verweigerte sich ihnen. Eine zweite Hilfe eilte hinzu, doch redete nur, ohne etwas zu bewirken. Der Automat weigerte sich weiterhin. Der Mann mit dem gelben T-Shirt probierte es erneut. Er schien ein sturer Kopf zu sein. Doch selbst das half nicht: Als er seine Karte hineinschob, wurde sie umgehend wieder ausgeworfen.
Und wieder bekam die Menschenmasse Zulauf. Eine etwa 35jährige Frau mit blondiertem Haar stellte schüchtern die Frage, ob denn auch sie es versuchen könnte. Bereitwillig wurde sie durchgelassen. Warum nicht? Die anderen hatten ja nichts zu verlieren.
Die blonde Frau wagte ihr Glück. Der Kassenautomat mutierte zum Glücksspielautomat. Karte rein. Bingo!
Tatsächlich behielt der Automat die Karte. Die blonde Frau freute sich wie über einen Hauptgewinn, als sie ihren Geldbetrag einzahlte. Im Gegenzug rasselte der der Blechkasten wie bei einem Jackpot: das Wechselgeld.
Froh und sichtlich erleichtert verließ der Blondine den Wartebereich, ließ die anderen zurück, die nun ebenfalls danach drängten, ihr Glück nochmal auf die Probe stellen zu dürfen. Und siehe da: Plötzlich nahm der vorher so starrköpfige Automat alle Karten an und kassierte, kassierte, kassierte.
Keinen störte es mehr, 26 Euro für einen Reisepaß ausgeben zu müssen, nein, es war ein Segen, die eigenen Geldscheine im Automaten verschwinden zu sehen. Halleluja, der Automat funktionierte! Nimm unser Geld, auf daß du noch ewig funktionieren mögest!
Nur eine Frage verblieb unbeantwortet: Was würde geschehen, wenn der Automat einmal irreparabel funktionsuntüchtig wäre, wenn kein Glücksspiel, kein Zufall alle Ärgernisse ungeschehen machte, wenn die wartenden Bürger keine Gelegenheit bekämen, ihr sündiges Geld loszuwerden...?
-----
morast - 7. Apr, 18:10 - Rubrik:
Wortwelten
Ich neige dazu, bei offenem Fenster schlafen zu wollen. Das ist soweit nichts Ungewöhnliches, schlafen doch vermutlich Millionen Deutsche bevorzugt auf diese Art und Weise. Allerdings führen nicht sämtliche Schlafzimmerfenster dieser Millionen Frischluftschlafender auf einen Innenhof. Meines schon. Das meines Bruders auch. Zumindest früher.
Bevor er umzog, lebte er in Halle in einem bereits ziemlich heruntergekommenen Viertel. Das von ihm bewohnte Miethaus wirkte noch recht beschaulich, doch die Umgebung war eher traurig anzusehen. Das zeigte sich auch an den dort ansässigen Bewohnern, die zumeist den sozial schwächeren, den "bildungsfernen" Schichten anzugehören schienen.
Das Schlafzimmer, das mein Bruder mit seiner Freundin teilte, besaß nur ein Fenster. Doch Innenhöfe haben die unangenehme Angewohnheit, Schall mehrfach zu reflektieren, so daß ein einzelnes Wort bis in oberste Stockwerke, in entfernteste Wohnungen zu dringen vermag - auch durch ein einzelnes Fenster. Erst recht der Lärm spielender Kinder, die Gespräche alkoholisierter Trinkgenossenschaften, die Zankereien pubertierender Jugendlicher, das unaufhörliche Schreien unbeachteter Babys und die inhaltsleeren Plaudereien dialogisierender Muttis.
Wenn mein Bruder von der Nachtschicht heimkam, wollte er schlafen. Mehr nicht. Doch konnte er damit rechnen, daß Angehörige erwähnter Gruppierungen sich auf dem Innenhof versammelt hatten, um - sämtliche freundlich mahnenden Schilder ignorierend - ihre Anwesenheit mit entsprechender Lautstärke kundzutun. Schallwellen wurden gegen Hauswände geschmettert, reflektiert, wieder reflektiert und drangen schließlich durch das geöffnete Fenster in das Schlafzimmer meines Bruders. An Schlaf war nicht zu denken.
Die von mir derzeit bewohnte Gegend ist keineswegs Brennpunkt sozial Schwacher, sondern eher gehobenen Standards. Und doch zeigt das Fenster, unter dem sich mein Bett befindet, zum Hof hinaus, und zuweilen kommt es vor, daß ich mich ärgere, wenn die Bauarbeiter schon in aller Frühe damit beginnen, Aluminiumträger zu zersägen oder wenn Freundinnen verschiedener Hauseingänge beim Entsorgen des Hausmülls endlose Gespräche führen, die lautstark und klar zu mir hinaufdringen.
Heute Morgen erwachte ich von einem mir unbekannten Gräusch, das sich unregelmäßig wiederholte. Es klang wie ein Trommeln, allerdings ohne Rhythmus, ohne Metrum, mal schneller, mal langsamer. Schläfrig lauschte ich dem ungewohnten Klang und stellte fest, daß es vermutlich nicht von Menschenhand produziert wurde, waren die Trommelwirbel doch zu unregelmäßig und teilweise auch zu schnell. Auch konnte ich mir nicht vorstellen, daß irgendwer mutwillig sich in den Innenhof setzte, um irrsinnige Trommelkunststücke zu vollführen.
Ich schloß die Augen und wollte die Lösungs des Rätsels auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, doch das Trommeln war zu laut, zu aufdringlich. Ich konnte nicht schlafen. Ruhelos lag ich im Bett und haderte mit dem Gedanken, das Fenster zu schließen. Doch dieser Vorgang beinhaltete eine Bewegung, die mich womöglich endgültig aus meinem Schlummer gerissen hätte.
Ich rührte mich nicht, ließ die Gedanken treiben und lauschte nebenbei dem verrückten Trommler. Was konnte das sein?
Ein Blick nach draußen zeigte mir Grau. Dicke Wolken bevölkerten Himmel und gaben einen Teil der Lösung des Mysteriums preis.
Seufzend erhob ich mich, ging ins Bad. Zurück in meinem Zimmer entsann ich mich der Trommelei. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, sah aus dem Fesnter und lugte nach unten. Kein irrer Trommler weit und breit.
Doch an der gegenüberliegenden Hauswand endete eine Regenrinne - wohlgemerkt im fünften Stock. Ein steter Strom gesammelten Regenwassers plätscherte fröhlich aus dem Ende heraus und fiel dann mehrere Meter in die Tiefe. Mein Blick folgte dem Sturz des Miniaturwasserfalls und entdeckte am Boden ein Schimmern.
Ich kniff die Augen zusammen.
In einer Ecke des Hofes hatten die Bauarbeiter, die zu zweit seit mindestens drei Jahren das Haus sanierten, Schotter und anderen Baumüll gelagert. Dieser bereits unschöne Anblick wurde ergänzt durch eine nicht geringe Anzahl wild aufeinandergeworfener Aluminiumstücke, die wohl überflüssig und unnütz waren.
Doch dem Regen nützten diese Blechteile durchaus etwas, konnte er sie doch als Trommelinstrument mißbrauchen. Stürzte nun aus dem Regenrinnenende im fünften Stockwerk ein einzelner Tropfen mit hoher Geschwindigkeit auf die Aluminiumstücke, die sich als Träger akustischer Schwingungen sehr gut eigneten, entstand ein dumpfer, blecherner Trommelklang. Jedoch handelte es sich nicht um einen einzelnen Tropfen, sondern um einen ganzen Bach, der dem Regenrinnenende entsprang.
Munter plätscherte die Tropfensammlung auf die Metallteile ein, trommelte wild und verrückt ein Lied zu Ehren des Regens, zu Ehren des trüben Wetters, ein Lied, das durch den gesamten Innenhof schallte, durch geöffnete Fenster in Wohnungen eindrang und heimtückisch friedfertige Mieter um ihrem wohlverdienten Schlaf brachte.
'Na, warte!', murmelte ich, riß beide Fenster weit auf und schaltete die Musikanlage an. Böse Gitarrenklänge, virtuose Trommelwirbel und düsteres Gekreisch gellten aus meinen Boxen, beschallten den Innenhof.
'Wenn ich nicht schlafen kann, soll es keiner!', dachte ich und erhöhte die Lautstärke.
Der Regen war nicht mehr zu hören. Ich hatte gesiegt.
-----
morast - 7. Apr, 18:08 - Rubrik:
Wortwelten
Der Song "Losing My Religion" von REM kann eindeutig nicht zu den schlechtesten gerechnet werden und bringt, selbst wenn er mit unangenehmen, penetranten Bässen unterlegt wird, noch eine erstaunlich hohe Tanzbarkeit mit sich, vermutlich nicht zuletzt dem starken Wiedererkennungs- und Mitsingpotential geschuldet.
Noch schöner ist es allerdings, die "Losing My Religion"-Version der Black Metal Band Graveworm zu kennen, während der eigenen Tanzbewegungen im Ohr zu wissen, heimlich in sich hineinzugrinsen und den Liedtext nicht nur mitzusingen, sondern - dem Graveworm-Beispiel folgend - mitzukreischen, mitzuschreien, mitzugrunzen...
P.S: Gäbe es so etwas wie "Antibewegung" oder "Negativbewegung", wäre sie zu "Call On Me" von Eric Prydz, diesem Unlied, optimal angewendet.
-----
morast - 7. Apr, 18:06 - Rubrik:
Wortwelten
Heute ist der Tag des Drachen.
-----
morast - 6. Apr, 18:06 - Rubrik:
Wortwelten
In meiner ersten Wohngemeinschaft lebte ich mit zwei Studentinnen zusammen. Wenn ich diesen Umstand in geselliger Runde kundtat, erntete ich von den Männern zumeist ein neidisches Grinsen. Ein Mann, zwei Frauen - genug Nahrung für mehr oder minder schmutzige Phantasien. Weibliche Anwesende jedoch schenkten mir stets mitleidige Blicke und Worte - und sie hatten recht. Tatsächlich fühlte ich mich innerhalb der WG-Wände nicht selten unterdrückt.
Egal, worum es ging, ich konnte darauf wetten, daß die beiden Frauen sich zusammenschlossen, um gemeinsam eine andere Meinung zu vertreten als ich, um mir gemeinsam Contra zu geben und mich mit einander ergänzenden Wortfluten an die Wand zu reden. Und wenn ich dann noch immer stand, noch immer diskutierte, noch immer meine Ansicht vertrat, flüchteten die beiden stets in unsachliche, themenunabhängige Kritik an meiner Männlichkeit.
Nicht, daß mich das schmerzte oder beeindruckte, doch steter Tropfen höhlt den Stein, und wenn man[n] mehrmals täglich gesagt bekommt, der nächste Mitbewohner werde ein "richtiger Mann" und wenn man[n] ergänzend mit allerlei unmännlichen Attributen belegt wird, dann ist nahezu vorprogrammiert, daß irgendwann eine Retourkutsche erfolgen wird.
Meine heimliche Art der Rache war es, den Mädels zuzuschauen, wie sie vor einer Verabredung stundenlang vor dem Badezimmerspiegel standen, um sich zu frisieren und zu bemalen. "Stundenlang" ist keine Übertreibung, war es doch üblich, anderthalb Stunden vor dem Verlassen der Wohnung, das Badezimmer mit kosmetischem Allerlei zu blockieren - und das täglich. Niemand - abgesehen von meiner Wenigkeit natürlich - durfte jemals einen Blick auf das ungeschminkte Gesicht meiner Mitbwohnerinnen werfen, durfte die farbige Fassade durchbrechen und das wahre Antlitz beschauen.
Im Bad stehend gerieten die Schönheitsfanatikerinnen stets unter Zeitdruck, fragten mich alle paar Minuten gestreßt nach der Uhrzeit.
"Wie spät?", tönte es vom Spiegel her.
Gelassen schaute ich auf die Uhr - und addierte eine Viertelstunde.
"22.31 Uhr.", meldete ich und erfreute mich des nun folgenden Schauspiels.
"Waaaaah!!!".
Wie Furien hasteten die Mädels plötzlich durch die Wohnung, klaubten eilig Schuhe, Klamotten, Bürsten, Haargummis und restliches Schminkzeug zusammen, warfen alles auf einen Haufen, besahen sich im Spiegel, schmissen benötigtes Mitnehmutensiliar in ihre winzigen Taschen, rannten wieder ins Bad, schminkten sich weiter, frisierten sich weiter, hektisch, rastlos - bis ich nach mehreren unterhaltsamen Minuten genießerischen Beobachtens gnädigerweise meinen "Irrtum" eingestand.
Glücklicherweise lernten die beiden niemals, einfach eine funktionstüchtige Zeitanzeige ins Bad mitzunehmen, so daß sie sich immer wieder auf meine Aussage zu verlassen hatten - und immer wieder in jene Panik verfielen, die ich an ihnen so sehr schätzte.
-----
morast - 6. Apr, 18:05 - Rubrik:
Wortwelten
Auf Wunsch eines
freundlichen Lesers deklariere ich spontan das Wort
klauben
zum heutigen Wort des Tages.
Und tatsächlich hat es den Titel verdient, neige ich doch dazu, es häufiger in Benutzung zu ziehen. Bemerkenswert ist auch der Klang des Wortes, dem in meinen Ohren seine Tätigkeitsbeschreibung schon anzuhören ist...
-----
morast - 6. Apr, 10:52 - Rubrik:
Tageswort
Sich zu fühlen, als hätte man geweint, minutenlang, tagelang. Als wären alle Tränen der Vergangenheit, der Zukunft, aus dem Herzen, aus den Augen geflossen, in trübem Fluß vereinigt auf das Leben niedergeprasselt und hätten jeden Schrei, jedes Flüstern erstickt. Das Lächeln löst sich auf in den salzigen Fluten, schmilzt zu kalter Angst, zu heißer Trauer, verwischt zu einer absurden Fratze verlorener Möglichkeiten, zu einem falschen Grinsen im Angesicht des Schmerzes. Als wäre jeder gelebte Tag vergebens, als wäre jeder ersonnene Moment nur Traum, blutet die Seele in die Gedanken, hinein in den Schädel, sprengt die Ketten, die Zwänge, befreit sich gleißend von Wirklichkeit, befreit sich feucht vom eigenen Wesen. Mit roten Augen hinabzublicken und sich auf totem Boden zerfließen, verwesen zu sehen, eingetaucht in das glitzernde Leid, das auf staubigem Beton den eigenen Namen schreibt. Haltlos entziehen sich die Tränenbäche den zitternden Fingern, den greifenden Händen, versickernd müde glucksend im unentrinnbaren Gestern, ein wortloses Bild aus Sehnsucht mit sich in die Tiefe reißend.
-----
morast - 5. Apr, 22:50 - Rubrik:
Geistgedanken
In der Bibliothek erfuhr ich heute die Antwort auf eine der Fragen, die ich mir schon häufiger stellte:
Was passiert eigentlich, wenn der Diebstahldetektor am Ausgang Alarm schlägt?
Die Rede ist von diesen mannhohen, plastikverschalten Dingern, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen, das dafür sorgt, daß noch nicht bezahlte und daher gesicherte Ware nicht aus Kaufhäusern entwendet werden kann, die starr und unbeteiligt an Ein- und Ausgängen, aber auch an Rolltreppenenden und -anfängen herumstehen, im Fall einer unzulässsigen Bereichsüberschreitung aber geräuschintensiv diesem Umstand kundtun - und womöglich dabei auch noch lustig blinken.
Schon häufiger geschah es beispielsweise im mehrstöckigen, rolltreppenverzierten Magdeburger Karstadtgebäude, daß der Alarm auf diese Art und Weise losging. Doch nie entdeckte ich emsige und vor allem kräftige Sicherheitsbeamte, die in Sekundenschnelle den Verdächtigen gefaßt und seiner Schandtat bezichtigt hatten. Ja, selbst als ich persönlich eine Saturnfiliale verlies und ungeschickterweise zum Auslöser jener Sicherheitsvorrichtung mutierte, dauerte es eine erstaunliche Weile, bis ein wenig überzeugender Sicherheitsbeamter mich, der in Unkenntnis der eigenen Untat verdutzt stehengeblieben war, zur Rede gestellt hatte, obgleich er direkt neben dem Diebstahldetektor mahnend Position bezogen hatte. [Natürlich war ich kein Dieb, hatte nur die mit einem Sicherheitsetikett beklebte Folie einer CD-Hülle zu Reinhörzwecken abgefriemelt und unklugerweise in meiner Manteltasche verstaut.]
Mir selbst sind Fälle von einer damaligen ProMarkt-Filiale bekannt, in denen die alarmbereiten Geräte aus technischen Gründen gar funktionsuntüchtig gewesen waren und somit nur herumstanden, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen.
Ich vermute, daß man diesen höflich-drohenden Charakter, diesen Apell an die eigene Ehrlichkeit, bewußt einsetzt, daß also weniger der geräuschintensive Alarm es ist, der Wirkung zeigt, sondern das Gerät an sich, das potentielle Diebe abschreckt - oder zu kreativeren Methoden greifen läßt.
Als ich heute in der universitätseigenen Bibliothek verweilte geschah es gleich zwei Mal, daß übereifrige Studenten das Gebäude zu verlassen versuchten, ohne daß ihre Lektüre ordnungsgemäß entsichert war. In einer eigentlich um Ruhe bemühten Bibliothek ist das alarmgebende Geräusch der Diebstahldetektoren besonders auffällig, und als das Gerät eifrig zu blinken und zu piepsen begann, richteten sich alle Augen auf den vermeintlichen Straftäter.
Doch in beiden Fällen war es der an der Ausleihe sitzende Bibliothekar, den das nervende Geräusch und der womöglich begangene Diebstahl wenig zu kümmern schien. Ohne sichtliches Interesse hob er sein Haupt, blickte zur Tür und formulierte matt fordernd, aber ohne jegliche Brisanz oder Sprachgewalt, ohne jede emotionale Regung, ein einziges Wort, das den potentiellen Kriminellen von seiner sträflichen Untat abhalten, ihn gar zurückrufen sollte:
"Hallo...?"
-----
morast - 5. Apr, 18:05 - Rubrik:
Wortwelten
In letzter Zeit [welch herrlich ungenaue Zeitangabe] fiel mir bei Gesprächen mit anderen immer wieder eine Unart auf, die ich spontan als "CrossFadeTalking" betitelte.
Üblicherweise läuft ein Dialog ab, indem die beiden Gesprächspartner einander zuhören und jeweils, nachdem das Gegenüber seinen Gespächsteil beendet hat, aufeinander eingehen. Daß es dabei passieren kann, daß man aneinander vorbeiredet oder gar in derartige Erregung gerät, daß man sich genötigt sieht, den Gesprächsfluß des anderen durch eigene Zwischenrufe zu unterbrechen, halte ich für normal und nicht weiter erwähnenswert. Was mir jedoch mißfällt, ist folgendes Szenario:
Person A [in den meisten Fällen ich selbst] redet. Zugegebenermaßen ist das Erzählte nicht immer von ergreifendem Tiefsinn. [Aber wer kann schon von sich behaupten, nur historisch Bedeutsames von sich zu geben?] Trotzdem setze ich als Redender voraus, daß es mir gestattet sein möge, meinen Gedankengang, und sei er noch so albern, zu Ende führen zu dürfen. Doch bevor das geschieht, setzt Person B ein, beginnt zu reden, ohne Bezug auf die Worte von Person A zu nehmen, die ja noch nicht einmal zu einem logischen Schluß kommen konnten. Person B beginnt zu reden, erst leise, dann lauter, und Person A, also ich, sieht sich mehr oder weniger gezwungen, seinen Gesprächsfluß zu minimieren und schließlich einzustellen.
"Red doch einfach weiter!", ruft eine Stimme aus dem imaginären Publikum. Doch ich widerspreche: Weiterzureden wäre sinnlos. Zum einen halte ich es durchaus für normal, dem anderen bei seinem Gesagten zuzuhören und selbst zu schweigen, um das Hörbare vollständig erfassen zu können. Zum anderen hätte es wenig Sinn weiterzureden, weil ja Person B, die bis eben noch die Rolle des Zuhörenden belegt hatte, nun selber redet, demnach gar nicht imstande ist, von anderen formulierte Worte vollständig zu erfassen. Ein Gespäch mit einer Wand oder dem Pausenzeichen von Radio Moskau könnte nicht einseitiger sein.
Das Gespräch funktioniert in solchen Augenblicken wie ein Mischpult oder dessen digitales Äquivalent: Track A und B werden ineinander "gefaded". Während die letzten[?] Töne von Track A erklingen, wird schon Track B gestartet. Die Lautstärke von Track A geht zurück; im Gegenzug steigt die von Track B. Das geschieht solange, bis Track A das Lautstärkeminumum erreicht hat und Track B auf dem früheren Track-A-Lautstärkelevel angelangt ist.
Person A verstummt also, ohne seine Ausführungen beendet haben zu können, während Person B ohne jeglichen Gesprächsbezug losplappert und somit verdeutlicht, daß sie das Zuhören und Erfassen der mitgeteilten Inhalte längst aufgegeben, womöglich gar niemals begonnen hat.
Ich fühle mich durch derartiges CrossFadeTalking unangenehm berührt, stellt es doch in Frage, ob das Öffnen meines Mundes zu Artikulationszwecken überhaupt lohnenswert ist, ob es nicht vorteilhafter wäre, sich in das geräuschreduzierte Schweigen eines stummen Zuhörers zu hüllen, dessen Meinungen und Ansichten derart belanglos sind, daß sie nicht vertont zu werden brauchen.
Bleibt zu hoffen, daß die CrossFadeTalking-Unsitte nicht wuchernd um sich greift und die menschliche Verbalkommukation zu einem steten und stupiden Ineinander- und Aneinandervorbeireden verstümmelt, das nur dazu dient, die Eigenansichten in die Luft zu blasen.
-----
morast - 5. Apr, 18:04 - Rubrik:
Wortwelten
"stillgestanden!"
brüllt die furcht
mein zittern wird zum zögern
ich atme stumm
fast reglos
fern
doch zeit gerinnt
vergeht
ein dunkler schleier zieht vorbei
als blind den blick ich senke
ich stehe still
bewege nichts
entrinne meinem sein
"stillgestanden!"
ruft die furcht
zieht furchen in mein leben
ein schneckenhaus schützt meinen geist
formt pfad und sinn
zu kreisen.
www.bluthand.de
-----
morast - 5. Apr, 10:05 - Rubrik:
Seelensplitter
entfesselt bebt der innersturm
frißt den seelensinn
den weg
reißt mit buntgefärbtem licht
schwarzgrimassen aus dem herz
läßt gewalten wortlos tönen
tränenwerfend bebt das haupt
lachend lechzt die seelenwunde
reiß mich
beiß mich
küß mich
tief
tanzt das leben
stampfend
suchend
schreit das herz aus blasser brust
haare flattern tot wie nebel
als der spiegel
klirrend bricht.
www.bluthand.de
-----
morast - 5. Apr, 10:04 - Rubrik:
Seelensplitter